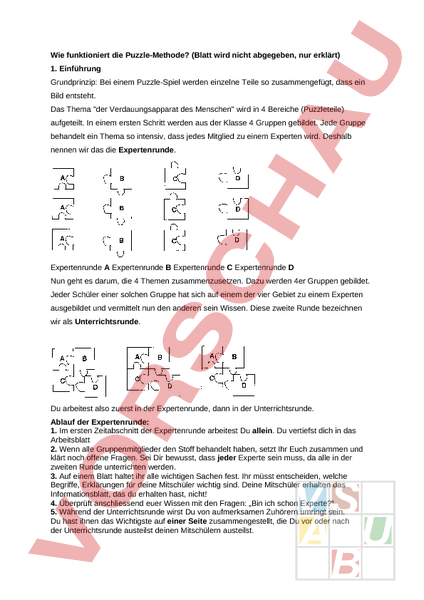Arbeitsblatt: Gruppenpuzzle
Material-Details
Gruppenpuzzle
zu den einzelnen Verdauungsorganen
Biologie
Anatomie / Physiologie
8. Schuljahr
1 Seiten
Statistik
51006
911
1
18.12.2009
Autor/in
Eviii (Spitzname)
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Wie funktioniert die Puzzle-Methode? (Blatt wird nicht abgegeben, nur erklärt) 1. Einführung Grundprinzip: Bei einem Puzzle-Spiel werden einzelne Teile so zusammengefügt, dass ein Bild entsteht. Das Thema der Verdauungsapparat des Menschen wird in 4 Bereiche (Puzzleteile) aufgeteilt. In einem ersten Schritt werden aus der Klasse 4 Gruppen gebildet. Jede Gruppe behandelt ein Thema so intensiv, dass jedes Mitglied zu einem Experten wird. Deshalb nennen wir das die Expertenrunde. Expertenrunde Expertenrunde Expertenrunde Expertenrunde Nun geht es darum, die 4 Themen zusammenzusetzen. Dazu werden 4er Gruppen gebildet. Jeder Schüler einer solchen Gruppe hat sich auf einem der vier Gebiet zu einem Experten ausgebildet und vermittelt nun den anderen sein Wissen. Diese zweite Runde bezeichnen wir als Unterrichtsrunde. Du arbeitest also zuerst in der Expertenrunde, dann in der Unterrichtsrunde. Ablauf der Expertenrunde: 1. Im ersten Zeitabschnitt der Expertenrunde arbeitest Du allein. Du vertiefst dich in das Arbeitsblatt 2. Wenn alle Gruppenmitglieder den Stoff behandelt haben, setzt Ihr Euch zusammen und klärt noch offene Fragen. Sei Dir bewusst, dass jeder Experte sein muss, da alle in der zweiten Runde unterrichten werden. 3. Auf einem Blatt haltet ihr alle wichtigen Sachen fest. Ihr müsst entscheiden, welche Begriffe, Erklärungen für deine Mitschüler wichtig sind. Deine Mitschüler erhalten das Informationsblatt, das du erhalten hast, nicht! 4. Überprüft anschliessend euer Wissen mit den Fragen: „Bin ich schon Experte? 5. Während der Unterrichtsrunde wirst Du von aufmerksamen Zuhörern umringt sein. Du hast ihnen das Wichtigste auf einer Seite zusammengestellt, die Du vor oder nach der Unterrichtsrunde austeilst deinen Mitschülern austeilst. Der Mund und die Speiseröhre – Prüfen, kauen und verdauuen Der Verdauungsprozess beginnt bereits in der Mundhöhle. Die Zähne zerkleinern die Nahrung, sie wird mit Speichel vermischt und damit schluckfähig gemacht. Die Speicheldrüsen produzieren dazu etwa 1,5 Speichel pro Tag. Gutes Kauen vergrössert die Oberfläche der Nahrung, so dass die Verdauungsenzyme leichter und länger einwirken können. Die Speichelproduktion ist nicht nur vom Kauvorgang abhängig. Auch bestimmte Gerüche und Geschmäcker der Speisen reizen die Nase und die Zunge, wodurch mehr Speichel hergestellt wird. Sogar optische oder akustische Eindrücke können die Produktion des Speichels verstärken. Daher kommt auch das Sprichwort, dass wenn man eine leckere Speise sieht oder riecht, einem „das Wasser im Munde zusammenläuft. Das Verdauungsenzym (Enzym ein Stoffe, der bestimmte chemische Vorgänge auslöst) des Speichels ist die Amylase. Sie leitet im Mund die Kohlenhydratverdauung ein. Sie spaltet die Stärke, die Mehrfachzucker, in kleinere Bestandteile, in Doppelzucker. Das Schlucken ist einer der kompliziertesten Reflexe, die im menschlichen Körper ablaufen. Mehr als 20 Muskeln sind daran beteiligt. Da sich Atem- und Speiseweg kreuzen, muss dafür gesorgt sein, dass keine Speiseteile in die Luftröhre gelangen. Dies wird erreicht, indem der Kehldeckel des Kehlkopfes die Luftröhre während des Schluckens verschliesst. Dieser Reflex verhindert, dass die Nahrung in den „falschen Hals gerät. Die Speiseröhre ist nun weit geöffnet und der Speisebissen gelangt in die Speiseröhre. Die Speiseröhre ist etwa 25cm lang und dient dem Transport und Verbindungsweg der Speisen zwischen Rachen und Magen. Sie ist ein elastischer Muskelschlauch. Nach innen ist sie mit Schleimhaut ausgekleidet, die durch die Abgabe von Schleim die Gleitfähigkeit der Bissen erhöht. Der Transport erfolgt aktiv durch viele verschiedene ringförmige Muskeln. Die Muskeln ziehen sich hinter dem Bissen automatisch zusammen und schieben ihn in Richtung Magen. Vom Mund zum Magen braucht die Nahrung etwa viel bis acht Sekunden. Ein Schluck eines Getränks benötigt nur eine Sekunde. Es kann also durchaus sein, dass ein Brotbiss vom Schluck Wasser danach „überholt wird. Hauptaufgabe: Zerkleinern und Verflüssigen der Speisen Weitertransport der Speisen zum Magen Der Magen – Nahrungsspeicher und Proteinverdauung Der Magen ist muskulöser Behälter. Im Magen werden die Speisebissen mit dem Magensaft gründlich vermischt und als Speisebrei an den oberen Teil des Dünndarms, den Zwölffingerdarm abgegeben. Der Magen ist zunächst ein Auffangbehälter für die Nahrung. Seine Bewegungen vermischen den Speisebrei mit dem Magensaft und zerkleinern die Speisen. Der Magen produziert täglich etwa 2l Magensaft, der überwiegend aus Schleim, Salzsäure und dem Enzym Pepsin besteht. (Enzym ein Stoffe, der bestimmte chemische Vorgänge auslöst). Das wichtige Enzym Pepsin spaltet die Proteinketten (Eiweisse) in kleinere Proteinketten. Die Proteine werden aber noch nicht vollständig gespaltet. Im Magen werden sie erst einmal nur in grobe Bruchstücke gespalten. (die Endverdauung findet im Darm statt) Die stärk ätzende Salzsäure bewirkt dass die Eiweisse gerinnen (gerinnen heisst, sie ändern ihre räumliche Struktur). Sie werden dann leichter von dem Enzym Pepsin angegriffen und in kleineres Stücke aufgespalten. Die Salzsäure im Magen tötet zudem die meisten, mit der Nahrung aufgenommenen Bakterien ab und dient somit dem Schutz vor Infektionen. Die Magenwand besteht ebenfalls aus Eiweissen. Da die Salzsäure so wirkungsvoll ist, würde sie auch die Magenwand zerstören. Doch die oberste Schicht der Magenwand besteht aus Zellen, die den Magenschleim bilden. Der Schleim bildet einen geschlossenen Film, der den gesamten Magen von innen auskleidet. Er bildet so einen schützenden Belag vor dem Angriff der Salzsäure und den Enzymen. Auf diese Weise wird verhindert, dass der Magen sich selbst verdaut. Im Magen werden noch keine Nährstoffe ins Blut aufgenommen. Vom Magen wird die Nahrung Portionsweise an den Zwölffingerdarm abgegeben. In welcher Zeit sich dieser Vorgang abspielt, bis der Magen endgültig leer ist, ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Der Magen entlässt immer nur so viel Nahrung in den Darm, wie dieser verarbeiten kann. Die Speise kann insgesamt zwischen zwei und sieben Stunden im Magen liegen. Am kürzesten verweilen kohlenhydratreiche Speisen. Deswegen lässt das Frühstücksbrötchen einen auch wenig später wieder hungern. Fettreiche Speisen halten sich dagegen am längsten im Magen auf. Als Abendessen eignen sie sich aus diesem Grund nicht so sehr. Im Bett liegend kann das leckere Gericht dann schnell zu einem belastenden Brocken werden. Wichtigste Aufgaben des Magens: Vermischen, Speichern und portionsweise Abgabe des Speisebreis Einleitung der Protein-Verdauung Allgemeine Information: Der Darm bildet vom Magenausgang an bis zum After einen etwa 6 langen Nahrungstransportschlauch. Er beginnt mit dem Zwölffingerdarm und endet mit dem Enddarm. Seine enorme Länge ist wichtig, da der Körper der Nahrung auf ihrem Weg nach draussen noch einiges an lebensnotwendigen Nährstoffen entziehen muss. Der Nahrungsbrei wird auf seinem Weg aus dem Körper an verschiedenen Stationen des Verdauungskanals in immer kleinere Einzelsubstanzen zerlegt. So wird die Aufnahme in die Blutbahn gewährleistet. Diese Prozesse brauchen Zeit, die durch die Länge des Verdauungskanals gegeben wird. Der Zwölffingerdarm Der Zwölffingerdarm ist der obere, etwa 25 cm lange Abschnitt des Dünndarms. An sein Ende schliesst sich der zweite Teil des Dünndarms. Die beiden Abschnitte gehen ohne scharfe Abgrenzung fliessend ineinander über. Der Zwölffingerdarm steht in Kontakt mit der Gallenblase und der Bauchspeicheldrüse. Beide geben ihren Saft an den Zwölffingerdarm ab. Die Leber produziert eine grünliche Flüssigkeit, den Gallensaft. Bei Kontakt des Nahrungsbreis mit der Darmschleimhaut, wird der Gallensaft in den Zwölffingerdarm abgegeben. Der Gallensaft Ausserdem enthält der Gallensaft Enzyme (info: Enzyme kommen im ganzen Körper vor. sie regulieren chemische Prozesse, ohne sich dabei selbst zu verändern), die die Fette in kleine Fetttröpfchen zerlegt/ spaltet. Die Bauchspeicheldrüse produziert 1,5 Liter. Im Saft der Bauchspeicheldrüse sind Enzyme, die Proteine, Kohlenhydrate und die kleinen Fetttröpfchen zu zerkleinern und zu verdauen: Die Endprodukte unserer Verdauung sind Einfachzucker, Aminosäuren und Glycerin und Fettsäuren. Nur diese kleinsten Teilchen der Nährstoffe können ins Blut aufgenommen werden und so an ihren Zielort im Körper gelangen. Natürlich laufen diese Verdauungsprozesse nicht nur im kurzen Zwölffingerdarm ab, sondern auch im grossen Teil des Dünndarms. Die Endprodukte unserer Verdauung sind Einfachzucker, Aminosäuren und Fettsäuren. Ausserdem: Die vielen Drüsen und Drüsenzellen der Dünndarmschleimhaut bilden täglich etwa 3 Verdauungssaft. Die darin enthaltenen Enzyme unterstützen die Bauchspeichelenzyme bei der Spaltung von Proteinen, Kohlenhydraten und Fetten. Allgemeine Information: Der Darm bildet vom Magenausgang an bis zum After einen etwa 6 langen Nahrungstransportschlauch. Er beginnt mit dem Zwölffingerdarm und endet mit dem Enddarm. Seine enorme Länge ist wichtig, da der Körper der Nahrung auf ihrem Weg nach draussen noch einiges an lebensnotwendigen Nährstoffen entziehen muss. Der Nahrungsbrei wird auf seinem Weg aus dem Körper an verschiedenen Stationen des Verdauungskanals in immer kleinere Einzelsubstanzen zerlegt. So wird die Aufnahme in die Blutbahn gewährleistet. Diese Prozesse brauchen Zeit, die durch die Länge des Verdauungskanals gegeben wird. Dünndarm Wäre unser Dünndarm nur ein einfaches Rohr, so könnte nur ein kleiner Teil der mit der Nahrung zugeführten Nährstoffe aufgeschlossen und aufgenommen werden, da die zur Verfügung stehende Schleimhautfläche nicht gross genug wäre. Durch die Faltenbildung und den Besatz der Falten mit kleinen Darmotten von 0,5-1,5mm Länge kann die innere Oberfläche des Dünndarms um ein Vielfaches vergrössert werden: Sie entspricht bei einem Erwachsenen insgesamt etwa der Größe eines Tennisplatzes. Längs- und Ringmuskeln bewegen den Darm. Damit der Speisebrei auch gut mit den Verdauungssäften durchmischt wird und die Nährstoffe aufgenommen werden können, verfügt der gesamte Dünndarm über verschiedene Beweglichkeitsmechanismen. Rhythmisches Zusammenziehen der Ringmuskulatur und pendelartige Bewegungen durch die Längsmuskulatur bewirken eine sorgfältige Vermischung. Durch die Bewegung der Darmzotten wird ein intensiver Kontakt zwischen Schleimhaut und Nahrungsbrei ermöglicht. Dies verbessert die Aufnahme der Nährstoffe ins Blut. Währenddessen muss der Speisebrei aber auch weiter in Richtung Dickdarm bewegt werden. Bis der Speisebrei den Dünndarm endgültig passiert hat, können bis zu 10 Stunden vergehen. Durch die Dünndarmwand werden die zerlegten und verdauten Nährstoffe ins Blut aufgenommen Resorption. (Unter der Resorption versteht man die Aufnahme von Nährstoffen durch die Darmwand. Übrig bleiben jetzt nur noch nichtverdaulichen Nahrungsbestandteile und Wasser. Der Dickdarm Der Dickdarm und der sich anschließende Mastdarm sind der letzte Abschnitt des Verdauungskanals. Zusammen sind sie etwa 1,5 Meter lang. Der Wandaufbau des Dickdarms entspricht dem des übrigen Verdauungstraktes. Die Schleimhaut des Dickdarms weist aber im Vergleich zur Dünndarmschleimhaut eine Besonderheit auf. Darmzotten, die für die Aufnahme der Nährstoffe im Dünndarm unerlässlich waren, finden sich hier nicht mehr. Das ist auch nicht nötig, da die Verdauung und Aufnahme von Nährstoffen beendet ist. Jetzt besteht die Aufgabe des Dickdarms darin, dem Darminhalt Wasser zu entziehen, damit dieses dem Körper nicht verloren geht. Der Körper würde sonst sehr schnell austrocknen. Die Aufnahme von Wasser aus dem Darminhalt hat zur Folge, dass der Stuhl auf seinem Weg durch den Dickdarm immer fester wird. Durch den Entzug von Wasser verkleinert sich das Volumen des Darminhaltes auf etwa 200 ml pro Tag. Der Stuhl wird dann solange im Mastdarm gespeichert, bis ein ausreichendes Volumen erreicht ist, das die Entleerung auslöst. Die Dickdarmbakterien Der Dickdarm ist von vielen Darmbakterien besiedelt. Sie sind in der Lage einen Teil der unverdaulichen Nahrungsreste (Zellulose) in Glucose zu zerlegen und vergären restliche Kohlenhydrate. Übrig gebliebene Proteine werden durch Fäulnisprozesse abgebaut. Durch die Aktivität der Bakterien entstehen Gase, die Du unschwer beim Entströmen aus dem Körper mit der Nase und öfters auch mit den Ohren feststellen kannst. Die Bakterien produzieren auch Vitamin und leisten damit einen Beitrag zu unserer Gesunderhaltung. Die wenigen Nährstoffe, die durch die Tätigkeit der Darmbakterien anfallen, können problemlos resorbiert werden. Zusatzaufgaben, Puffer: Literatur (Schulbücher werden bereit gelegt) 1. Was ist Magenknurren? 2. Warum bekommt man Blähungen? 3. Was ist ein Magengeschwür? 4. Vergleicht Länge des Darmes von verschiedenen Tieren Bin ich schon Experte? Gruppe 1 Jemand behauptet, dass man während des Schluckens atmen kann. Du weisst, was beim Schluckvorgang abläuft. Kläre die Person über den wahren Sachverhalt in zwei Sätzen auf. Stimmt das Stichwort: Gut gekaut ist halb verdaut? und warum? Die aufgenommene Nahrung wird mittels peristaltischer Bewegungen durch unser Verdauungssystem transportiert. Wozu braucht es diese Muskeltätigkeit? Würde die Schwerkraft nicht genügen, um den Speisebrei nach unten zu transportieren? Gruppe 2 Beim Mittagessen isst Deine Tischnachbarin ganz hastig. Du erklärst ihr, warum es sich lohnen würde, langsam zu essen. Schreibe zwei Gründe auf, die für das langsame Essen sprechen. Die Säure des Magensaftes erfüllt bei der Verdauung verschiedene Aufgaben. nenne diese. Gruppe 3 Einem Patienten muss die Gallenblase entfernt werden. Auch ohne Gallenblase kann er sehr gut leben. Worauf muss er jedoch in Zukunft achten? Viele Waschmittel enthalten heutzutage Enzyme. So heisst es beispielsweise als Werbeslogan: Enzyme lösen problemlos Eiweissflecken auf! Herr Hauser hat soeben ein solches Waschmittel gekauft. Er hat keine Ahnung, was Enzyme sind und was genau sie mit den Eiweissflecken machen. Könntest Du Herrn Hauser aufklären? Gruppe 4 Warum hat es im Dünndarm 4 Millionen Zotten? Was ist Resorption? Sind Darmbakterien schädlich? Bilder für die Gruppen