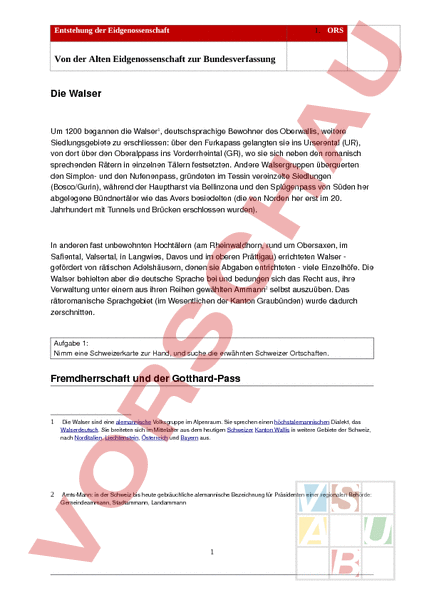Arbeitsblatt: Von der Alten Eidgenossenschaft zur Bundesverfassung
Material-Details
Ein Dossier, welches die Geschichte der Eidgenossenschaft bis zur Bundesverfassung aufzeigt. Darin enthalten sind Arbeitsaufträge und -blätter. Kann selbständig von den Schülern oder im Klassenverband erarbeitet werden. Vorsicht: Die Texte sind teils anspruchsvoll!
Die Lösungen sind nicht überall angegeben, da diese von den Schülern vorgegeben werden sollen - in diesem Fall existiert eine Lösungsfolie zum Auflegen und ergänzen.
Geschichte
Schweizer Geschichte
7. Schuljahr
30 Seiten
Statistik
51589
2272
134
02.01.2010
Autor/in
Nicole Stadelmann
6020 Emmenbrücke
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Entstehung der Eidgenossenschaft 1. ORS Von der Alten Eidgenossenschaft zur Bundesverfassung Die Walser Um 1200 begannen die Walser1, deutschsprachige Bewohner des Oberwallis, weitere Siedlungsgebiete zu erschliessen: über den Furkapass gelangten sie ins Urserental (UR), von dort über den Oberalppass ins Vorderrheintal (GR), wo sie sich neben den romanisch sprechenden Rätern in einzelnen Tälern festsetzten. Andere Walsergruppen überquerten den Simplon und den Nufenenpass, gründeten im Tessin vereinzelte Siedlungen (Bosco/Gurin), während der Hauptharst via Bellinzona und den Splügenpass von Süden her abgelegene Bündnertäler wie das Avers besiedelten (die von Norden her erst im 20. Jahrhundert mit Tunnels und Brücken erschlossen wurden). In anderen fast unbewohnten Hochtälern (am Rheinwaldhorn, rund um Obersaxen, im Safiental, Valsertal, in Langwies, Davos und im oberen Prättigau) errichteten Walser gefördert von rätischen Adelshäusern, denen sie Abgaben entrichteten viele Einzelhöfe. Die Walser behielten aber die deutsche Sprache bei und bedungen sich das Recht aus, ihre Verwaltung unter einem aus ihren Reihen gewählten Ammann2 selbst auszuüben. Das rätoromanische Sprachgebiet (im Wesentlichen der Kanton Graubünden) wurde dadurch zerschnitten. Aufgabe 1: Nimm eine Schweizerkarte zur Hand, und suche die erwähnten Schweizer Ortschaften. Fremdherrschaft und der GotthardPass 1 Die Walser sind eine alemannische Volksgruppe im Alpenraum. Sie sprechen einen höchstalemannischen Dialekt, das Walserdeutsch. Sie breiteten sich im Mittelalter aus dem heutigen Schweizer Kanton Wallis in weitere Gebiete der Schweiz, nach Norditalien, Liechtenstein, Österreich und Bayern aus. 2 AmtsMann: in der Schweiz bis heute gebräuchliche alemannische Bezeichnung für Präsidenten einer regionalen Behörde: Gemeindeammann, Stadtammann, Landammann 1 Entstehung der Eidgenossenschaft 1. ORS Von der Alten Eidgenossenschaft zur Bundesverfassung Der höchste Herr im Deutschen Reich, dazu gehörte auch das Gebiet am Gotthard, war der deutsche Kaiser. Ihm gehörte alles Land und er erlaubte den Bauern, Wälder zu roden, das heisst die Bäume zu fällen, damit nachher der Pflug den Waldboden zu Ackerland umpflügen konnte. Die Urner gehörten also unmittelbar dem Kaiser und dem Deutschen Reich. Sie waren reichsfrei. Jedes Jahr schickte der Kaiser einen Reichsvogt ins Urnerland, damit dieser die Steuern einzog und Menschen, die Schweres begangen hatten, bestrafte. Dieser Vogt durfte nicht in Uri wohnen. Hatte er als Richter und Steuereintreiber seine Pflicht getan, musste er das Land verlassen. Vor der Eröffnung des Saumpfades über den Gotthard, hatten die Bauern in den Tälern um den Vierwaldstättersee ein freies Leben geführt, weit ab von der Politik der grossen Reiche. Nun war es mit der Ruhe vorbei. Rasch hatte sich herumgesprochen, dass es einen neuen, kürzeren und schnelleren Weg vom Norden in den Süden gab. Von Jahr zu Jahr nahm die Zahl der Reisenden zu, die über den Gotthardpass zogen. Den hier ansässigen Menschen, die sich ihr Leben bisher allein als Bergbauern verdient hatten, eröffneten sich plötzlich ganz neue Möglichkeiten. Die Wegzölle, die damals für alle Reisenden und alle Handelsgüter erhoben wurden, brachten reiche Einnahmen. Wer über den Pass wollte, musste berggewohnte Saumtiere für sein Gepäck oder seine Waren mieten, und wer es sich leisten konnte, warb sogar Träger an, die ihn in einer Sänfte über den Gotthard brachten. Aufgabe 2 (Arbeitsblatt): Ergänze mit Hilfe der Schweizer Karte die fehlenden Ortschaften der Gotthardroute. Der neue Passübergang mit den Zolleinnahmen und der direkte Zugang nach Italien weckte vor allem das Interesse der Habsburger. Im Jahre 1273 wurde mit Rudolf I. ein Habsburger zum deutschen König gewählt. Habsburgerische Vögte verwalteten nun das Land und sogen es mit ihren übersetzten Steuerforderungen aus. Als Rudolf I. 1291 starb, nutzten seine geplagten Untertanen in den Waldstätten die Gelegenheit zum Aufstand. Zu Beginn des Monats August versammelten sich Männer aus Uri, Schwyz und Unterwalden (Ob und Nidwalden) auf dem Rütli und schlossen einen ewigen Bund: Es war die Gründung der Schweiz. 2 Entstehung der Eidgenossenschaft 1. ORS Von der Alten Eidgenossenschaft zur Bundesverfassung Schon bald mussten die Eidgenossen ihre neue Freiheit mit Waffengewalt verteidigen. Ein Habsburgerheer unter der Führung von Leopold I. wurde 1315 in der Schlacht von Morgarten von den Eidgenossen in einen Hinterhalt gelockt und vernichtend geschlagen. 1332 schloss sich die Stadt Luzern dem Bund an. Jetzt lag der ganze nördliche Zugang zum Gotthard in der Hand des neugegründeten Staates. Aufgabe 3 (Arbeitsblatt): Schreibe in Form eines Zeitungsartikels oder einer Radiosendung eine kleine Zusammenfassung der Morgartenschlacht. Das gemeinsame Interesse am Pass förderte also wesentlich die Gründung der Eidgenossenschaft und den entschlossenen Zusammenhalt der ersten Kantone. Reichsfreiheit für Uri und Schwyz Bis zu ihrem Aussterben 1218 waren die süddeutschen Herzöge von Zähringen von den deutschen Königen mit der Verwaltung weiter Teile der heutigen Schweiz beauftragt, danach wurden die Vogteirechte über die Zentralschweiz zunächst den aufstrebenden Habsburgern (Stammsitz: Habsburg bei Brugg AG) verpfändet. Die Zähringer hatten auch viele Städte gegründet. Nach dem Aussterben des Geschlechtes wurden Zürich, Bern, Solothurn und Schaffhausen reichsfreie Städte. Die zähringischen Stammlande erbten die Grafen von Kyburg (bei Winterthur), die damit zur mächtigsten Adelsfamilie im Gebiet der Nordschweiz wurden. Uri hatte durch die Eröffnung der Gotthardroute massiv an Bedeutung für das Deutsche Reich mit seinen norditalienischen Teilen gewonnen. So befürchteten die Urner ebenso wie der deutsche König, dass die ständig um die Vermehrung ihres Besitzes bestrebten Habsburger Uri zu einem Untertanenland machen würden. Es lag deshalb im beiderseitigen Interesse, dass König Friedrich II 1231 die Urner aus der Verpfändung an die Habsburger loskaufte und ihnen in einem Freiheitsbrief die Reichsunmittelbarkeit (direkte Unterstellung unter den König unter Umgehung der Grafen) zusicherte. 3 Entstehung der Eidgenossenschaft 1. ORS Von der Alten Eidgenossenschaft zur Bundesverfassung 1240 brach ein Konflikt zwischen dem Papst und König Friedrich II aus, in dem Graf Rudolf III von Habsburg sich auf die Seite des Papstes stellte. Friedrich gewährte den Schwyzern die Reichsunmittelbarkeit und erhielt daraufhin mitten im Winter über den Gotthardpass militärische Unterstützung durch die Schwyzer. Schon 1264 starb auch der letzte männliche Kyburger. Graf Rudolf IV. von Habsburg und Graf Peter II. von Savoyen (Gebiet südlich des Genfersees im heutigen Frankreich, kontrollierte damals auch die heutigen Kantone Genf und Waadt) stritten sich um das Erbe. Graf Rudolf IV. von Habsburg trat 1264 das Erbe seines kinderlosen Onkels Graf Hartmann IV. von Kyburg an (in etwa Kantone ZH, TG sowie Gasterland am oberen Zürichsee). Die Grundherrschaft über die Stadt Luzern wurde im April 1291 vom stark verschuldeten Kloster Murbach an König Rudolf von Habsburg verkauft. Die Grafen von Habsburg strebten nach dem deutschen Königsthron, dazu mussten sie jedoch eine starke Hausmacht hinter sich haben. 1257 hatten sich die deutschen Kurfürsten nicht auf einen König einigen können. Nach dem Tod des einen Königs Richard von Cornwall 1272, blieb sein Gegenkönig Alfons X. machtlos. So entschie den sich die Kurfürsten 1273, einen neuen König zu wählen. Rudolf v. Habsburg nutzte dies und forderte eine Neuordnung der Lehen, die seit 1245 ohne Zustimmung der Kurfürsten vergeben worden waren. Dies betraf vor allem seinen Rivalen Ottokar II. von Böhmen mit den Herzogtümern Steiermark und Österreich. Die Rivalität wurde in der Schlacht auf dem Marchfeld (Niederösterreich) entschieden, Rudolf wurde Herzog von Österreich und deutscher König. Bundesbrief und Rütlischwur Als Geburtstermin der Schweiz gilt allgemein der 1. August 1291 (Todesjahr des ersten deutschen Königs aus dem Haus der Habsburger, Rudolf von Habsburg). Die Alte Eidgenossenschaft entstand als loses Bündnis von drei Talschaften am Vierwaldstättersee in der Zentralschweiz: Uri (am oberen, südlichen SeeEnde gelegen), Schwyz (am nordöstlichen Seeufer) und Unterwalden (am westlichen Seeufer). Man lehnte sich gegen die Vögte der Grafen von Habsburg (Stammsitz: Habsburg im Kanton Aargau) auf. Ziel war nicht 4 Entstehung der Eidgenossenschaft 1. ORS Von der Alten Eidgenossenschaft zur Bundesverfassung eine Loslösung vom Deutschen Reich, sondern die Rückgewinnung bzw. Verlängerung alter Autonomierechte. Aufgabe 4: (Arbeitsblatt): Ergänze den Lückentext mit den vorgegebenen Wörtern. Der Bundesbrief von 1291 Der Bundesbrief von 1291 ist ein lateinisch abgefasstes, kurzes Dokument, das von Form und Inhalt her eine grosse Ähnlichkeit mit vielen anderen Dokumenten aus dem spätmittelalterlichen Europa aufweist. Ursprünglich sollte damit wohl ein so genannter Landfriede besiegelt werden. Der Zweck des Bundesbriefs dürfte einerseits die Wahrung einer minimalen Rechtsordnung und Rechtssicherheit in Zeiten schwacher Zentralgewalt gewesen sein, andererseits dürften lokale Führungsschichten nicht abgeneigt gewesen sein, eben diese Situation auszunutzen, um die eigene Stellung zu festigen (gegen die im Bundesbrief erwähnten fremden Richter). Die Datierung des Bundesbriefes auf das Jahr 1291 hält auch neusten Untersuchungen mit der C14Methode stand: Das verwendete Pergament stammt tatsächlich aus dem späten 13. Jahrhundert! Der Bundesbrief von 1291 lag lange vergessen in Schwyz im alten Archivturm, und auch nach seiner Wiederentdeckung im 18. Jahrhundert wurde ihm zunächst keine allzu grosse Beachtung geschenkt. Erst die Bildung von Nationalstaaten rund um die Schweiz herum um 1860 1880 und der Zeitgeist des wissenschaftsgläubigen 19. Jahrhundert (mit seiner Vorliebe für das mittels Experimenten oder wenigstens alten Urkunden Beweisbare) holte den Bundesbrief aus seinem Dornröschenschlaf. Im Zuge der Geistigen Landesverteidigung vor dem Zweiten Weltkrieg errichtete man in Schwyz ein eigenes Bundesbriefmuseum. Der Bundesbrief wurde damals in einer alleinstehenden Vitrine in einem kirchenähnlichen Raum wie eine Heilige Schrift ausgestellt. Dies und viele weitere Indizien deuten darauf hin, dass es sich bei der Geistigen Landesverteidigung um eine so genannte Zivilreligion gehandelt haben dürfte. 5 Entstehung der Eidgenossenschaft 1. ORS Von der Alten Eidgenossenschaft zur Bundesverfassung Der Datumsstreit: 1291 oder 1307 Erst als um 1890 in Bern die Idee aufkam, das 700JahrJubiläum der Stadt Bern und das 600JahrJubiläum des Bundesbriefs gemeinsam zu feiern, brach eine grosse Diskussion über den echten Ursprung der Alten Eidgenossenschaft zwischen den Zentralschweizer Urkantonen und den städtischen Industriezentren aus. Im Bewusstsein der breiten Bevölkerung durchgesetzt hat sich letztlich diejenige Variante, die wohl am wenigsten mit der historischen Wahrheit übereinstimmt: Bundesbrief, Rütlischwur und die Taten von Wilhelm Tell wurden in einen unmittelbaren und direkten Zusammenhang gestellt und dafür das Datum des 1. August 1291 festgelegt. Wenn allerdings an der alten Überlieferung tatsächlich noch mehr dran sein sollte, als phantasievolle Ausschmückungen, dann müsste wenn schon auch das dazu überlieferte Datum 1307 korrekter sein, als die Einheitsdatierung auf 1291. Die Zusammenlegung entspringt höchst wahrscheinlich dem Bedürfnis der Patrioten des 19. Jahrhunderts nach einer griffigen, klaren Ursprungsgeschichte für einen Staat, der inmitten von Nationalstaaten (die grosse politische Mode im Europa des ausgehenden 19. Jahrhunderts!) keine Einheit der Sprache, Kultur, Herkunft usw. vorzuweisen hatte, um seine Existenz zu rechtfertigen. So folgte man also nach längeren Auseinandersetzungen dem Trend der Zeit zur oberflächlichen Wissenschaftsgläubigkeit und gab der Jahreszahl 1291 des schriftlichen Dokumentes zu ihrem 600. Jahrestag den Vorrang, nicht ohne also gleich völlig unwissenschaftlich Bun desbrief und Rütlischwur mitsamt der TellLegende zu einem in sich geschlossenen Komplex zu verweben. Und wie lebten die Menschen in den Waldstätten? Die Gesellschaft im Mittelalter war in verschiedene Stände (Schichten) unterteilt. Diese waren wie in einer Pyramide aufgebaut. An der Spitze stand der König. Er hatte die größte Macht im Staat. Unter dem König stand der Adel, zu welchem die wohlhabenden Leute gehörten. Darauf folgte die Geistlichkeit. Zu ihr zählten Priester, Mönche und Pfarrer. Der Adel und der Klerus ( die Geistlichkeit die Leute aus der 6 Entstehung der Eidgenossenschaft 1. ORS Von der Alten Eidgenossenschaft zur Bundesverfassung Kirche) machten etwa 10% der ganzen Bevölkerung aus. Das „breite Volk hingegen machte etwa 90% der ganzen Bevölkerung aus. Zu diesem gehörten die Städtebevölkerung, welche besonders von einem Handwerk, wie Schreiner oder Schmied, lebte, sowie auch die Händler und die Bauern. Die Bauern hatten jedoch einen tieferen Stand als die Handwerker und stehen darum an unterster Stelle in der Pyramide. Im Mittelalter gab es jedoch auch noch Menschen, die keinem der genannten Stände angehörten. Mit diesen Menschen wollte wegen ihres Berufes niemand in Berührung kommen. Zu diesen gehörten beispielsweise die Henker, sowie die Schornsteinfeger. Aufgabe 5: Stelle die Angaben aus dem oberen Text grafisch (in einer Pyramide) dar und versehe sie mit den entsprechenden Berufen. Das Leben des einfachen Volkes Der Großteil der Menschen im Mittelalter waren arme Leute und übten meistens den Bauernberuf aus. Sie lebten besonders von der Viehhaltung und der Milchwirtschaft und wohnten auf dem Land in Hütten, in denen oft ganze Familien, die Tiere und das Saatgut in einem Raum untergebracht wurden. Das Land gehörte selten den Bauern selbst, sondern einem reichen Herrn. Dieser verlangte vom Bauern Abgaben in Form von Geld oder Nahrungsmittel, weil er ihm das Land auslieh. Der Speiseplan einer Familie war oft eintönig. Ihre Hauptmahlzeit bestand aus Brot und Getreidebrei, sowie Milchprodukten, es gab kaum Fleisch, wenig Gemüse, Pilze oder Beerenobst. Der Glaube an Gott und die Kirche war für alle Menschen, egal welcher Herkunft, sehr wichtig. Sie glaubten fest daran, dass Gott die Ständegesellschaft (die Einteilung der Gesellschaft in arm und reich) nach seinem Willen geschaffen hatte und die Geistlichen, z.B. die Pfarrer, wussten, was Gott für richtig hielt und was nicht. Schließlich waren die Geistlichen zunächst auch die einzigen, die lesen konnten. 7 Entstehung der Eidgenossenschaft 1. ORS Von der Alten Eidgenossenschaft zur Bundesverfassung Aufgabe 6: Stelle die erlangten Informationen in einer Zeichnung dar, die alle Informationen enthält. Wenn du nicht ganz so gut zeichnen kannst, dann versehe gewisse Bilder mit schriftlichen Anmerkungen, zum Beispiel: Kirche: gottesgläubige Menschen. Die politische Situation Das Gebiet der Innerschweiz gehörte im Mittelalter zum deutschen Reich. Der Inhaber dieses deutschen Reiches war jeweils ein König. Der König Rudolf von Habsburg spielt für die Geschichte der Schweiz eine bedeutende Rolle. Die Könige konnten ihr Land jeweils selber verwalten oder an Adelige (wohlhabende Leute) weitergeben als Lehen. Lehen sind eine Art von Ausleihe eines Landteiles. Die Adligen herrschten dann in diesem Gebiet in Vertretung des Königs. Landteile, die der König selber verwaltete und nicht an Adelige auslieh, nannte man reichsfrei. Der König und das Volk standen immer in einem gewissen Abhängigkeitsverhältnis. So war der König auf die Steuern vom Volk angewiesen und das Volk war auf den Schutz des Königs angewiesen, denn oft wollten fremde Könige durch Gewalt weitere Gebiete erobern. Dies wollte das Volk durch den Schutz „ihres Königs verhindern. Die Schlachten der Alten Eidgenossen gegen die Habsburger Nachdem die Habsburger zur Kaiserwürde aufgestiegen waren scheint es nur logisch, dass sie sich mit dem Freiheitswillen von ein paar tausend aufmüpfigen Bergbauern (Eidgenossen) in ihren Stammlanden nicht abfinden wollten und versuchten, ihre Machtansprüche mit Waffengewalt durchzusetzen. Während Jahrzehnten erlitten sie dabei aber eine Niederlage nach der anderen und die Eidgenossen wurden immer selbstbewusster: 8 Entstehung der Eidgenossenschaft 1. ORS Von der Alten Eidgenossenschaft zur Bundesverfassung • 1315 Schlacht am Morgarten (bei Sattel SZ): Die Eidgenossen überfielen das habsburgisch österreichische Ritterheer aus dem Hinterhalt. Gemäss einer unbestätigten Legende stürzten sie Baumstämme auf die zwischen Berg und See eingezwängte Reiterkolonne. Vor dem Zweiten Weltkrieg wurde dies in einer Filmwochenschau inszeniert, um die schweizerische Abwehrbereitschaft gegen Hitlerdeutschland zu fördern und gegen aussen zu demonstrieren (Geistige Landesverteidigung): Ein Geschichtsmythos im Dienste der Politik. • 1339 Schlacht bei Laupen BE (Bern und verbündete Waldstätte gegen Adlige aus der Westschweiz) • • 1386 Schlacht bei Sempach LU Bereits 1387 wurde zum Gedenken eine Schlachtkapelle errichtet, in der jährlich eine Schlachtjahrzeit abgehalten wird. • 1388 Schlacht bei Näfels GL Im folgenden Jahr beschloss die Landsgemeinde alljährlich die Näfelser Fahrt abzuhalten, eine Totengedenkfeier zu Ehren der Gefallenen. • 1403 Schlacht bei Vögelinsegg und 1405 Schlacht bei Stoss AR: Freiheitskampf der Appenzeller gegen das Kloster St. Gallen und mit ihm verbündete süddeutsche Städte und Herzog Friedrich IV. von Habsburg Österreich zur Wiedererlangung der 1345 an das Kloster verlorenen Reichsfreiheit Die Erweiterung der Eidgenossenschaft Beitritt von Luzern, Zürich, Zug, Glarus und Bern zur Alten Eidgenossenschaft Lange blieben die UrEidgenossen unter sich, dann traten Luzern (1332), Zürich (1351), Glarus und Zug (1352), sowie Bern (1353) dem Bund bei. 1411 wurde ein weniger weit gehendes Bündnis mit Appenzell, 1412 eines mit der Stadt St. Gallen (beide gegen das 9 Entstehung der Eidgenossenschaft 1. ORS Von der Alten Eidgenossenschaft zur Bundesverfassung Kloster St. Gallen) abgeschlossen. Uri, Unterwalden und Luzern schlossen 1403 mit dem Bischof von Sion (VS) und den Oberwallisern Burg und Landrecht. Als die Freiherren von Raron (VS) 1414 ihre Macht über das Wallis ausdehnen und die alten Rechte der Bauern einschränken wollten, kam es zum Aufstand der Oberwalliser. Da die Freiherren von Raron das Bürgerrecht der Stadt Bern erworben hatten, entstanden wegen den gegensätzlichen Bündnisverpflichtungen ernste Spannungen zwischen Bern und den Urschweizern. Die Eroberung des Aargaus Weil Herzog Friedrich IV. von Habsburg am Konzil von Konstanz den Gegenpapst unterstützte, ermunterte der deutsche König Sigismund die Eidgenossen, die Stammlande der Habsburger (Aargau) zu erobern, was sie 1415 auch taten. Im gleichen Jahr wurde Luzern freie Reichsstadt, d.h. sie war direkt dem König unterstellt. Gemeinden im nördlichen, an den Aargau grenzenden Kantonsteil kamen 1415 unter Luzerner Herrschaft. Die Habsburger, die immer wieder zeitenweise den deutschen Kaiser stellten, verloren ihren Stammsitz und mussten sich auf ihre Besitzungen in Österreich zurückziehen. Der alte Zürichkrieg Der Tod des kinderlosen letzten Grafen von Toggenburg 1436 löste Streitigkeiten zwischen Schwyz, Glarus und Zürich aus, die Ansprüche auf die Erbschaft erhoben. 1440 kam es zum Alten Zürichkrieg, in den der deutsche ebenso wie der französische König eingriff. Der äusserst grausam geführte Krieg endete 1446 mit der Niederlage Zürichs, Schwyz und Glarus konnten ihr Gebiet am oberen Zürichsee erweitern. Die Eroberung des Thurgaus 1460 nutzten die Eidgenossen den von Papst Pius II. über Herzog Sigismund von Habsburg Österreich verhängten Kirchenbann aus, um den Thurgau und das Sarganserland zu erobern. Das St. Galler Rheintal gelangte durch Pfandschaft an Appenzell, die Stadt Winterthur wurde von Zürich gekauft. Die Burgunderkriege 1474 – 1478 Auf Anstiften Berns und des französischen Königs traten die Eidgenossen 1474 in den Krieg mit dem Burgunderherzog Karl dem Kühnen, der in drei Schlachten (Grandson, Murten und Nancy) vernichtend geschlagen wurde. Um Bern nicht zu mächtig werden zu lassen, überliess man 1478 Burgund aber gegen 150�00 Gulden Herzog Maximilian von Habsburg 10 Entstehung der Eidgenossenschaft 1. ORS Von der Alten Eidgenossenschaft zur Bundesverfassung Österreich, dem Erben Karls. Bern setzte sich in der Waadt und im Umland Genfs fest, konnte aber die Vorherrschaft über die Stadt Genf nicht erringen. Die neu erworbenen Gebiete wurden wie schon der Aargau nicht etwa befreit, sondern von den Eidgenossen als Untertanengebiet behandelt. Aufnahme von Fribourg und Solothurn nach inneren Spannungen 1477 traten Spannungen zwischen den Landorten und den Städten der Eidgenossenschaft zutage: die Landorte Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug und Glarus schlossen mit dem Bischof von Konstanz ein Landrecht, Bern, Luzern und Zürich ein Burgrecht mit Solothurn und Fribourg. Die Aufnahme von Fribourg und Solothurn in die Eidgenossenschaft wurde zur Zerreisprobe: die Landorte fürchteten eine Übermacht der Städte und sperrten sich gegen die Erweiterung. Erst ein Vermittlungsvorschlag des Obwaldner Einsiedlers und früheren Ratsherrn, Richters und eidgenössischen Gesandten Bruder Klaus (in der Schweiz schon lange als Nationalheiliger verehrt, aber erst 1947 von Papst Pius XII. offiziell heiliggesprochen) führte 1481 zur Einigung im Stanser Verkommnis. Verhandlungen über die Aufnahme der Stadt Konstanz (D) am Bodensee scheiterten, weil Zürich Konkurrenz fürchtete. Dagegen kam es zu einem Bündnis mit dem Gotteshausbund (Engadin und Stadt Chur). Aufgabe 7: Lies den Text in Ruhe durch und schreibe anschliessend eine kurze aber prägnante Bildbeschreibung, die alle wesentlichen Punkte der gezeigten Ereignisse enthält. Der Schwabenkrieg 1499 Der Schwabenkrieg von 1499 entzündete sich nicht etwa an grundlegenden Problemen mit dem Schwäbischen Bund, einer Vereinigung süddeutscher Städte, sondern an der Politik des deutschen Königs Maximilian I. aus dem Hause Habsburg, der die Teile des Deutschen Reiches wieder enger an sich binden wollte, ein neues Reichskammergericht und eine neue Wehrsteuer einführte. Den berühmten Funken am Pulverfass spielte die Besetzung des Klosters Müstair GR durch die Tiroler (A). In mehreren Schlachten im Bündnerland und entlang der Rheingrenze wurden die königlichen Truppen geschlagen. Maximilian I. musste im Frieden von Basel den Eidgenossenschaften die Gerichtsbarkeit über den Thurgau sowie 11 Ents tehung de Eidgenossenschaft 1. ORS Von der Alten Eidgenossenschaft zur Bundesverfassung die Unverbindlichkeit des Reichskammergerichts und der Reichssteuern zugestehen. Damit war die Schweiz faktisch vom Deutschen Reich unabhängig geworden. In der Folge traten 1501 Basel und Schaffhausen und schliesslich 1513 Appenzell als vollwertige Mitglieder der Eidgenossenschaft bei, während die Stadt St. Gallen sich weiterhin mit dem Status eines zugewandten Ortes begnügen musste. Ausdehnung nach Süden, Mailänderkriege Das Interesse der Zentralschweiz richtete sich mehr gegen Süden. Bereits 1403 hatten die Urner eine Schwäche Mailands ausgenutzt und die Leventina, den oberen Teil des Kantons Tessin käuflich erworben, 1410 1417 weitere Täler erobert und schliesslich 1419 mit Unterwalden Bellinzona gekauft. Mailand eroberte 1422 Bellinzona und die untere Leventina, mehrere Rückeroberungsversuche der Urner schlugen fehl. Aufgabe 8: Erstelle eine Übersicht der Schweizer Kantone mit Wappen, Kantonsnamen und Beitrittsjahr zur Eidgenossenschaft. Schweizer Reisläufer in Söldnerheeren Die Burgunderkriege steigerten das Ansehen der Schweizer Soldaten, französische und italienische Könige und Fürsten versuchten sich deshalb durch Soldverträge mit den Urkantonen die Unterstützung eidgenössischer Söldner für ihre Kriegszüge zu sichern. Im Erbstreit des französischen Königs Louis XII. gegen den Herzog Ludovico Sforza von Mailand kamen gegen 30�00 Schweizer um. Im Jahr 1500 standen sich auf beiden Seiten Schweizer Söldner gegenüber. Um einen Bruderkampf zu vermeiden, schlossen diese über die Köpfe ihrer Auftraggeber hinweg ein Abkommen zum freien Abzug der Mailänder. Die Tagsatzung versuchte die Reisläuferei 1503 zu verbieten, allerdings ohne Erfolg. 1512 eroberten die Eidgenossen auf Drängen des Walliser Bischofs und Kardinals Matthäus Schiner Mailand und Pavia und behaupteten sich 1513 noch einmal in der Schlacht von Novara. Die Eidgenossenschaft stand auf dem Höhepunkt ihrer Macht. 12 Ents tehung de Eidgenossenschaft 1. ORS Von der Alten Eidgenossenschaft zur Bundesverfassung Marignano 1515: Das Ende der Grossmachtträume Der französische König zog nun mit einer grossen Übermacht nach Italien und bot gegen den Abzug der Eidgenossen eine Summe von 1 Millionen Kronen an. Die Eidgenossen waren uneins und ohne zentrale Entscheidungsstrukturen kam, was kommen musste: Berner, Solothurner und Fribourger zogen ab, die Zentralschweizer dagegen nahmen den Kampf auf und wurden 1515 bei Marignano vernichtend geschlagen. Zwar konnten die Eidgenossen das Tessin halten, doch markiert Marignano das Ende der eidgenössischen Ausdehnung. Der Weg zum modernen demokratischen Bundesstaat Die Regeneration um 1830 Unter dem Eindruck der französischen Julirevolution von 1830 setzte in der Schweiz eine liberale Erneuerungsbewegung ein, die Regeneration genannt wird. Gefordert wurden Volkssouveränität (grundlegende staatliche Macht beim Volk) und Rechtsgleichheit. Bis 1831 erneuerten 12 Kantone (SO, FR, LU, SG, ZH, TG, AG, VD, SH, BE) ihre Verfassungen und schafften die Aristokratie (Adelsherrschaft) bzw. das Patriziat (Herrschaft weniger alteingesessener Familien) ab. Aufgabe 9: Schreibe in einem einzigen kurzen Satz klipp und klar, was sich ab 1831 für die Eidgenossenschaft änderte. 13 Ents tehung de Eidgenossenschaft 1. ORS Von der Alten Eidgenossenschaft zur Bundesverfassung Die Aufhebung der Pressezensur in vielen Kantonen liess die Zahl der politischen Zeitungen und Zeitschriften zwischen 1830 und 1834 von 29 auf 54 ansteigen. Die Bildung wurde gefördert. Das Bildungsgesetz des Kantons Zürich von 1832 führte zur Neuorganisation der Volksschule und zur Gründung eines Lehrerseminars, einer Kantonsschule und der Universität Zürich (1833). Der Thurgau folgte mit dem Lehrerseminar in Kreuzlingen, Bern 1834 mit der Universität und 1838 mit dem Kollegi in Thun und dem Lehrerseminar in Münchenbuchsee. Ausgebildete Lehrer und Lehrerinnen lösten nun angelernte Bauern und Handwerker in der Volksschule ab. Dabei ging allerdings auch der Bezug zur Praxis teilweise verloren. Abspaltung des Kantons Baselland von BaselStadt In Basel weigerten sich die Städter, der Landbevölkerung mit der neuen Verfassung gleiche Rechte zuzugestehen. Daraufhin gaben sich die Baselbieter Gemeinden eine eigene Verfassung. Zwei Versuche der Stadt, ihre Vorrechte militärisch durchzusetzen, endeten mit Niederlagen. Die Tagsatzung anerkannte mit knappen Mehrheiten 1832 (vorläufig) und 1833 (definitiv) die Teilung von Basel in zwei Halbkantone. Auch in Schwyz kam es zur Abspaltung eines Kantons Ausserschwyz, die Tagsatzung zwang hier aber beide Parteien an den Verhandlungstisch und erreichte 1833 die Wiedervereinigung unter einer neuen Verfassung. Die Idee vom Bundesstaat (1833) Der Luzerner Paul Vital Ignaz Troxler brachte 1833 in seiner in Zürich gedruckten Schrift Die eine und wahre Eidgenossenschaft im Gegensatz zur Centralherrschaft und Kantonstümelei den Bundesstaat nach Vorbild der Vereinigten Staaten von Amerika (USA) in die Diskussion. Das seit der Bundesverfassung von 1848 geltende Staatsmodell wurde der Zentralschweiz also nicht einfach aufgezwungen, wie man nach isolierter Betrachtung des Sonderbundskrieges meinen möchte, sondern stammte aus dem traditionellen Vorort der Zentralschweiz selbst! Die Tagsatzung liess 1833 eine gemässigt liberale Bundesverfassung ausarbeiten. Sie sah eine Tagsatzung mit 44 Mitgliedern, einen fünfköpfigen Bundesrat und ein Bundesgericht vor. Die Kompetenzen (Machtbefugnisse) des Bundes wären wesentlich geringer als bei der 14 Ents tehung de Eidgenossenschaft 1. ORS Von der Alten Eidgenossenschaft zur Bundesverfassung späteren, im Kern noch heute gültigen Verfassung von 1848 gewesen. Insbesondere fehlte ein Nationalrat, der nach der Bevölkerungszahl zusammengesetzt den grossen Kantonen mehr Gewicht als den kleinen Kantonen der Zentralschweiz gibt. Luzern war als Sitz der Bundesverwaltung vorgesehen und hätte damit zusätzlichen Zentralschweizer Einfluss geltend machen können doch die Chance wurde verpasst. Der Entwurf ging den Konservativen zu weit, den Liberalen dagegen nicht weit genug. Für den Entwurf sprachen sich nur ZH, GL, FR, SH, SG, GR, GE, SO, BL und TG aus, die grossen reformierten Kantone BE und BS lehnten sie ebenso ab wie die Zentralschweiz, während die mehrheitlich katholischen Kantone FR und SO bei den Befürwortern zu finden waren. Dies zeigt, dass die Trennlinie zwischen Konservativen (die alte Ordnung Bewahrenden) und Liberalen (Verfechtern der bürgerlichen Freiheiten) bzw. Radikalen (darüber hinaus die Wurzeln der Gesellschaftsordnung grundsätzlich in Frage stellenden Liberalen) keineswegs eine konfessionelle (vom Glaubensbekenntnis abhängige) war. Vereinheitlichung von Mass und Gewicht In einigen Kantonen wurde 1838 das metrische Mass und Gewichtssystem (mit den Grundeineinheiten Meter und Gramm) eingeführt, viele Kantone wollten sich aber nicht anschliessen. Bis dahin gab es unter anderem allein in der Schweiz elf verschiedene Längen unter der Bezeichnung Fuss, 81 verschiedene Flüssigkeitsmasse und das Pfund entsprach in Aarau 483 g, in Bern 520 und in Schaffhausen 459 g. Dies erschwerte den Handel zwischen den Kantonen. In der Restauration waren die meisten Kantone auch wieder zu den alten Münzen zurückgekehrt. Eine schweizweite Lösung des Problems brachte allerdings erst das Gesetz über Mass und Gewicht von 1877, für das die 1874 revidierte Bundesverfassung eine ausreichende Verfassungsgrundlage brachte. Ein erster Anlauf hatte 1866 zwar knapp das Volksmehr erhalten, war aber am erforderlichen Ständemehr ge scheitert: 12 kleine Kantone konnten die Vereinheitlichung noch einmal hinauszögern. Provokationen und Machtkampf zwischen Konservativen und Liberalen Konservativer Umschwung im reformierten Zürich 15 Ents tehung de Eidgenossenschaft 1. ORS Von der Alten Eidgenossenschaft zur Bundesverfassung In Zürich erweckte die gutgemeinte Reform des Volksschulwesens, die zu einer Reduktion der Kinderarbeit geführt hätte, den Unmut der Bauern und der Fabrikanten. Der liberale Regierungsrat berief 1839 den deutschen Theologen David Friedrich Strauss an die Universität, der mit der Schrift Das Leben Jesu, kritisch betrachtet 1835 an den Hochschulen eine Welle kritischer Bibelforschung, im breiten reformierten Kirchenvolk dagegen massivsten Protest ausgelöst hatte. Umgehend bildete sich ein Glaubenskomitee, das die Versetzung von Strauss in den Ruhestand erzwang. Der Machtkampf ging jedoch weiter, die Zürcher Regierung trat nach einem Marsch bewaffneter Oberländer Bauern zurück und Neuwahlen brachten den Sieg der konservativen Opposition. Im Tessin putschten die Liberalen nach der Niederlage in den Wahlen von 1839 mit Waffengewalt. Die Luzerner behielten mit der revidierten Verfassung von 1841 wohl die direkte Demokratie und die Gewaltenteilung bei, machten jedoch die Säkularisierung (Ablösung der kirchlichen durch staatliche Kontrolle im Erziehungswesen nochmals für einige Jahrzehnte rückgängig. Die Klosteraufhebung im Aargau (1841) Im Aargau führte die vom Volk 1841 mit 16�50 zu 11484 Stimmen angenommene vierte Verfassung mit Aufhebung der konfessionellen Parität im Grossen Rat zu einem Aufstand der katholischen Gebiete (Fricktal, Freiamt, Baden), der mit Waffengewalt niedergeschlagen wurde. Der katholische Seminardirektor Augustin Keller bezeichnete daraufhin die Klöster als Quellen aller Übel und Drahtzieher des konservativen Putschversuches und forderte deren Aufhebung. Diese wurde vom Grossen Rat sofort beschlossen, verletzte aber den Bundesvertrag von 1815 und löste in den katholischen Kantonen heftige Empörung aus. In der Tagsatzung schlug sich der reformiert konservative Zürcher Vertreter auf die Seite der konservativen Katholiken. Seite. Die Aargauer Regierung lenkte nur teilweise ein und stellte die Frauenklöster wieder her, die Männerklöster blieben aufgehoben, ohne dass die Tagsatzung eingeschritten wäre. Als jedoch die Tagsatzung 1843 die Sache für erledigt erklärte, formierte sich konservativer Widerstand. Im Wallis führten die Wahlen von 1843 zu einer konservativen Mehrheit und 1844 zu einer neuen, kirchenfreundlicheren Verfassung. Berufung der Jesuiten nach Luzern (1844) Der Grosse Rat des Kantons Luzern rief 1844 die Jesuiten zur Leitung des Pfarrdienstes und der Priesterausbildung nach Luzern zurück, obwohl besonnene Konservative wie der Ratsschreiber Bernhard Meyer und der Schultheiss (Regierungspräsident) Konstantin SiegwartMüller davor gewarnt hatten, die Liberalen zu provozieren. Der radikale Katholik Augustin Keller, der schon bei der Aargauer Klosteraufhebung 1841 treibende Kraft gewesen war, versuchte auf der Tagsatzung einen Beschluss gegen die Jesuitenberufung zu erwirken, 16 Ents tehung de Eidgenossenschaft 1. ORS Von der Alten Eidgenossenschaft zur Bundesverfassung doch sein Antrag wurde mit den Stimmen der katholischen und der reformierten konservativen Kantone abgelehnt. Freischarenzüge (1845) Die enttäuschten Liberalen und Radikalen wollten sich mit den Mehrheitsentscheiden des Grossen Rates von Luzern und der Tagsatzung, die in etwa auch der Volksmeinung entsprochen haben dürften, nicht abfinden. 1845 marschierten bunt zusammengewürfelte Scharen von bewaffneten Radikalen aus den Kantonen LU, BE, SO, AG und BL Richtung Luzern. Es kam zu Gefechten bei Malters LU und Littau LU, bei denen die Freischärler 185 Tote und 1785 Gefangene verloren. Im Sommer wurde der Führer der Luzerner Konservativen, Joseph Leu von Ebersol, in seinem Schlafzimmer ermordet. Die noch ungefestigte politische Kultur der Regenerationszeit drohte im Chaos von politisch motivierten, aber deswegen keineswegs entschuldbaren Gewaltakten zu versinken. Die Tagsatzung stimmte klar für ein Verbot der Freischarenzüge. Der Sonderbundskrieg Der Sonderbund der alten katholischen Kantone Die konservativen Regierungen begnügten sich aber nicht damit, dass die Tagsatzung ihre Positionen unterstützte (Duldung der Jesuiten, Verbot der Freischarenzüge). Die Kantone LU, UR, SZ, OW, NW, ZG, FR und VS bildeten unter Führung des Luzerner Schultheissen Konstantin SiegwartMüller eine zunächst geheim gehaltene Schutzvereinbarung zur Wahrung ihrer legitimen Ansprüche auf Selbstbestimmung nach den kantonalen Verfassungen und zur Verteidigung ihres Gebietes. Die Wahl der Partner entsprach bis auf SO, das durch VS ersetzt wurde, dem gegenreformatorischen Bündnis von 1586 und bis auf AI den Kantonen, die 1874 die Totalrevision der Bundverfassung ablehnten. Mit der Jesuitenberufung und der Wahl der Partner gaben die Zentralschweizer Konservativen ihrer Sache gegen die Radikalen ein konfessionelles Etikett, das sie bis zu diesem Zeitpunkt nicht gehabt hatte, ein Etikett zudem, das in der Folge Katholiken in anderen Kantonen zu Feinden des Fortschrittes abstempelte und damit in eine unangenehme Minderheitsposition brachte, obwohl sie als einzelne Personen vielleicht gar nicht fortschrittsfeindlich waren. Als die Existenz dieses Sonderbundes im Juni 1846 bekannt wurde, löste sie bei den Reformierten einen Sturm der Entrüstung aus. 17 Ents tehung de Eidgenossenschaft 1. ORS Von der Alten Eidgenossenschaft zur Bundesverfassung Erste Reaktion: Liberaler Umschwung in Bern, Genf und Basel Damit wendete sich das Blatt: Die Wechselwähler (nicht fest an eine Partei gebundene Wahlberechtigte) sahen die Freiheit gefährdet und neigten wieder den Liberalen zu: 1846 gaben sich die bisher konservativen Berner eine liberale Verfassung, Genf wählte eine liberale Regierung. 1847 gaben sich Genf und BaselStadt liberale Verfassungen, das katholische Gasterland (SG) entsandte nach Neuwahlen nur noch liberale Vertreter in den Grossen Rat, sodass auch Sankt Gallen das Lager wechselte. In Fribourg kam es zu einem liberalen Umsturzversuch. Umgekehrt machten der Papst, das protestantische Preussen und Österreich Druck auf die Tagsatzung, um die alte Ordnung zu stützen, erreichten damit aber wohl das Gegenteil: Die ausländische Einmischung wurde energisch zurückgewiesen und die Tagsatzung erklärte am 20. Juli 1847 mit der nunmehr liberalen Mehrheit den Sonderbund für aufgelöst. Hilferuf der Sonderbundskantone an Österreich Nun rief SiegwartMüller Österreich formell um Hilfe an und machte zugleich Vorschläge für eine Neuordnung der Kantonsgebiete im Fall eines Sieges. So sollten das Berner Oberland und das Simmental Obwalden und dem Wallis, die katholischen Bezirke des Aargaus Luzern angegliedert und Glarus zwischen Schwyz und Uri aufgeteilt werden. Zudem war ein eigener Kanton Pruntrut (Jura) geplant. Dies zeigt, dass die Konservativen ebenso wenig Respekt vor dem Selbstbestimmungsrecht der Kantone hatten wie die liberalen Freischaren. Im August beschloss die Tagsatzung eine Revision des Bundesvertrages, im September wurden LU, SZ, FR und VS aufgefordert, die Jesuiten auszuweisen. Nach erfolglosen Verhandlungen wählten beide Seiten im Oktober militärische Anführer. General Dufours Verdienste im Sonderbundskrieg Der eigentliche Sonderbundskrieg wurde vom Sonderbund mit Angriffen auf das Tessin und das Freiamt (AG) eröffnet, die Truppen der Tagsatzung marschierten zuerst gegen Fribourg und Zug. FR und ZG kapitulierten kampflos. Darauf kam es in Honau, Gisikon und Meierskappel zu Kämpfen, Luzern wurde besetzt. In den folgenden Tagen kapitulierten OW, NW, SZ, UR und VS, SiegwartMüller setzte sich über den Simplonpass nach Italien ab. Der Oberbefehlshaber der Tagsatzungsarmee, General Guillaume Henri Dufour, hatte seine Truppen dazu angehalten, 18 Ents tehung de Eidgenossenschaft 1. ORS Von der Alten Eidgenossenschaft zur Bundesverfassung unnötiges Blutvergiessen zu vermeiden und auf Plünderungen und Brandschatzungen zu verzichten. Sein Verdienst ist es, dass der Sonderbundskrieg schnell und mit lediglich insgesamt 86 Toten und 500 Verletzten beendet und weiteres Blutvergiessen verhindert werden konnte. Dufour ist übrigens auch Mitbegründer des Roten Kreuzes und Vater der modernen Landeskarten. Die Bundesverfassung von 1848 Nach der Niederlage des Sonderbundes sahen die liberalen und radikalen Befürworter einer stärkeren Zentralgewalt die Gelegenheit gekommen, ihr Anliegen umzusetzen. Immerhin waren sie besonnen genug, nicht wieder einen Einheitsstaat nach dem Vorbild der Helvetik aufzurichten, sondern beliessen den Kantonen weitgehende Selbstbestimmung, vor allem in Belangen, die sich als heikel erwiesen hatten (z.B. beim Schulwesen). Trotzdem wurde die neue Verfassung nur von 15 Kantonen (inkl. LU!) angenommen, SZ, ZG, VS, UR, NW, OW, AI, TI lehnten sie ab, in FR brachte man nicht den Mut zu einer Volksabstimmung auf. Aufgabe 10: Die ganzen historischen Ereignisse zum Sonderbundkrieg sind ganz schön kompliziert. Vereinfach das Ganze, indem du folgende angefangene Sätze vollendest. Der Anlass für den Sonderbundkrieg war Der Sonderbundkrieg war 19 Ents tehung de Eidgenossenschaft 1. ORS Von der Alten Eidgenossenschaft zur Bundesverfassung Als Ergebnis des Sonderbundkrieges Neue Kompetenzen des Bundes Immerhin wurden handlungsfähige Bundesbehörden eingeführt. Der Bund sollte neu über Krieg und Frieden, Bündnisse und Staatsverträge entscheiden und bei Streitigkeiten zwischen den Kantonen eingreifen. Das Zoll, Post und Münzwesen fielen ebenfalls in die Hoheit der Bundesbehörden. Zum Sitz der Bundesregierung wurde Bern gewählt, das sich verpflichtet hatte, dem Bund möblierte Amtsräume zur Verfügung zu stellen. Der erste Flügel des Bundeshauses wurde 1857 fertiggestellt, 1885 wurde die Erweiterung um den Mittelteil mit der charakteristischen Kuppel und den Ostflügel beschlossen, die 1902 fertiggestellt war. Noch 1848 wurde ein Gesetz zur Übernahme der bisher privaten bzw. z.T. kantonalen Postdienste durch den Bund erlassen. 1849 wurden die Binnenzölle (Zölle innerhalb des Landes, an rund 400 wichtigen Strassen und Brücken) abgeschafft und die Zölle an den Landesgrenzen durch den Bund erhoben. 1850 folgte die Wiedereinführung des Schweizer Frankens als einzige offizielle Währung in allen Kantonen. 1851 wurde die Telegraphie (Übermittlung von Nachrichten über elektrische Fernleitungen mit Hilfe eines aus kurzen Impulsen (Punkten) und langen Impulsen (Strichen) zusammengesetzten Codes, des nach 20 Ents tehung de Eidgenossenschaft 1. ORS Von der Alten Eidgenossenschaft zur Bundesverfassung seinem Erfinder Samuel Morse benannten Morsealphabets) eingeführt. 1855 entstand in Zürich mit dem Eidgenössischen Polytechnikum die erste Hochschule des Bundes (heute Eidgenössische Technische Hochschule Zürich ETHZ). Der wohl berühmteste Student an der ETHZ war Albert Einstein. Forstwesen: Im der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde der seit dem Mittelalter betriebene Kahlschlag der Wälder fortgesetzt, ab 1830 verkauften viele Gemeinden und Kantone Staatswälder, die Bevölkerungszunahme und die einsetzende Industrialisierung mit Dampfmaschinen erhöhten den Energiebedarf. So kamen die neuen Artikel und das Forstgesetz zum Schutz des Waldes, die sich seither sehr bewährt haben und heute noch als wegweisend gelten, gerade noch rechtzeitig, um weitaus Schlimmeres als die Hochwasserschäden von 1834 und 1839 zu verhindern und eine nachhaltige Nutzung des Waldes einzuleiten, bevor es zu spät war. Garantie der Grundrechte Den Schweizerbürgern wurden die Gleichheit vor dem Recht, die Niederlassungs, Religions, Presse und Vereinsfreiheit garantiert. Zudem wurde das Recht geschaffen, dass 50�00 (heute: 100�00) Bürger mit einer Unterschriftensammlung eine Verfassungsrevision verlangen können. Bundesbehörden Oberstes Bundesorgan ist seit 1848 die Bundesversammlung, ein Zweikammer Parlament (Legislative, gesetzgebende Behörde) nach USamerikanischem Vorbild. Der Nationalrat repräsentiert die Bevölkerung nach Einwohnerzahl, wobei ursprünglich 1 Nationalrat 20�00 Einwohner vertrat (1848: 111 Sitze, 1850: 120 Sitze); später wurde die Zahl der Nationalräte auf 200 fixiert. Die bevölkerungsstarken Kantone haben darin ein sehr grosses Gewicht, die kleinsten Kantone stellen nur je einen Nationalrat. Im Ständerat, auch Kleine Kammer genannt, ist jeder Kanton ungeachtet seiner Grösse mit zwei Sitzen vertreten, Halbkantone (OW, NW, BS, BL, AR, AI) mit je einem Sitz. Bundesgesetze benötigen die Zustimmung beider Kammern, sodass die kleinen Kantone faktisch über eine Sperrminorität verfügen, die gelegentlich zum Tragen kommt. Die beiden Kammern der Bundesversammlung treffen sich mehrmals jährlich zu mehrwöchigen Sessionen (Parlamentssitzungen) und dazwischen zu vorbereitenden Sitzungen ihrer Kommissionen (Fachgruppen). Berufsparlamentarier kennt die Schweiz im Gegensatz zu den meisten anderen Staaten bis heute nicht. 21 Ents tehung de Eidgenossenschaft 1. ORS Von der Alten Eidgenossenschaft zur Bundesverfassung Die Exekutive [ausführende Behörde] heisst bei uns Bundesrat (nicht zu verwechseln mit dem Deutschen Bundesrat, der unserem Ständerat entspricht!). Der Bundesrat besteht aus sieben vollamtlichen Mitgliedern (im Ausland würde man sie als Minister bezeichnen), die je einen Bereich der Bundesverwaltung führen und wichtige Entscheide gemeinsam treffen (Kollegialitätsprinzip). Das Amt des Bundespräsidenten wird reihum während je eines Jahres von einem der Bundesräte ausgeübt und umfasst fast ausschliesslich repräsentative Aufgaben vom Empfang ausländischer Staatsgäste bis zur Neujahrsansprache. Einen starken Ministerpräsidenten wie in den meisten europäischen Ländern oder einen starken Präsidenten wie in den USA gibt es in der Schweiz nicht. Der Bundeskanzler hat nicht wie in Deutschland die Rolle eines Ministerpräsidenten, sondern nimmt an den Bundesratssitzungen als Sekretär ohne Stimmrecht teil und tritt gelegentlich in der Funktion eines obersten Pressesprechers in Erscheinung. Die Judikative, das Bundesgericht hatte 1848 noch eine geringere Bedeutung als heute, weil damals weder ein einheitliches Strafrecht noch ein einheitliches Zivilgesetzbuch vorlag. Es sollte zunächst vor allem Streitigkeiten zwischen den Kantonen regeln. Heute werden allfällige Probleme zwischen den Kantonen in aller Regel durch Verhandlungen gelöst, umgekehrt hat das Bundesgericht als letzte Instanz in zivil oder strafrechtlichen Fällen, bei denen eine Partei das Urteil der kantonalen Gerichte nicht akzeptieren will, eine grosse Bedeutung. Zudem haben die Urteile des Bundesgerichtes Grundsatzcharakter: Da nicht jeder Spezialfall in einem Gesetz bis ins letzte Detail geregelt werden kann, legen die Gerichte die Gesetze in solchen Fällen nach ihrem Ermessen aus. Kantonale Gerichte orientieren sich jeweils in späteren, ähnlichen Fällen dann an der Bundesgerichtspraxis. 22 Ents tehung de Eidgenossenschaft 1. ORS Von der Alten Eidgenossenschaft zur Bundesverfassung 23 Ents tehung de Eidgenossenschaft 1. ORS Von der Alten Eidgenossenschaft zur Bundesverfassung Arbeitsblatt für die Aufgabe 2 24 Ents tehung de Eidgenossenschaft 1. ORS Von der Alten Eidgenossenschaft zur Bundesverfassung 25 Entstehung der Eidgenossenschaft 1. ORS Von der Alten Eidgenossenschaft zur Bundesverfassung Arbeitsblatt zu Aufgabe 3: Samstag, den 15. November 1315 Unge fähr vier Stunden vor Tagesanbruch setzt sich Leopolds Zug in Bewegung, voran die 2000 stolzen Ritte r, hinter ihnen das Fussvolk. die Kolonne is einige Kilometer lang. Nach Oberägeri bewegt sie sich den See entlang. Ortskundige schwyzerische Späher und Eilboten haben den Abmarsch des österre ichischen Heeres aus Zug gegen den Ägerisee längst ihren Hauptleuten gemeldet. In den Wä ldern und im Gebüsch der Finstern- und Figlenfluh harren die Schwyze r. Sie haben strengen Be fehl erha lten, ke in Feuer anzuzünden, auf ke in Ästchen zu treten und ke in lautes Wort zu reden. Auf dem höchsten Punkt der Figlenfluh halten die Hauptleute Ausschau. Von Ze it zu Ze it tre ffen Boten ein. Be im ersten Dämmern kommen die Reiter vor dem Engpass zwischen Finsternfluh und Tschupplenhügel an. Ke ine Wache is zu sehen, ke in Ton zu hören. So zieht die Kolonne ahnungslos vorwärts, zur Rechten einige kle ine Seen und Sümpfe und zur linken Wä lder und Flühe. Ungefähr 300 Me ter oberha lb des Letziturmes stossen die vordersten Reiter an einer Weggabe lung an eine Strassensperre. Rechts davon hat der gestaute Trombach die Wiesen in einen Sumpf verwande lt. Deshalb sind die Re iter gezwungen, in östlicher Richtung in einen Hohlweg einzubiegen. Etwa 1600 Re iter sind bis je tzt in das Gebiet der Engpässe eingeritten. Nun geben die Schwyzer Hauptleute das Ze ichen zum Angriff. Hornstösse zerre issen die Stille. Mit einem Ma le wird der tote Berg lebendig. Vom Tschupplenhügel und der Finsternfluh her brechen die Schwyzer in die Kolonne ein, zerschne iden sie und verbarrikadieren die Wegste lle blitzartig mit bere itliegenden Träme ln. Damit sind die eingerittenen 1600 Mann abgeriege lt und ge fangen. Wildes Entsetzten verbre itet sich. Der Te il der Re ite r, der sich noch ausserha lb der Barrikade be findet, macht sogle ich kehrt und flieht Ha ls über Kopf. Die Pferde sind so erschrocken, dass die Re iter ihr eigenes Fussvolk niederre issen. Ein paar dutzend Fe inde springen in ein Boot, das am Ufer angebunden ist. Sie fahren hinaus. Die überladene Barke sinkt, und die Mannschaft ertrinkt. Auch vie le andere, die den Pferden auswe ichen wollten, finden im See ihr nasses Grab. Wie ergeht es den Eidgenossen? Vorn, am Ausgang jenes Hohlweges, verhindert ein starker eidgenössischer Harst we iteres Vorrücken. Von den Bergflanken donnern Ste ine in die Reiterkolonne. Dort aber, wo der Hang zu wenig steil ist und nicht nahe genug an die Strasse heranre icht, brechen die schwyzerischen Männer mit dröhnendem Geschre hervor und schleudern die bere itge legten Ste ine und meterlangen As tstücke in die Kolonne. Die Pferde scheuen, bäumen sich auf, werfen ihre Re iter ab oder kollern mit ihnen durch- und übere inande r. Andere nehmen Re issaus und vers inken in den Seen und Sümpfen. Richtig zur Wehr setzten kann sich niemand. Der Weg is zu schmal und nach vorn und hinten vollgestopft. In ihrer schweren Rüstung können sich die Ritter kaum bewegen. Wer sich zuerst noch im Satte zu ha lten vermag, den zerren die Eidgenossen mit den Haken ihrer He llebarden von den Pferden und schlagen erbarmungslos auf sie los. Unge fähr um 8 Uhr morgens is der Kampf schon entschieden. 26 Ents tehung de Eidgenossenschaft 1. ORS Von der Alten Eidgenossenschaft zur Bundesverfassung Arbeitsblatt zu Aufgabe 4: Amt Entschädigung Hilfe Landsmann Richter Schaden schuldig Schadenersatz Schwyz Talleute Unterwalden Uri verbannt verlieren Wiederaufbau zurückkehren drei Im Namen Gottes lateinischer Ordnung Pergament Siegel 1291 A. Um sich gemeinsam zu schützen, haben die Leute der Länder, und geschworen, einander bei einem Angriff zu gewähren. Alle leisten diese Hilfe ohne . Um Streit unter den Einwohnern zu schlichten und um Verbrecher zu verurteilen, wählt das Volk die selber. Ein Richter darf sein nicht kaufen. Wer einen andern tötet, soll sein Leben . Ist dieser Mörder aus dem Lande geflohen, so darf er nie mehr . Versteckt einer den Mörder, so wird er aus dem Lande. Zündet einer dem andern das Haus an, so gilt er nicht mehr als. Nimmt einer den Brandstifter heimlich in sein Haus auf, so muss er dem Geschädigten den bezahlen. Wer einen andern Eidgenossen bestiehlt, muss mit seinen Gütern leisten. Gehorcht einer dem Richter nicht, so haben die andern dafür zu sorgen, dass der Verurteilte sich bekennt und den begleicht. B. 27 Ents tehung de Eidgenossenschaft 1. ORS Von der Alten Eidgenossenschaft zur Bundesverfassung Am Anfang des Bundesbriefes steht „_, Amen. Die Eidgenossen hofften, dass diese ewig gelte. Am Bundesbrief wurden die der (Zahl) Länder angebracht. Der Bundesbrief ist in Sprache auf geschrieben und stammt aus dem Jahre. Er kann heute noch im Bundesbriefmuseum in Schwyz angeschaut werden. 28 Ents tehung de Eidgenossenschaft 1. ORS Von der Alten Eidgenossenschaft zur Bundesverfassung 29 Ents tehung de Eidgenossenschaft 1. ORS Von der Alten Eidgenossenschaft zur Bundesverfassung Arbeitsblatt zu Aufgabe 7: Vorgeschichte Nach aussen hin hatte sich die Eidgenossenschaft in den Burgunderkriegen zwischen 1474 und 1477 behaupten können – in der Schlacht bei Murten 1476 erlitt Burgunderherzog Karl der Kühne die bis dahin vernichtendste Niederlage, in der Schlacht bei Nancy verlor der Herzog schließlich sein Leben. Im Innern aber kam es unter anderem über die Aufteilung von Kriegsbeute sowie die Vereinbarung des gegenseitigen Burgrechts zwischen den Stadtorten Zürich, Bern und Luzern auf der einen und Freiburg im Uechtland und Solothurn auf der anderen Seite zu Konflikten. Angespannt war das Verhältnis der Acht Orte untereinander auch wegen Vorfällen wie dem «Saubannerzug» von rund 2000 Urnern, Schwyzern, Unterwaldnern, Zugern und Luzernern anlässlich der Fasnacht im Februar 1477. Dieser Raubzug unter einem Feldzeichen, das eine «Sau» auf blauem Grund zeigte, führte durch die Waadt bis nach Genf, wo eine angeblich noch ausstehende Kriegskontribution eingetrieben werden sollte. Die Stadt Genf sah sich gezwungen, sich mit der Zahlung von 8000 Gulden an die Orte Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug und Luzern von den Innerschweizern zu befreien. Um den Abzug der raub und zerstörungslustigen Kämpfer zu beschleunigen, zahlte sie allen 1700 verbliebenen Teilnehmern des Saubannerzugs zudem noch zwei Gulden in die Hand und Alkohol auf den Weg. Um sich vor solchen Übergriffen aus den Landorten der Innerschweiz zu schützen, gingen die Stadtorte untereinander Sonderbündnisse ein. Tagsatzung in Stans Im Dezember 1481 kamen Abgesandte der Acht Orte in Stans zu einer Tagsatzung zusammen, bei der über die verschiedenen Konfliktfelder Verhandlungen geführt werden sollten. Diese drohten allerdings zu scheitern – was letztlich das Bündnis an sich bedrohte. Nach Schilderung Diebold Schillings, der bei der Tagsatzung anwesend gewesen war, in der Luzerner Chronik löste sich die verfahrene Situation am 22. Dezember durch eine durch den Stanser Pfarrer Heini (Heimo) Amgrund überbrachte Botschaft des als Bruder Klaus im Ranft bekannten Einsiedlers Niklaus von Flüe: Armgrund sei in der Nacht zu diesem gegangen und 30 Ents tehung de Eidgenossenschaft 1. ORS Von der Alten Eidgenossenschaft zur Bundesverfassung am Mittag mit dessen Botschaft zurückgekehrt, die zu einer Einigung führte – der Inhalt dieser Botschaft ist allerdings nicht überliefert. Heute gibt es einen am Winkelrieddenkmal oberhalb des Dorfes Stans beginnenden Wander und Pilgerweges in die Ranftschlucht, den «BruderKlausenWeg», gleichzeitig eine Etappe des Jakobswegs. Inhalt Der Kompromiss bestand darin, Freiburg und Solothurn in den Bund aufzunehmen und im Gegenzug das Burgrecht abzuschaffen. Die Einigung umfasste das Verbot gewaltsamer Überfälle auf Miteidgenossen oder deren Bundesgenossen; den Schutz eines überfallenen Ortes durch die anderen; die Bestrafung der Übeltäter entweder durch die heimatlichen Gerichte oder durch diejenigen am Tatort; ein Verbot von Gemeindeversammlungen oder Zusammenrottung ohne Erlaubnis der Obrigkeit; ein Verbot, die Untertanen eines anderen Ortes aufzuwiegeln; die Verpflichtung der Orte, bei Aufständen von Untertanen anderer Orte zu vermitteln und die Bestätigung des Sempacher und Pfaffenbriefes. Die Bünde sollten alle 5 Jahre beschworen und dabei die drei Verkommnisse verlesen werden. Schliesslich sollte Kriegsbeute künftig unter die Orte nach Marchzahl verteilt werden. 31