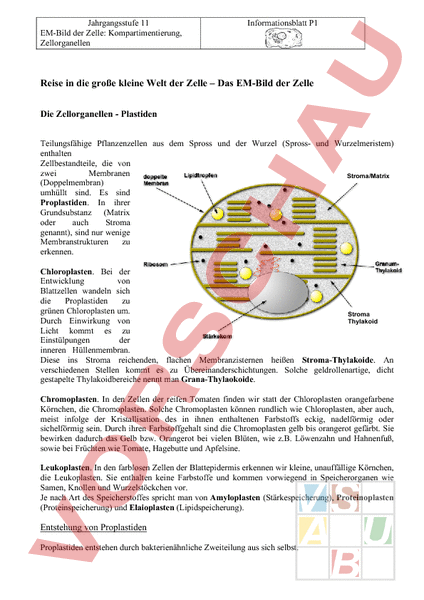Arbeitsblatt: Zellorganellen Expertengruppen
Material-Details
Zellorganellen
Biologie
Zellbiologie / Cytologie
11. Schuljahr
14 Seiten
Statistik
52103
2034
25
07.01.2010
Autor/in
Koppvondeobba (Spitzname)
Land: Deutschland
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Jahrgangsstufe 11 EM-Bild der Zelle: Kompartimentierung, Zellorganellen Informationsblatt P1 Reise in die große kleine Welt der Zelle – Das EM-Bild der Zelle Die Zellorganellen Plastiden Teilungsfähige Pflanzenzellen aus dem Spross und der Wurzel (Spross- und Wurzelmeristem) enthalten Zellbestandteile, die von zwei Membranen Stroma/Matrix (Doppelmembran) umhüllt sind. Es sind Proplastiden. In ihrer Grundsubstanz (Matrix oder auch Stroma genannt), sind nur wenige Membranstrukturen zu erkennen. Chloroplasten. Bei der Entwicklung von Blattzellen wandeln sich die Proplastiden zu grünen Chloroplasten um. Stroma Durch Einwirkung von Thylakoid Licht kommt es zu Einstülpungen der inneren Hüllenmembran. Diese ins Stroma reichenden, flachen Membranzisternen heißen Stroma-Thylakoide. An verschiedenen Stellen kommt es zu Übereinanderschichtungen. Solche geldrollenartige, dicht gestapelte Thylakoidbereiche nennt man Grana-Thylaokoide. Chromoplasten. In den Zellen der reifen Tomaten finden wir statt der Chloroplasten orangefarbene Körnchen, die Chromoplasten. Solche Chromoplasten können rundlich wie Chloroplasten, aber auch, meist infolge der Kristallisation des in ihnen enthaltenen Farbstoffs eckig, nadelförmig oder sichelförmig sein. Durch ihren Farbstoffgehalt sind die Chromoplasten gelb bis orangerot gefärbt. Sie bewirken dadurch das Gelb bzw. Orangerot bei vielen Blüten, wie z.B. Löwenzahn und Hahnenfuß, sowie bei Früchten wie Tomate, Hagebutte und Apfelsine. Leukoplasten. In den farblosen Zellen der Blattepidermis erkennen wir kleine, unauffällige Körnchen, die Leukoplasten. Sie enthalten keine Farbstoffe und kommen vorwiegend in Speicherorganen wie Samen, Knollen und Wurzelstöckchen vor. Je nach Art des Speicherstoffes spricht man von Amyloplasten (Stärkespeicherung), Proteinoplasten (Proteinspeicherung) und Elaioplasten (Lipidspeicherung). Entstehung von Proplastiden Proplastiden entstehen durch bakterienähnliche Zweiteilung aus sich selbst. Jahrgangsstufe 11 EM-Bild der Zelle: Kompartimentierung, Zellorganellen Arbeitsblatt P2 Reise in die große kleine Welt der Zelle – Das EM-Bild der Zelle Die Zellorganellen Plastiden Sie sind Experte für das Zellorganell Plastiden. Auf einer Tagung stellen Sie anderen Wissenschaftlern, die vorher noch nie von diesem Zellorganell gehört haben, Ihr Zellorganell vor. Abbildung: Chloroplast: A, EM-Bild; B, Schema (räumlich) Aufgabe 1: Überlegen Sie sich mit den anderen Experten in Ihrer Runde, welche Eigenschaften des Zellorganells mitteilenswert sind und notieren Sie diese. Verwenden Sie als Informationsquelle das Informationsblatt P1. Aufgabe 2: Beschriften Sie anhand des Informationsblattes P1 die oben angegebene Abbildung. Aufgabe 3: Halten Sie einen kurzen Vortrag über die Eigenschaften des Zellorganells, so dass sich Ihre Zuhörer Notizen zu Ihrem Vortrag machen können. Jahrgangsstufe 11 EM-Bild der Zelle: Kompartimentierung, Zellorganellen Arbeitsblatt P3 Reise in die große kleine Welt der Zelle – Das EM-Bild der Zelle Die Zellorganellen Plastiden Aufgabe: Fertigen Sie einen Steckbrief der Plastiden an! Hören Sie sich den Vortrag des Experten an und machen Sie sich Notizen zu den vom Experten vorgetragenen Eigenschaften. Abbildung: Chloroplast: A, EM-Bild; B, Schema (räumlich) Jahrgangsstufe 11 EM-Bild der Zelle: Kompartimentierung, Zellorganellen Informationsblatt M1 Reise in die große kleine Welt der Zelle – Das EM-Bild der Zelle Die Zellorganellen Mitochondrien Mitochondrien bezeichnet man auch als Kraftwerke der Zellen. Gewöhnlich sind sie stäbchenförmig, können jedoch auch rund sein. Sie sind spezielle Zellorganellen mit zwei Membranen (Doppelmembran). Die innere Membran bildet Falten und Fächer, die nach innen ausgestülpt sind. Diese werden „cristae mitochondriales kurz Cristae genannt. Innerhalb der inneren Membran ist die Mitochondrienmatrix (Grundsubstanz). Diese erscheint wenig dicht und man findet u.a. mitochondrieneigene ringförmige DNA. Mitochondrien sind neben Plastiden die einzigen Organellen, die eigene DNA besitzen. Mitochondrien als Kraftwerk der Zelle Die vom Organismus aufgenommene Nahrung (z.B. Kartoffeln) wird verdaut, ihre Bestandteile (einzelne Kohlenhydratmoleküle z.B. Glukosa) ins Blut aufgenommen, in die Zellen verteilt und in den Mitochondrien weiterverarbeitet, um einen universellen Energiespeicherstoff (Adenosintriphosphat, kurz ATP) zu produzieren. Dieser (Verbrennungs-) Prozess benötigt viel Sauerstoff (Daher atmen wir Sauerstoff!!!). Die Reaktionsgleichung dieser sog Zellatmung oder Dissimilation dessen erster Teil im Cytoplasma abläuft lautet: C6H12O6 6 O2 6 H2O ( 38 ADP 38 P) 6 CO2 Glukose Sauerstoff „leere Batterie Kohlenstoffdioxyd 12 H2O ( 38 ATP) Wasser 38„volle Batterien Entstehung von Mitochondrien Mitochondrien entstehen durch bakterienähnliche Zweiteilung aus sich selbst. Jahrgangsstufe 11 EM-Bild der Zelle: Kompartimentierung, Zellorganellen Arbeitsblatt M2 Reise in die große kleine Welt der Zelle – Das EM-Bild der Zelle Die Zellorganellen Mitochondrien Sie sind Experte für das Zellorganell Mitochondrium (pl. Mitochondrien). Auf einer Tagung stellen Sie anderen Wissenschaftlern, die vorher noch nie von diesem Zellorganell gehört haben, Ihr Zellorganell vor. Abb.: Mitochondrium: A, EM-Bild; B, Schema (räumlich) Aufgabe 1: Überlegen Sie sich mit den anderen Experten in Ihrer Runde, welche Eigenschaften des Zellorganells mitteilenswert sind und notieren Sie diese. Verwenden Sie als Informationsquelle das Informationsblatt M1. Aufgabe 2: Beschriften Sie anhand des Informationsblattes M1 die oben angegebene Abbildung. Aufgabe 3: Halten Sie einen kurzen Vortrag über die Eigenschaften des Zellorganells, so dass sich Ihre Zuhörer Notizen zu Ihrem Vortrag machen können. Jahrgangsstufe 11 EM-Bild der Zelle: Kompartimentierung, Zellorganellen Arbeitsblatt M3 Reise in die große kleine Welt der Zelle – Das EM-Bild der Zelle Die Zellorganellen Mitochondrien Aufgabe: Fertigen Sie einen Steckbrief der Mitochondrien an! Hören Sie sich den Vortrag des Experten an und machen Sie sich Notizen zu den vom Experten vorgetragenen Eigenschaften. Abb.: Mitochondrium: A, EM-Bild; B, Schema (räumlich) Jahrgangsstufe 11 EM-Bild der Zelle: Kompartimentierung, Zellorganellen Informationsblatt ER1 Reise in die große kleine Welt der Zelle – Das EM-Bild der Zelle Die Zellorganellen – Endoplasmatisches Retikulum (frei übersetzt: inner-plasmatisches Netzwerk) Der Bau des Endoplasmatischen Retikulums (ER). Das ER ist für alle Zellen mit Zellkern (eukaryotischen Zellen) nachgewiesen. Im lichtmikroskopischen Bild ist es allerdings fast nie zu identifizieren, da sein Querschnitt nur ca. 30nm misst. Erst im elektronenmikroskopischen Bild ist erkennbar, dass es sich um ein Gangsystem handelt, bei dem 2 Membranen ein dreidimensionales Hohlraumsystem aus Röhren oder Säckchen (Zisternen) bilden, die vielfältig miteinander verbunden sind. Auch die Kernhülle ist eine Bildung des ER; beide Gebilde stehen in engem Kontakt zueinander. Das ER der Zellen geht sogar durch Übergangsstellen in das der Nachbarzellen über. Bei Pflanzen durchziehen solche Übergänge die Tüpfel (plasmatische Brücken zwischen pflanzlichen Zellen) in den Zellwänden. Es gibt 2 Typen von ER: Bereiche, in denen die Membranen auf der Cytoplasmaseite mit unzählig vielen Ribosomen besetzt sind, heißen raues ER. Anderen Bereichen sitzen keine Ribosomen auf: glattes ER. Die Dynamik des Umbaus von ERStrukturen. Bei Zellen mit hoher Stoffwechselaktivität (z.B. Nervenzellen) ist das ER besonders umfangreich ausgeprägt. Man schloss daraus frühzeitig, dass es an Stoffwechselvorgängen beteiligt sein muss. Auch die große Dynamik der Umformungsprozesse des ER weist darauf hin: Seine Strukturen befinden sich durch Abschnürung kleiner Bläschen, Auflösung oder Neubildung ganzer Bezirke in einer ständig fließenden Veränderung, die so intensiv wie bei keinem anderen Zellorganell ist. Aufgaben des ER: Stoffproduktion, Stofftransport, Stoffverteilung. An den Ribosomen des rauen ER werden Eiweißmoleküle (Proteine) aller Art aufgebaut (synthetisiert). Die neu gebildeten Proteine werden noch während ihrer Herstellung durch kleine Poren in das Innere des ER geschleust. Hier werden sie in der Regel noch bearbeitet. Eiweiße, die später aus der Zelle transportiert werden sollen, erhalten z.B. eine Grundausstattung an Kohlenhydraten angehangen. Diese Kohlenhydratanhängsel werden – nach Weiterleitung der Eiweiße zu den Stapeln des Golgi-Apparates – dort verändert. In den Bezirken des glatten ER werden v. a. Fette hergestellt. Diese werden in sich abschnürende Bläschen verpackt, ebenfalls zu Golgi-Stapeln befördert, dort gesammelt und dann zum Aufbau fast sämtlicher neuer Membranen der Zelle vorbereitet. Je nach Zelltyp werden auch noch verschiedene andere, teils sehr spezielle Stoffe im ER produziert bzw. umgebaut: Sekreteiweiße in Drüsenzellen, Antikörper in Plasmazellen, Steroidhormone in Hodenzellen. In Leberzellen besorgt das ER im Bedarfsfall den Abbau von gespeichertem Vielfachzucker (Glykogen) zu Glucose sowie die Entgiftung gefährlicher Stoffe (auch Medikamente) durch deren Umbau. In Muskelzellen werden die zur Kontraktionsauslösung nötigen CalciumIonen gespeichert. Und vieles mehr. Jahrgangsstufe 11 EM-Bild der Zelle: Kompartimentierung, Zellorganellen Informationsblatt ER2 Reise in die große kleine Welt der Zelle – Das EM-Bild der Zelle Die Zellorganellen – Ribosomen Bau der Ribosomen. Ribosomen haben eine annähernd kugelförmige Gestalt, die aus 2 verschiedenen großen Untereinheiten zusammengesetzt sind. Ihr Durchmesser beträgt ca. 20nm, sie sind also nur im elektronenmikroskopischen Bild deutlich auszumachen. Deshalb wurden sie erst im Jahr 1953 entdeckt. Ribosomen bestehen zu ca. 50% aus Nucleinsäure (RNA (Ribonucleinsäure)- ein dem DNA ähnlichen Molekül) und zu ca. 50% aus verschiedenen Eiweißmolekülen. Von einhüllenden Membranen sind die nicht umgeben. Vorkommen der Ribosomen. Ribosomen sind für alle Zellen nachgewiesen. Man findet sie entweder frei im Zytoplasma oder auf der dem Zytoplasma zugewandten Seite der ER-Membran sitzend (raues Endoplasmatischen Retikulum); sogar in Mitochondrien und Plastiden kommen sie vor. Ihre Anzahl in der Zelle ist vom Aktivitätszustand der jeweiligen Zelle abhängig: in Zellen mit intensivem Stoffwechsel d.h. in der viele Stoffe auf bzw. abgebaut werden, kommen sie besonders häufig vor (z. T. über 100.000) Die Ribosomen sind die Orte der Eiweißsynthese. In manchen Fällen kann man mehrere hintereinander liegende Ribosomen gleichzeitig erkennen. Ein solcher Zusammenschluss von Ribosomen nennt man auch Polyribosomen oder kurz Polysomen. Jahrgangsstufe 11 EM-Bild der Zelle: Kompartimentierung, Zellorganellen Arbeitsblatt ER3 Reise in die große kleine Welt der Zelle – Das EM-Bild der Zelle Die Zellorganellen – Endoplasmatisches Retikulum und Ribosomen Sie sind Experte für die Zellorganellen Endoplasmatisches Retikulum und Ribosomen. Auf einer Tagung stellen Sie anderen Wissenschaftlern, die vorher noch nie von diesem Zellorganell gehört haben, Ihr Zellorganell vor. Abb.: ER: A, EM-Bild; B, Schema (räumlich) Aufgabe 1: Überlegen Sie sich mit den anderen Experten in Ihrer Runde, welche Eigenschaften des Zellorganells mitteilenswert sind und notieren Sie diese. Verwenden Sie als Informationsquelle das Informationsblätter ER1, ER2. Aufgabe 2: Beschriften Sie anhand der Informationsblätter ER1 und ER2 die oben angegebene Abbildung. Aufgabe 3: Halten Sie einen kurzen Vortrag über die Eigenschaften des Zellorganells, so dass sich Ihre Zuhörer Notizen zu Ihrem Vortrag machen können. Jahrgangsstufe 11 EM-Bild der Zelle: Kompartimentierung, Zellorganellen Arbeitsblatt ER4 Reise in die große kleine Welt der Zelle – Das EM-Bild der Zelle Die Zellorganellen – Endoplasmatisches Retikulum und Ribosomen Aufgabe: Fertigen Sie einen Steckbrief des Endoplamatischen Retikulums und der Ribosomen an! Hören Sie sich den Vortrag des Experten an und machen Sie sich Notizen zu den vom Experten vorgetragenen Eigenschaften. Abb.: ER: A, EM-Bild; B, Schema (räumlich) Jahrgangsstufe 11 EM-Bild der Zelle: Kompartimentierung, Zellorganellen Informationsblatt G1 Reise in die große kleine Welt der Zelle – Das EM-Bild der Zelle Die Zellorganellen – Golgi-Apparat und Lysosomen Der Bau des Golgi-Apparates. Der Golgi-Apparat besteht aus einem Stapel von flachen oder scheibenförmigen Membranen (Zisternen), die mit zahlreichen Bläschen (Vesikeln) in Verbindung stehen. Die dem Endoplamatischen Reticulum (ER) zugewandte Seite wird als cis-Seite, die gegenüberliegende als trans-Seite bezeichnet. An der trans-Seite findet sich ein ausgeprägtes Netzwerk von lappenförmigen Gebilden (Zisternen). Ein Transport von Proteinen vom ER über den Golgi-Apparat ließ sich nachweisen. Dieser erfolgt wahrscheinlich über Vesikeln, die sich vom ER abschnüren und mit dem cis-Golgi-Apparat fusionieren. Im Golgi-Apparat werden bestimmte im ER addierte Zucker abgespalten und andere hinzugefügt. Nachdem die Proteine im GolgiApparat modifiziert worden sind, werden sie dort sortiert und entsprechend ihrem Bestimmungsort in Vesikeln zu verschiedenen Abschnitten der Plasmamembran oder zu Lysosomen weitergeleitet. Lysosomen. Lysosomen sind von einer Membran umhüllte Vesikel, die eine ganze Reihe von Enzymen zur Spaltung von z.B. Proteinen, Nucleinsäuren, Kohlenhydraten und Fette enthalten. Diese Enzyme werden im rauen ER aufgebaut (synthetisiert), mit Kohlenhydratketten versehen. Anschließend baut der Golgi-Apparat diese Enzyme so um, dass sie, wie mit einer „Adresse versehen, in die Lysosomen transportiert werden. Die Substanzen, die von Lysosomen verdaut werden, sind sehr verschieden und reichen bis hin zu einzelnen Zellorganellen wie z. B. Mitochondrien. Eine Gefahr der Selbstzerstörung der Zelle durch Selbstauflösung (Autolyse) wird dadurch verhindert, dass die Enzyme nicht frei im Zytoplasma, sondern in Vesikeln eingeschlossen sind. Jahrgangsstufe 11 EM-Bild der Zelle: Kompartimentierung, Zellorganellen Arbeitsblatt G2 Reise in die große kleine Welt der Zelle – Das EM-Bild der Zelle Die Zellorganellen – Golgi-Apparat und Lysosomen Sie sind Experte für die Zellorganellen Golgi-Apparat und Lysosomen. Auf einer Tagung stellen Sie anderen Wissenschaftlern, die vorher noch nie von diesem Zellorganell gehört haben, Ihr Zellorganell vor. Abb.: Golgi-Apparat (Dictyosom): A, EM-Bild; B, Schema (räumlich) Aufgabe 1: Überlegen Sie sich mit den anderen Experten in Ihrer Runde, welche Eigenschaften des Zellorganells mitteilenswert sind und notieren Sie diese. Verwenden Sie als Informationsquelle das Informationsblatt G1. Aufgabe 2: Beschriften Sie anhand des Informationsblattes G1 die oben angegebene Abbildung. Aufgabe 3: Halten Sie einen kurzen Vortrag über die Eigenschaften des Zellorganells, so dass sich Ihre Zuhörer Notizen zu Ihrem Vortrag machen können. Jahrgangsstufe 11 EM-Bild der Zelle: Kompartimentierung, Zellorganellen Arbeitsblatt G3 Reise in die große kleine Welt der Zelle – Das EM-Bild der Zelle Die Zellorganellen – Golgi-Apparat und Lysosomen Aufgabe: Fertigen Sie einen Steckbrief des Golgi-Apparates und der Lysosomen an! Hören Sie sich den Vortrag des Experten an und machen Sie sich Notizen zu den vom Experten vorgetragenen Eigenschaften. Abb.: Golgi-Apparat (Dictyosom): A, EM-Bild; B, Schema (räumlich) Jahrgangsstufe 11 EM-Bild der Zelle: Kompartimentierung, Zellorganellen Informationsblatt Z1 Reise in die große kleine Welt der Zelle – Das EM-Bild der Zelle Die Zellorganellen – Zellkern Der Zellkern. Zellen, die einen Zellkern (Nucleus, Karyon) mit Kernhülle aufweisen, werden auch eukaryotische Zellen genannt. Bakterien besitzen keinen Zellkern und werden daher als Prokaryoten bezeichnet. Der Zellkern eukaryotischer Zellen ist von einer Kernhülle umgeben, einer doppelten Membran, die das Nucleo- oder Karyoplasma umschließt. Das Nucleoplasma ( Karyoplasma) besteht zur Hauptsache aus Chromatin, das die Erbsubstanz darstellt, dem Nucleoli als dem Bildungsort der Ribosomen sowie löslichen und partikulären Komponenten wie z.B. Enzymen für die Verdoppelung (Replikation) der Desoxyribonucleinsäure (DNA) und anderen Proteinen. Chromatin besteht aus der DNA,welche um kleine Proteine (sogenannte Histone) herumgewickelt ist (siehe Abbildung unten Kernhülle. Die Kernhülle besteht aus zwei Membranen, deren äußere kontinuierlich ins raue Endoplasmatische Reticulum (ER) übergeht und wie dieses mit membrangebundenen Ribosomen besetzt ist. Die innere Membran geht an vielen Stellen fließend in die äußere Membran über. Diese Stellen bilden die Kernporen. Die Neubildung der Kernhülle nach der Kernteilung (Mitose) erfolgt durch Neusynthese im ER. Die Kernporen können laut neusten Untersuchungen offenbar geöffnet und wieder verschlossen werden. So können bestimmte Stoffe den Kern selektiv verlassen, bzw. in ihn eindringen. Jahrgangsstufe 11 EM-Bild der Zelle: Kompartimentierung, Zellorganellen Arbeitsblatt Z2 Reise in die große kleine Welt der Zelle – Das EM-Bild der Zelle Die Zellorganellen – Zellkern Sie sind Experte für das Zellorganell Zellkern. Auf einer Tagung stellen Sie anderen Wissenschaftlern, die vorher noch nie von diesem Zellorganell gehört haben, Ihr Zellorganell vor. Abb.: Zellkern (Nucleus): A, EM-Bild; B, Schema (räumlich) Aufgabe 1: Überlegen Sie sich mit den anderen Experten in Ihrer Runde, welche Eigenschaften des Zellorganells mitteilenswert sind und notieren Sie diese. Verwenden Sie als Informationsquelle das Informationsblatt Z1. Aufgabe 2: Beschriften Sie anhand des Informationsblattes Z1 die oben angegebene Abbildung. Aufgabe 3: Halten Sie einen kurzen Vortrag über die Eigenschaften des Zellorganells, so dass sich Ihre Zuhörer Notizen zu Ihrem Vortrag machen können. Jahrgangsstufe 11 EM-Bild der Zelle: Kompartimentierung, Zellorganellen Arbeitsblatt Z3 Reise in die große kleine Welt der Zelle – Das EM-Bild der Zelle Die Zellorganellen – Zellkern Aufgabe: Fertigen Sie einen Steckbrief des Zellkerns an! Hören Sie sich den Vortrag des Experten an und machen Sie sich Notizen zu den vom Experten vorgetragenen Eigenschaften. Abb.: Zellkern (Nucleus): A, EM-Bild; B, Schema (räumlich) Jahrgangsstufe 11 EM-Bild der Zelle: Kompartimentierung, Zellorganellen Informationsblatt MT1 Reise in die große kleine Welt der Zelle – Das EM-Bild der Zelle Die Zellorganellen – Mikrotubuli Zellen ohne Zellwand (z. B. tierische Gewebezellen wie die Mundschleimhaut, unbewandete Einzeller) würden sich abkugeln, um eine möglichst kleine Oberfläche zu erlangen. Nun sind aber weder Gewebezellen noch Einzeller kugelförmig. Abweichungen von der Kugelform sind nur möglich durch aussteifende Strukturen außerhalb der Zellmembran (durch die Zellwand) und/oder durch ein Skelett innerhalb der Zelle. Diese Versteifungen innerhalb einer Zelle (intrazellulär) nennt man Cytoskelett. Das Cytoskelett wird nicht von einer Membran umgeben. Sowohl die Form als auch die Motilität (Beweglichkeit) einer Zelle wird hauptsächlich durch das Cytoskelett bestimmt. Es können drei Typen fadenförmiger Stiele (Filamente) unterschieden werden: Actinfilamente und Mikrotubuli, die der Motilität dienen, sowie intermediäre Filamente. Actinfilamente (Mikrofilamente) bestehen vorwiegend aus dem Protein Actin und sind ca. 6nm dick. Actinfilamente bauen z.B. als Stützelement die Mikrovilli in den Saumzellen der Darmwand auf. Intermediäre Filamente können aus verschiedenen Proteinen aufgebaut sein. Zu ihnen gehört das Keratin, das den Haaren in hohem Gehalt vorhanden ist. Sie haben einen Durchmesser von etwa 10nm und liegen damit zwischen den Actinfilamenten und den Mikrotubuli, die ihrerseits einen Durchmesser von 25nm besitzen. Bau von Mikrotubuli. Sie sind röhrenförmige Filamente des Cytoskeletts. Sie bilden den Spindelapparat, der bei der Zellteilung die zuvor verdoppelten Chromosomen in die beiden neuen Zellen zu ziehen. Sie sind also einerseits für den intrazellulären Transport von Partikeln verantwortlich und bilden die Bauelemente von Cilien oder Flagellen (Geißeln), die die Fortbewegung der Zellen dienen. Die Mikrotubuli sind aus Tubulin aufgebaut, einem Protein, das zu röhrenförmigen Filamenten aufgebaut und verlängert wird (polymerisiert). Die beiden Enden der Filamente unterscheiden sich dadurch, dass an einem Ende die Tubuline angebaut (polymerisiert) und am anderen Ende abgebaut (depolymerisiert) werden. Die Mikrotubuli werden von Organisationszentren (Centriole) gebildet. Jahrgangsstufe 11 EM-Bild der Zelle: Kompartimentierung, Zellorganellen Arbeitsblatt MT2 Reise in die große kleine Welt der Zelle – Das EM-Bild der Zelle Die Zellorganellen – Mikrotubuli Sie sind Experte für das Zellorganell Mikrotubuli. Auf einer Tagung stellen Sie anderen Wissenschaftlern, die vorher noch nie von diesem Zellorganell gehört haben, Ihr Zellorganell vor. Abb.: Mikrotubuli; A, EM-Bild; B, Schema (räumlich) Aufgabe 1: Überlegen Sie sich mit den anderen Experten in Ihrer Runde, welche Eigenschaften des Zellorganells mitteilenswert sind und notieren Sie diese. Verwenden Sie als Informationsquelle das Informationsblatt MT1. Aufgabe 2: Beschriften Sie anhand des Informationsblattes MT1 die oben angegebene Abbildung. Aufgabe 3: Halten Sie einen kurzen Vortrag über die Eigenschaften des Zellorganells, so dass sich Ihre Zuhörer Notizen zu Ihrem Vortrag machen können. Jahrgangsstufe 11 EM-Bild der Zelle: Kompartimentierung, Zellorganellen Arbeitsblatt MT3 Reise in die große kleine Welt der Zelle – Das EM-Bild der Zelle Die Zellorganellen – Mikrotubuli Aufgabe: Fertigen Sie einen Steckbrief der Mikrotubuli an! Hören Sie sich den Vortrag des Experten an und machen Sie sich Notizen zu den vom Experten vorgetragenen Eigenschaften. Abb.: Mikrotubuli; A, EM-Bild; B, Schema (räumlich) Jahrgangsstufe 11 EM-Bild der Zelle: Kompartimentierung, Zellorganellen Arbeitsblatt ZW 1 Struktur und Funktion der Zellwand Zellwände sind wie Chloroplasten typisch für alle grüne Pflanzen. Die Zellwand umgibt die Zelle auf der Außenseite, liegt also der Zellmembran auf. Sie wird vom Cytoplasma gebildet und besteht bei jungen Zellen (primäre Zellwand) zu 90% aus Kohlenhydraten (Cellulose, Hemicellulosen und Pektin) und zu 10% aus Protein. Während der Differenzierung wird eine zweite, sekundäre Wand aufgelegt, die aus Cellulose und Lignin (Holz) besteht. Zwischen Primär-und Sekundärwand liegt eine Mittellamelle mit kleinen Poren (Plasmodesmen). Die Primärwand ist wasserdurchlässig. „Die Zellwand dient dem Schutz und vor allem der Festigung der Protoplasten [1]. Noch vor 20 Jahren beschrieb der „STRASBURGER, das Lehrbuch für Botanik an Hochschulen, die Wände der Pflanzenzellen als starre, passive Cellulosegebilde, deren einzige Aufgabe es ist, dem Inneren der Zelle mechanische Stabilität zu verleihen. Dass das „tote Abscheidungsprodukt des Protoplasten eine sehr komplexe, dynamische und mit vielen Funktionen ausgestattete Struktur ist [2], hat man erst in den letzten Jahren herausgefunden. Diese neuen Erkenntnisse wurden bei der 8. Internationalen Zellwandkonferenz in Norwich (England) dargestellt und von EVELYN STRAUSS zusammengefasst [3]. Es hat sich gezeigt, dass die Zellwand das Schicksal der Zellen aktiv bestimmt. Sie enthält Kohlenhydrate und Proteine, die als Botenstoffe Signale zwischen den Zellen übermitteln können. () Die Bedeutung der Zellwand für das Auslösen von Abwehrreaktionen nach dem Befall mit Mikroorganismen [4] war schon bekannt, als man entdeckte, dass die Zellwände auch die normale Entwicklung gesunder Pflanzen regulieren können. RALPH QUATRANO und seine Mitarbeiter (Washington University, St. Louis, Mo./USA) untersuchten Embryonen der Braunalge Fucus. Dabei bemerkten sie, dass man das Rhizoidwachstum1 von Embryonen, deren Zellwände enzymatisch entfernt worden waren, durch Lichtbehandlung in eine neue Richtung lenken konnte. Offensichtlich gehen von der Zellwand Signale aus, die zum Ausrichten des Wurzelwachstums benötigt werden. Dieses Ergebnis wurde von der Arbeitsgruppe um FRED BERGER (Marine Biological Association, Plymouth, GB) ergänzt, die zweizellige Fucus-Embryonen für ihre Untersuchungen verwendete. In diesem Stadium ist bereits festgelegt, dass sich eine Zelle zum Rhizoid entwickelt, während die andere zu dem Phylloid2 der Alge heranwächst. Im Experiment wurde der Zellinhalt der rhizoidbildenden Zelle entfernt. Die andere Zelle, die zur Bildung des Phylloids bestimmt war, wurde mit der anhaftenden leeren Zellwand weiterkultiviert. Die Zelle teilte sich, bis die Zellwände ihrer Tochterzellen die leere Rhizoidzellwand berührten. Daraufhin wechselten diese Phylloid-Zellen ihre Identität und reiften zu Rhizoidzellen heran. Folgeexperimente bestätigten, dass die leere Zellwand tatsächlich durch den Kontakt die Differenzierung ihrer Nachbarzellen bestimmen konnte. Auch wenn die Zellen bereits zur Bildung von Rhizoid oder Phylloid bestimmt waren, konnten sie sich nach Entfernen der Zellwand zu dem jeweils anderen Zelltyp entwickeln. Ohne Zellwand waren sie wie Zygotenzellen totipotent3. Daher nahm man an, dass nicht die Embryozelle, sondern ihre Zellwand signalisiert, zu welchem Zelltyp sie sich entwickeln soll. FRED BERGER hat seine Untersuchungen mit der als Modellorganismus bekannten Ackerschmalwand (Arabidopsis) weitergeführt. In der Wurzel dieser Blütenpflanze sind Epidermiszellen als äußere Schicht über den inneren Wurzelzellen angeordnet. Dabei sind nur diejenigen Epidermiszellen in der Lage, Wurzelhaare zu bilden, die sich über der Kontaktstelle zweier innerer Zellen befinden. Die Arbeitsgruppe um BERGER konnte nachweisen, dass es tatsächlich diese spezielle Position ist, die bestimmt, dass sich die betreffende Epidermiszelle zum Wurzelhaar differenziert. Wurden die darunter liegenden inneren Zellen abgetötet, sodass nur deren Zellwände übrig blieben, waren die Epidermiszellen weiterhin zur Wurzelhaarbildung fähig. Daher sind die Zellwände die Signalgeber für die Wurzelhaardifferenzierung. Möglicherweise variiert die Zusammensetzung der Zellwand und bildet so ein bestimmtes Muster von Signalmolekülen, das die Identität der Nachbarzellen oder die der betreffenden Zelle selbst beeinflusst. () 1 Rhizoid: wurzelähnliche Struktur bei Algen Phylloid: blattähnliche Struktur bei Algen 3 Totipotent: Zustand in welchem sich Zellen zu jedem Typ Zelle entwickeln können. 2 Jahrgangsstufe 11 EM-Bild der Zelle: Kompartimentierung, Zellorganellen Arbeitsblatt ZW 2 Reise in die große kleine Welt der Zelle – Das EM-Bild der Zelle Die Zellorganellen – Zellwand Sie sind Experte für das Zellorganell Zellwand Auf einer Tagung stellen Sie anderen Wissenschaftlern, die vorher noch nie von diesem Zellorganell gehört haben, Ihr Zellorganell vor. Aufgabe 1: Überlegen Sie sich mit den anderen Experten in Ihrer Runde, welche Eigenschaften des Zellorganells mitteilenswert sind und notieren Sie diese. Verwenden Sie als Informationsquelle das Informationsblatt ZW1. Erläutern Sie, weshalb man davon abgekommen ist, die Zellwand nur als totes Abscheidungsprodukt zu sehen. Nennen Sie den entscheidenden Schritt, mit dem nachgewiesen werden konnte, dass tatsächlich der Zellwand die Signalgeber-Funktionen zukomme. Aufgabe 2: Erstellen Sie eine Übersicht über die heute bekannten Funktionen der Zellwand und beschriften Sie anhand des Informationsblattes ZW1 die unten angegebene Abbildung. Funktionen der Zellwand: Aufgabe 3: Halten Sie einen kurzen Vortrag über die Eigenschaften des Zellorganells, so dass sich Ihre Zuhörer Notizen zu Ihrem Vortrag machen können. Jahrgangsstufe 11 EM-Bild der Zelle: Kompartimentierung, Zellorganellen Arbeitsblatt ZW 3 Reise in die große kleine Welt der Zelle – Das EM-Bild der Zelle Die Zellorganellen – Die Zellwand Aufgabe: Fertigen Sie einen Steckbrief der Zellwand an! Hören Sie sich den Vortrag des Experten an und machen Sie sich Notizen zu den vom Experten vorgetragenen Eigenschaften.