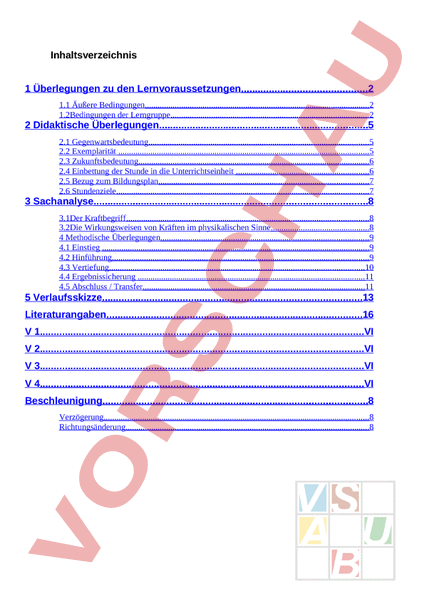Arbeitsblatt: Einführung in den Kraftbegriff
Material-Details
Es handelt sich um einen ausführlichen U-Entwurf + Versuchsbeschreibungen und AB im Rahmen eines UB, der ganz gut gelaufen ist.
Physik
Anderes Thema
7. Schuljahr
24 Seiten
Statistik
52192
924
14
08.01.2010
Autor/in
katikap (Spitzname)
Land: Deutschland
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Inhaltsverzeichnis 1 Überlegungen zu den Lernvoraussetzungen.2 1.1 Äußere Bedingungen.2 1.2Bedingungen der Lerngruppe.2 2 Didaktische Überlegungen.5 2.1 Gegenwartsbedeutung.5 2.2 Exemplarität .5 2.3 Zukunftsbedeutung6 2.4 Einbettung der Stunde in die Unterrichtseinheit 6 2.5 Bezug zum Bildungsplan7 2.6 Stundenziele7 3 Sachanalyse8 3.1Der Kraftbegriff.8 3.2Die Wirkungsweisen von Kräften im physikalischen Sinne8 4 Methodische Überlegungen.9 4.1 Einstieg .9 4.2 Hinführung9 4.3 Vertiefung.10 4.4 Ergebnissicherung 11 4.5 Abschluss Transfer11 5 Verlaufsskizze.13 Literaturangaben16 1VI 2VI 3VI 4VI Beschleunigung.8 Verzögerung8 Richtungsänderung8 1 Überlegungen zu den Lernvoraussetzungen 1.1 Äußere Bedingungen Für den Fächerverbund MNT sind zwei Fachräume vorhanden, die nach den Schwerpunkten Biologie/Chemie und Physik aufgeteilt sind. Beide werden in den Sommerferien saniert und neu ausgestattet. Der Unterricht findet in dieser Stunde im „Physikraum statt, der mit einer Tafel, einem Tageslichtprojektor, einer Leinwand über der Tafel im vorderen Bereich und mit Materialschränken im hinteren Teil des Zimmers bestückt ist. Die Arbeitsplätze der Schüler verfügen über einen Stromanschluss. Wasser- und Gasanschlüsse sind in diesem Raum nicht angebracht. Die reihenförmig angeordnete Sitzordnung lässt sich nicht umstellen. Lediglich die Drehstühle können nach Bedarf in der Höhe variiert werden. Dies sorgt zu Beginn des Unterrichts häufig für Unruhe und es dauert einen Moment, bis alle Schüler ihre jeweilige Sitzhöhe erlangt haben und aufmerksam sein können. Die Gruppenbildung im Fachraum folgt der Regel, dass sich jeweils zwei Schüler aus den vorderen Reihen umdrehen und mit den hinter ihnen sitzenden Kindern eine 4er-Gruppe bilden. Das Beenden von Arbeitsphasen wird durch ein akustisches Signal angezeigt, welches dreimal erklingt. Zweimal Klingeln bedeutet, dass ich etwas sagen möchte und die Aufmerksamkeit aller dazu benötige. Ertönt der Klang nur einmal, werden die Kinder aufgefordert, den Flüsterton einzuhalten. Die Schulglocke der Zeppelinschule zeigt jeweils den Beginn der Folgestunde an. 1.2 Bedingungen der Lerngruppe Entwicklungspsychologische Voraussetzungen Die Schüler der 7. Klassenstufe sind in der Regel zwischen 13 und 15 Jahre alt. In diesem Alter sind sie verstärkt mit sich selbst, ihrer Identität und dem Aufbau ihres persönlichen Selbstkonzepts beschäftigt (vgl. Oerter, Montada 2002, S. 258-271). Dadurch erhöht sich ihre Sensibilität nach außen und in Bezug auf ihre eigenen Fähigkeiten. Gerade im Hauptschulbereich sind daher Lernarrangements zu setzen, die Erfolgserlebnisse fördern. So benötigen die Schüler einen Lernzugang, der sie emotional anspricht, motiviert und sie nicht über- oder unterfordert. Zusammensetzung der Lerngruppe Insgesamt besuchen 25 Schüler die Klasse. Sie setzt sich aus 11 Mädchen und 14 Jungen zusammen. Der Anteil fremder Nationalitäten beträgt mit 12 Schülern ca. 50 %. Ein Großteil der Kinder mit Migrationshintergrund ist jedoch in Deutschland geboren. Es bestehen somit keine gravierenden Verständigungsschwierigkeiten. Kurz nach dem Halbjahr ist eine neue Schülerin .hinzugekommen. Sie hat sich ohne besondere Schwierigkeiten in die Klassengemeinschaft integriert. Im Allgemeinen zeigt die Klasse ein ausgesprochen gutes Sozialverhalten. Dies ist mitunter auch darauf zurückzuführen, dass sie zur Stärkung ihrer sozialen Fähigkeiten mit Sozialtrainings und Klassenratssitzungen immer wieder gefördert und unterstützt werden. So befinden sich nur wenige Schüler in einer Außenseiterrolle. Hierzu gehört beispielsweise., die sich nicht immer problemlos in Gruppen eingliedern kann. Daher ist sie für eine Zusammenarbeit auch bei ihren Mitschülern nicht sehr beliebt. Des Weiteren zählen . und . zum Einzelgängertypus. Auch sie können nicht mit allen Klassenkameraden ein Team bilden. Bei längeren Phasen der Gruppenarbeit ist dieser Aspekt sicherlich zu beachten. Allerdings befürworte ich hinsichtlich der Erweiterung von sozialen Kompetenzen trotzdem, dass die Schüler in kurzfristigen Arbeitsphasen für jede Gruppenzusammensetzung aufgeschlossen und flexibel bleiben. Im Fachraum richtet sich die Gruppenbildung nach den bereits erwähnten Regeln. Diese sind der Lerngruppe bekannt und werden allseitig akzeptiert. Die gesamte Klasse ist sehr lebendig und aufgeweckt. Viele Schüler denken oft laut im Unterricht mit. Teilweise bringen sie deshalb ihre Beiträge einfach unaufgefordert ohne Handmeldung ins Plenum. Besonders in Gruppenarbeitsphasen oder bei Versuchen erhöht sich zeitweise der Lärmpegel. . und . gehören zu den Jugendlichen, die Verhaltensauffälligkeiten zeigen und den Unterricht durch unangemessene Bemerkungen gerne stören. Den Fall einer solchen vorsätzlichen und wiederholten Störung werde ich durch das Notieren der jeweiligen Namen an der Tafel anzeigen. In der Klasse wird darüber eine Strichliste geführt. Bei einer Ansammlung von 10 Strichen erfolgt eine „besondere Fördermaßnahme (BFM). Dies bedeutet zusätzliche Arbeitszeit für die Kinder an einem Nachmittag. Bei gravierenden Regelverstößen schließt eine Trainingsraumermahnung an. Erfolgt diese ein weiteres Mal, verlässt der Schüler den Raum und reflektiert sein Verhalten mit einem Lehrer im Trainingsraum. Insgesamt ist die 7a jedoch eine sehr freundliche, nette und interessierte Klasse. Ich gehe daher davon aus, dass ich die erwähnten Maßnahmen nicht ergreifen muss. Lern- und Leistungsstand (Vorkenntnisse, Methodenkompetenz) Aufgrund der Suchtpräventionstage vor den Pfingstferien, bzw. einer projektorientierten Arbeit der Schüler zum Thema „Lebewesen im Wasser nach den Ferien, fand der MNT-Unterricht in letzter Zeit sehr selten im Fachraum statt. Die Regeln zur Arbeitsweise und zum Verhalten während Versuchsdurchführungen sind der Klasse bekannt. Neuen Unterrichtsinhalten steht die Lerngruppe meist offen und lernwillig gegenüber. Mit physikalischen Themenbereichen ist sie allerdings noch nicht vertraut. Es können daher keine detaillierte Angaben zu Interessenslagen und Stärken einzelner Schüler gemacht werden. Dennoch kann angenommen werden, dass physikalische Themen vorwiegend die Interessen der Jungen ansprechen. Bislang habe ich im MNT-Unterricht beobachtet, dass die Schüler sehr aufmerksam sind, wenn es um Demonstrationsversuche geht und auch gerne Versuche nach Versuchsanleitungen durchführen. Daher steht auch in dieser Stunde eine handelnde Auseinandersetzung mit dem physikalischen Kraft-Wirkungs-Begriff im Vordergrund. Die Arbeitsatmosphäre in der Klasse ist überwiegend von Leistungs- und Konzentrationsbereitschaft geprägt. Hinsichtlich des Auffassungsvermögens, der Arbeitstempi und ihrer Leistungen sind die Schüler jedoch sehr heterogen. Starke Konzentrations- und Leistungsschwächen sowie Trägheit und Unlust lassen sich bei einigen Kindern beobachten. Zu den leistungsschwächeren Schülern gehören beispielsweise Melih und Jeff. Diese werden evtl. mehr Hilfestellungen benötigen. Für andere Schüler, der Motivation Aufrechterhaltung wie Tim durch und einen Meriton, zählt emotionalen eher Bezug die zum Lerngegenstand. Andererseits gibt es in der Klasse auch eine Reihe wissbegieriger Kinder mit schneller Auffassungsgabe. Für diese Gruppe bedarf es erweiterten Aufgabenstellungen. 2 Didaktische Überlegungen 2.1 Gegenwartsbedeutung Aus entwicklungspsychologischer Sicht ist gerade für die 13 bis 15-jährigen Schüler zunächst einmal das Kräfte messen untereinander ein zentrales Thema. Ihr Alltagsverständnis zum Kraftbegriff ist daher sehr vielseitig. So werden in diesem Zusammenhang die Begriffe „Kraft und „Stärke von den Jugendlichen meist gleichgesetzt. Wie bereits erwähnt, ist auch davon auszugehen, dass sich thematisch primär die Jungen angesprochen fühlen. Dennoch zeigt sich, dass sowohl Jungen als auch Mädchen in dieser Altersgruppe verstärkt körperliche Kräfte ausüben und testen. Es geht darum, sich selbst und die eigenen Fähigkeiten zu entdecken, bzw. diese einzuordnen. Hierzu gehört auch der Wettkampfcharakter bei sportlichen Aktivitäten, der für die Jugendlichen zum Krafteinsatz einen besonderen Anreiz bietet. Bei jeglicher sportlichen Betätigung im Alltag der Jugendlichen spielt die unterschiedliche Wirkung mehrerer Kräfte eine wichtige Rolle. Sei es beim Fahrrad- oder Skateboard fahren sowie beim Fußballoder Handball spielen, um nur einige wenige Beispiele aus dem Interessensgebiet der Lerngruppe zu nennen. Die Schüler werden unbewusst überall mit physikalischen Kräften und ihren Wirkungen konfrontiert, da diese stets in alltäglichen Situationen vorkommen. 2.2 Exemplarität Aufgrund der oben genannten Gleichsetzung der Begriffe „Kraft und „Stärke gilt es zunächst, die Lerngruppe für den physikalischen Kraftbegriff zu sensibilisieren. Dafür bietet es sich an, vom Alltagsverständnis der Schüler auszugehen. Da die Muskelkraft für die Jugendlichen derzeit die größte Bedeutung trägt, eignet sie sich besonders, um zielführend in das Thema einzusteigen. So kann am Beispiel eines „Kräftevergleichs unter den Schülern verdeutlicht werden, dass die Kraft selbst nicht sichtbar ist und wir nur die Auswirkung von Kräften erkennen und bewerten können. Um diesen Aspekt und die unterschiedlichen Kräftewirkungen in einer intensiveren Auseinandersetzung bewusst zu machen, ist es sinnvoll, beispielhafte Beobachtungsversuche anzubieten. Diese ermöglichen es, den Kraftwirkungsbegriff handelnd zu erfahren und erleichtern eine Übertragung auf Beispiele aus dem Leben. 2.3 Zukunftsbedeutung Das bewusste Wahrnehmen und Wissen um Kräfte und ihre Wirkungen im physikalischen Sinne stellt auch einen wichtigen Lernfaktor für die Zukunft der Schüler dar. So sieht der Bildungsplan vor, dass die Jugendlichen die goldene Regel der Mechanik ergründen. Hierfür ist das Verständnis des Kraftbegriffs im physikalischen Sinne fundamental, da dieser benötigt wird, um die weiterführenden Begriffe „Arbeit und „Leistung zu verdeutlichen. Noch immer ist das Handwerk ein wichtiger Berufszweig für Absolventen des Hauptschulabschlusses. Ein Basiswissen zu den physikalischen Begrifflichkeiten und Kraftwirkungen ist für eine solche Berufsorientierung unerlässlich. Des Weiteren verhilft das Verständnis dazu, physikalische Gesetzmäßigkeiten im Alltag zu entschlüsseln und eine Erklärung für diese zu finden. So zeigt es den Jugendlichen Wege auf, wie sie Kräfte und ihre Wirkungsweisen einschätzen können. Das Verständnis für Kraftwirkungen kann beispielsweise dazu verhelfen, Verletzungsgefahren im Straßenverkehr frühzeitig zu erkennen. Dadurch können Risiken besser eingeschätzt und Unfälle vermieden werden. Außerdem bietet das Kraftwirkungsverständnis Handlungsmöglichkeiten dafür an, wie man Kräfte sinnvoll nutzen und adäquat im Alltag einzusetzen vermag. 2.4 Einbettung der Stunde in die Unterrichtseinheit Bei vorliegender Unterrichtssequenz handelt es sich um die Einführungsstunde in die thematische Einheit „Kraft und Arbeit. Für das gesamte Themengebiet sind 8 Unterrichtssequenzen inhaltlich wie folgt eingeplant: 1. Sequenz: Wir erkennen Wirkungen von Kräften 2. Sequenz: Welche Kräfte wirken? Wie können wir Kräfte darstellen und messen? 3. Sequenz: Kraft ist ein Zwillingspaar (Wechselwirkung von Kräften) 4. Sequenz: Warum fällt das Fahrrad nicht um? (Das Kräfteparallelogramm) 5. Sequenz: Was ist Arbeit? 6. Sequenz: Wie können wir Kraft sparen und Arbeit erleichtern? (Goldene Regel der Mechanik Hebelgesetze) 7. Sequenz: Wie können wir Kraft sparen und Arbeit erleichtern? (Goldene Regel der Mechanik die schiefe Ebene) 8. Sequenz: Wie können wir Kraft sparen und Arbeit erleichtern? (Goldene Regel der Mechanik der Flaschenzug) 2.5 Bezug zum Bildungsplan In den Leitgedanken zum Kompetenzerwerb des Bildungsplans Baden-Württemberg wird die Verzahnung zwischen „praktisch handelnder Erarbeitung und reflektierter Auseinandersetzung (Ministerium für Jugend, Kultur und Sport Baden-Württemberg 2004, S. 54) als wesentliches Prinzip für den Unterricht aufgeführt. Um ein bewusstes und differenziertes Verhältnis der Schüler zu ihrer technischen Welt zu fördern, möchte ich dieses Prinzip aufgreifen. Personale und soziale Kompetenzen sollen über die Gruppenarbeitsphase in gegenwärtiger Stunde gefördert werden. Des Weiteren üben die Schüler methodische Kompetenzen anhand der Durchführung von Beobachtungsversuche und Beschreibungen ein. Im Folgenden werde ich die anzubahnenden fachlichen Kompetenzen im Hinblick auf die Stundenziele wiedergeben und kurz erläutern. Kompetenzen im Fachbereich MNT: Die Schülerinnen und Schüler können . Kräfte an ihrer Wirkung erkennen. Kräfte im physikalischen Sinne definieren. (Die Schüler erfahren handelnd die Wirkungsweisen von Kräften und übertragen diese Kenntnisse auf Beispiele aus dem Alltag). Kompetenzen im Fach Deutsch: Die Schülerinnen und Schüler können . Texte verstehen und zentrale Aussagen erschließen. (Die Schüler können sich die Versuchsanleitungen selbstständig erschließen und die Versuche danach umsetzen) (vgl. Ministerium für Jugend, Kultur und Sport Baden-Württemberg 2004, S. ff). 2.6 Stundenziele Die Schülerinnen und Schüler erkennen physikalische Kräfte an ihren Wirkungen. führen Versuche nach Anleitung durch und beobachten dabei unterschiedliche Wirkungsweisen von Kräften. notieren ihre Beobachtungen und geben sie wieder. erkennen Wirkungsweisen von Kräften an Bildern und ordnen diese den Fachbegriffen zu. 3 Sachanalyse 3.1 Der Kraftbegriff Aufgrund unseres Alltagsverständnisses sprechen wir in unterschiedlichen Zusammenhängen und Bedeutungen von Kräften. So ist beispielsweise von einer Sehkraft, Urteilskraft oder einer inneren Kraft die Rede, die man „haben kann. Der englische Physiker Isaac Newton formulierte 1687 Gesetze der Mechanik und löste durch seine Begriffsbildung den Kraftbegriff aus der Umgangssprache heraus. Im physikalischen Sinne ist „Kraft daher eine gerichtete Größe mit Betrag, Stärke und Richtung. Sie kann Bewegungen oder Verformungen von Körpern verursachen. „Kräfte können wir nach diesem Verständnis weder haben, besitzen oder sehen. Wir erkennen lediglich, ob sie auf Körper oder Gegenstände eingewirkt haben. Die Einheit der Kraft ist Newton und das (vom frz./engl. „force Macht/Stärke abgeleitet) steht für ihr Formelzeichen. (vgl. www.wikipedia.de, abgerufen am 02.06.2009). 3.2 Die Wirkungsweisen von Kräften im physikalischen Sinne Kräfte erkennt man an unterschiedlichen Wirkungen. Um die Richtung der Wirkung aufzuzeigen, werden in der Physik Kraftpfeile gezeichnet. Kräfte können entweder die Bewegungszustände oder die Form von Körpern verändern. Es werden dabei folgende Wirkungsresultate unterschieden: Ein ruhender Körper wird in Bewegung gesetzt. Die Kraft zeigt in die gleiche Richtung wie die Bewegungsrichtung des Körpers, auf den sie wirkt und beschleunigt ihn ( Beschleunigung). Die Geschwindigkeit eines in Bewegung gesetzten Körpers vermindert sich. Die Kraft wirkt entgegen der Bewegungsrichtung und bremst ihn ab ( Verzögerung). Ein in Bewegung gesetzter Körper ändert aufgrund der Krafteinwirkung seine Richtung. Hier stehen Krafteinwirkungen in einem anderen Winkel zur Bewegung ( Richtungsänderung). Werkstoffe besitzen die Fähigkeit, ihre Verformung rückgängig zu machen, sobald die einwirkende Kraft wegfällt ( Elastizität). Ein Werkstoff behält seine Form nach Krafteinwirkung bei ( Plastizität). Je nach Richtung der wirkenden Kräfte wird der Körper gedehnt, gezerrt oder komprimiert. (vgl. Beck u.a., 1994) 4 Methodische Überlegungen 4.1 Einstieg Um die Einbindung der Schüler in das Unterrichtsgeschehen zu erhöhen, habe ich mich dazu entschlossen, die Einstiegssequenz damit zu eröffnen, zwei Freiwillige der Klasse nach vorn zu bitten. Alternativ wäre auch denkbar gewesen, in das Thema mit Bildern und Oberbegriffen einzusteigen. Allerdings halte ich diese Art und Weise als weniger motivierend, da sie stärker auf die Begrifflichkeiten bezogen ist. Einen höheren emotionalen Zugang zu schaffen, erscheint mir bei dem theoretischen Inhalt der Stunde sinnvoller. Ich vermute, dass dieser die Lerngruppe eher zur Auseinandersetzung mit dem Unterrichtsgegenstand aktiviert. Um dem entgegen zu wirken, dass sich Mädchen bei physikalischen Themen nicht so sehr angesprochen fühlen, werde ich darauf achten, dass als Freiwillige beide Geschlechter berücksichtigt sind. Stehen nun die ausgewählten Probanden vor der Klasse, fordere ich die Lerngruppe dazu auf, Vermutungen dazu aufzustellen, wer von den beiden Mitschülern mehr Kraft haben könnte. Die Verwendung des physikalisch nicht ganz korrekten Kraftbegriffs habe ich bewusst gewählt, da ich hiermit am Alltagsverständnis der Jugendlichen ansetzen möchte. Sicherlich äußern die Schüler aufgrund der Frage sämtliche Vermutungen, denen nicht physikalische Kraftvorstellungen zugrunde liegen. Im Anschluss daran bietet es sich an, die Problemstellung ins Bewusstsein der Schüler zu rücken, indem ich darauf verweise, dass wir die genannten Vermutungen nicht sehen können. Eine erste Annäherung an den physikalischen Kraftwirkungsbegriff wird somit angebahnt. 4.2 Hinführung Folglich sollen Überlegungen dazu angestellt werden, wie die Kraft sichtbar gemacht werden kann. Haben die Schüler zunächst eigene Beispiele genannt und damit ihr Vorwissen aktiviert, erhalten die ausgewählten Probanden ein Sportgummiband als Hilfsmittel, um zu zeigen, wer mehr Kraft hat. Eine andere Möglichkeit wäre hier gewesen, den Kräftevergleich der Schüler durch Armdrücken oder Seilziehen umzusetzen. Doch hätte dies sicherlich zu einer größeren Unruhe im Fachraum beigetragen und die Lerngruppe vom Wesentlichen der Stunde zu stark abgelenkt. Zudem stellt das Gummiband eine Art Expanter dar, der sich besser dazu eignet, um die Wirkung von Kräften sichtbar zu machen. Die sichtbare Dehnung des Bandes kann von den Schülern vermutlich besser beschrieben werden als die Wirkungsweisen der anderen Kraftakte. Außerdem bietet es sich an, diesen Aspekt im Zusammenhang mit der Kraftmessung in einer späteren Unterrichtssequenz wieder aufzugreifen. Während des Kräftevergleichs der Probanden bekommen die Mitschüler den Auftrag, ihre Beobachtungen auf den Gegenstand, auf den die Kraft ausgeübt wird, zu richten und diese im Anschluss detailliert zu beschreiben. Ist der Unterschied nicht deutlich zu erkennen, müsste evtl. nachgemessen werden. Bei folgendem Unterrichtsgespräch über die Feststellungen der Schüler ist meinerseits genau darauf zu achten, dass die Schüler die Wirkung der Kraft, nämlich die Dehnung des Gummibandes beschreiben. Gegebenenfalls sind hierbei falsche Annahmen und Formulierungen richtig zu stellen. Um den Aspekt der Wirkung intensiviert hervorzuheben, visualisiere ich diesen in einem Merksatz an der Tafel. Im Anschluss teilt der Austeildienst die Arbeitsblätter aus und die Schüler übertragen den Merksatz zunächst von der Tafel. Ein alternatives Medium zur Visualisierung wäre der Tageslichtprojektor gewesen. Da ich jedoch Wert darauf lege, dass am Ende ein Transfer über eine Bildzuordnung ermöglicht wird, habe ich diese Alternative wieder verworfen. 4.3 Vertiefung Aufgrund der Schwierigkeiten, die der Kraftbegriff für die Lerngruppe mit sich bringt, sollen sich die Jugendlichen zur Vertiefung handelnd mit verschiedenen Kraftwirkungen auseinandersetzen. Sie erhalten Arbeitsaufträge in Form von Versuchsbeschreibungen (s. Anhang). Ihre Beobachtungen zu den einzelnen Versuchen, dokumentieren sie in eigenen Worten auf einem Arbeitsblatt. Für diese Erarbeitung finden sich die Schüler in Gruppen zusammen, die sich aus der Sitzordnung ergeben. Jede Gruppe führt dieselben Versuche durch. Eine alternative Art der Erarbeitung wäre gewesen, arbeitsteilige Gruppen zu bilden. Ich habe mich allerdings dagegen entschieden, da ich es als wichtig erachte, dass jede Gruppe die Möglichkeit erhält, alle Kraftwirkungen selbst zu beobachten und sich darüber untereinander auszutauschen. Die Arbeitsphase möchte ich insofern unterstützen, dass ich beobachte, wie die Schüler an die Versuchsdurchführungen herangehen und welche Probleme dabei entstehen. So kann ich ihnen impulsgebend zur Seite stehen, wenn es notwendig wird. Als Hilfestellung für leistungsschwächere Kinder halte ich Fragesätze bereit, die Hinweise zu den wichtigsten Beobachtungsaspekten geben. Anhand einer Zeituhr wird an der Tafel die vorgegebene Arbeitszeit sowie die verbleibende Zeit im 5-Minuten-Takt visualisiert. Für den Fall, dass manche Gruppen schneller gearbeitet haben, stehen Differenzierungsaufgaben zur weiteren Vertiefung und Auseinandersetzung mit der Kraftwirkung zur Verfügung. Dabei handelt es sich um Aufgaben, die in Form einer Losziehung angeboten werden und folgende Möglichkeiten beinhalten. 1) Die Schüler planen andere Versuche, an denen die beobachteten Kraftwirkungen ebenfalls festgestellt werden können. 2) Die Schüler beschreiben Beispiele aus ihrem Leben, die die beobachteten Kraftwirkungen aufweisen. Die Arbeitsphase wird durch ein akustisches Signal beendet. 4.4 Ergebnissicherung Die Ergebnisse aus den Beobachtungen der Jugendlichen bei den durchgeführten Versuchen müssen nun aufgegriffen und wenn nötig, richtig gestellt werden. Um Fehler zu vermeiden und die Arbeit der Jugendlichen zu würdigen, notiere ich stichwortartig die Beiträge einzelner Lerngruppen an der Tafel. Damit ist die Grundlage geschaffen, um auf die Fachbegriffe hinzuweisen, die auf dem Arbeitsblatt der Schüler in Form von Überschriftenfeldern bereits angedeutet werden. Diese sollen in einem gelenkten Lehrer-Schüler-Gespräch teilweise selbst genannt und als Begriffskarten den Versuchen zugeordnet werden. Es entsteht ein Tafelbild, das die Schüler auf ihr Arbeitsblatt übertragen (s. Anhang). An dieser Stelle möchte ich gezielt den Anteil der etwas schwächeren Schüler am Unterrichtsgeschehen erhöhen. Dazu erhalten sie die Aufträge, erarbeitete Fachbegriffe an der Tafel aufzudecken und vorzulesen. Eine alternative Ergebnissicherung hätte dadurch erfolgen können, dass die Schüler ihre Versuchsbeobachtungen vorstellen und selbst an der Tafel verschriftlichen. Aufgrund der knapp bemessenen Zeit und weil ich Wert auf eine abschließende Transfergelegenheit lege, habe ich diese Idee nicht weiter verfolgt. 4.5 Abschluss Transfer Gruppen, die schnell gearbeitet und bereits Beispiele aus ihrer Lebenswelt gefunden haben, erhalten zunächst Gelegenheit, ihre Ergebnisse mündlich vorzutragen. Daran anschließend zeige ich Bilder mit Beispielen aus der Lebenswelt der Schüler. Diese sollen je nach Kraftwirkung den einzelnen Versuchen zugeordnet und in das Tafelbild integriert werden. Hierbei ist zu beachten und anzuregen, dass sich auch mehrere Kraftwirkungen in einem Bild verstecken können. Außerdem muss darauf Wert gelegt werden, dass die Schüler ihre Meinungen begründen und in ganzen Sätzen wiedergeben. Die Transferleistungen, die anhand dieser Vorgehensweise erforderlich sind, halte ich für unabdingbar, um ein tieferes Verständnis für den Kraftwirkungsbegriff zu fördern. Da ich davon ausgehe, dass die Zeit für eine ausführliche Besprechung der Beispiele nicht mehr ausreichen wird, werde ich diese Phase in der nächsten Stunde fortführen, bevor wir thematisch weitergehen. Die Schüler erhalten die Hausaufgabe, sich gezielt in ihrer Umgebung zwei Beispiele für die Kraftwirkungen zu überlegen, die sie jetzt kennen gelernt haben. Diese sollen sie zu Beginn der nächsten Stunde kurz beschreiben oder anhand eigener Bilder zeigen. 5 Verlaufsskizze Thema: „Wir erkennen Wirkungen von physikalischen Kräften Ziele der Unterrichtssequenz: Die SuS. erkennen physikalische Kräfte an ihren Wirkungen. führen Versuche nach Anleitung durch und beobachten dabei unterschiedliche Wirkungsweisen von Kräften. notieren ihre Beobachtungen und geben sie wieder. erkennen Wirkungsweisen von Kräften an Bildern und ordnen diese den Fachbegriffen zu. Zeit/Phasen 10.40 Uhr – 10.45 Uhr Begrüßung Einstieg Lehrer- Schülerinteraktion LA: begrüßt SuS begrüßt die Gäste und stellt sie vor. LA bittet zwei freiwillige S. zu sich vor und stellt die Frage: „Mich würde interessieren, wer von den beiden mehr Kraft hat? S. äußern ihre Vermutungen dazu. LA: „Wer hat Recht? Können wir das überprüfen? Medien Sozialform Did.-meth. Kommentar Frontal dient der Motivation S. sind in das U-Geschehen emotional mehr eingebunden Plenum Eine Problemstellung wird angebahnt. Alternativen: Verschiedene Kraftbegriffe zu Oberbegriffen sortieren oder Bildern zuordnen 3-5 Min 10.45 Uhr – 10.50 Uhr Hinführung 5-7 Min S. geben Beispiele dafür, wie die Mitschüler ihre Gummiban Kräfte sichtbar machen könnten. LA gibt ein Gummiband als Hilfsmittel Freiwillige S. ziehen das Gummiband an der OHP markierten Stelle auseinander. S. beobachten und vergleichen die Kraftwirkung am Gummiband und beschreiben diese. LA erläutert anhand der Beobachtungen und Beiträge den physikalischen Kraftwirkungsbegriff und dokumentiert diesen in einem Merksatz. Kompetenzen: Die SuS können . Kräfte an ihrer Wirkung erkennen; Kräfte im physikalischen Sinne definieren. Texte verstehen und zentrale Aussagen erschließen. Plenum Aktivierung des Vorwissens Anbahnung des Verstehensprozesses zum physikalischen Kraftwirkungsbegriff und Visualisierung. Begegnung mit dem Kraftwirkungsbegriff und Fixierung des Besprochenen Alternativen: Seilziehen oder Armdrücken zum Sichtbarmachen der Kraftwirkungen Zeit/Phasen 10.50 Uhr – 11.10 Uhr Vertiefung 15 20 Min 11.10 Uhr – 11.20 Uhr Ergebnissicherung 10 Min 11.20 Uhr 11.25 Uhr Transfer 5 Min Lehrer- Schülerinteraktion LA erteilt Arbeitsauftrag. S. setzen sich handelnd in 5 Versuchen mit dem Kraftwirkungsbegriff auseinander und dokumentieren ihre jeweiligen Beobachtungen auf einem Arbeitsblatt. LA gibt während der Arbeitsphase Hilfestellungen, wenn Gruppen Unterstützung brauchen. Angebote für fertige Gruppen: 1) Andere Versuche planen, bei denen Kraftwirkungen beobachtet werden können 2) Zu den Beobachtungen Beispiele aus dem Alltag finden LA beendet Phase mit akustischem Signal. S. formulieren ihre Beobachtungen zu den jeweiligen Versuchen. LA hält diese an der Tafel fest und erarbeitet mit den S. die physikalischen Fachbegriffe. Medien Sozialform Arbeitsblatt Gruppenarbeit Versuchsbe schreibung en auf Karten S., die bei der Erarbeitung eigene Bsp. gefunden Tafel haben, tragen diese vor. Bilder Im Anschluss finden die S. zu Beispielbildern aus dem Alltag Wirkungsweisen von Kräften heraus und ordnen die Bilder zu. LA gibt HA und Ausblick auf die nächste Stunde S. vertiefen durch handelnde Beobachtungsversuche ihre erste Begegnung mit dem physikalischen Kraftwirkungsbegriff. Alternative: S. erfahren in arbeitsteiligen Gruppen eine bestimmte Kraftwirkung. Materialtisc he für Versuchsm aterialien Tafel Did.-meth. Kommentar und Alternativen Plenum Plenum konkrete Beobachtungen der S. werden gewürdigt und wenn nötig, richtig gestellt. Überleitung zu den abstrakten physikalischen Fachbegriffen. Alternative: Fixierung mit dem TLP. Bilder geben Impulse für die Transferleistung der S. Alternative: S. verschriftlichen ihre Beobachtungen selbst an der Tafel HA: S. sollen Beispiele aus ihrem Alltag finden und in der nächsten Stunde beschreiben. Literaturangaben LITERATUR BECK, Wolfgang u.a. (1994): Einblicke Physik. Regionalausgabe Baden-Württemberg. Hauptschule, 7.-9. Schuljahr, Klett Schulbuchverlag Stuttgart MINISTERIUM für Kulturs, Jugend und Sport Baden Württemberg (2004): Bildungsplan für die Hauptschule; Neckar-Verlag Stuttgart OERTER, Rolf u. MONTADA, Leo (Hrsg.) (2002): Entwicklungspsychologie. Ein Lehrbuch, 5. vollständig überarbeitete Auflage. Weinheim: Beltz Psychologie Verlags Uni INTERNETSEITEN www.wikipedia.de, abgerufen am 2.6.2009 Anlagen 1 Arbeitsblatt 2 Versuchsbeschreibungen 3 Differenzierungsaufgaben 4 Erweiterungsaufgaben 5 Entstehendes Tafelbild Arbeitsblatt Wenn Kraft wirkt, kann sie. Körper oder Gegenstände . Körper oder Gegenstände . Es gibt unterschiedlicheWirkungen. Die Wissenschaftler sagendazu: Hier erkennt man die wirkende Kraft daran, dass. Hier erkennt man die wirkende Kraft daran, dass. Hier erkennt man die wirkende Kraft daran, dass. Hier erkennt man die wirkende Kraft daran, dass. Hier erkennt man die wirkende Kraft daran, dass. Versuchsbeschreibungen Versuchsbeschreibung: Stoßeein Spielzeugauto auf einer geraden Ebenean. Beobachtungsauftrag: • Beobachte, was mit demAuto direkt nach demAnstoß passiert. • Notiere deine Beobachtung auf demArbeitsblatt. Versuchsbeschreibung: Lasseein Spielzeugauto zweimal eine Rampe hinunterrollen. Zuerst auf der glatten Fläche, dann auf demStoffbezug. Beobachtungsauftrag: • Vergleichedie beiden Fahrten. • Notiere, was dir am Auto während Fahrt über den Filzbezug aufgefallen ist. Versuchsbeschreibungen Versuchsbeschreibung: Lasseeine Stahlkugel an einemStab- oder Hufeisenmagneten vorbeirollen. Beobachtungsauftrag: • Wie wirkt die Magnetkraft auf die Kugel? • Beschreibe, was passiert. Versuchsbeschreibung: Nehmeeine Knetkugel und drücke sie zusammen. Beobachtungsauftrag: Beschreibe, was mit der Knetkugel passiert. Versuchsbeschreibungen Versuchsbeschreibung: Nehmeeinen Schwammund drücke ihn zusammen. Beobachtungsauftrag: Beschreibe, was mit dem Schwamm passiert. Differenzierungsaufgaben V1 Bleibt das Auto stehen? V2 Fährt das Auto auf beiden Flächen gleich schnell? V3 Rollt die Kugel am Magneten immer geradeaus? V4 Bleibt die Form der Knete gleich? V5 Ändert sich die Form des Schwammes? Erweiterungsaufgaben Findet ein Beispiel für eine wirkende Kraft aus dem Bereich „Sport. Findet ein Beispiel für eine wirkende Kraft aus dem Bereich „Küche Haushalt. Findet ein Beispiel für eine wirkende Kraft aus dem Bereich „Straßenverkehr. Plant einen Versuch. Er soll eine ähnliche Kraftwirkung zeigen, wie 4. Plant einen Versuch. Er soll eine ähnliche Kraftwirkung zeigen, wie 1. Entstehendes Tafelbild KRAFT können wir nicht sehen. Wir sehen nur ihre WIRKUNG. Wenn Kraft wirkt, kann sie. Körper oder Gegenstände e e e . Körper oder Gegenstände e f r e . Es gibt unterschiedlicheWirkungen. Die Wissenschaftler sagendazu: Beschleunigung Verzögerung Richtungsänderung Dauerhafte vorübergehende Verformung Verformung Hier erkennt man die wirkende Kraft daran, dass. Hier erkennt man die wirkende Kraft daran, dass. Hier erkennt man die wirkende Kraft daran, dass. Hier erkennt man die wirkende Kraft daran, dass. Hier erkennt man die wirkende Kraft daran, dass.