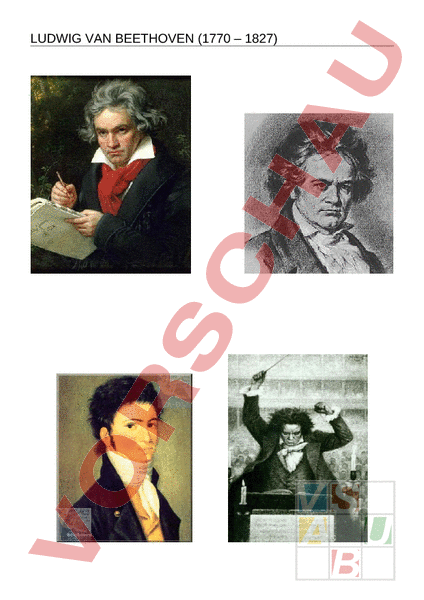Arbeitsblatt: Ludwig van Beethoven: Hintegrundinfo Schwerhörigkeit
Material-Details
Infotext mit Bildern zu Beethovens körperlichen Leiden als Ergänzung zum Thema "Schall"
Biologie
Anatomie / Physiologie
7. Schuljahr
2 Seiten
Statistik
53284
570
1
24.01.2010
Autor/in
Eliane Schweizer
Burgdorf
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770 – 1827) KÖRPERLICHE LEIDEN Ludwig van Beethovens körperliche Leidensgeschichte beschäftigt Wissenschaftler bis heute und führte auch zu medizinischen Spekulationen. Analysen, die das USamerikanische Argonne National Laboratory in Chicago Anfang Dezember 2005 veröffentlicht hat, bestätigen, dass er von Jugend an unter einer schweren Bleivergiftung litt. Das Labor untersuchte einen der von kalifornischen Wissenschaftlern identifizierten Schädelknochen Beethovens mit einem Röntgengerät. Anschließend verglich es die Werte mit einem fremden Schädelfragment aus der damaligen Zeit. Demnach litt der Komponist wahrscheinlich schon vor seinem 20. Lebensjahr massiv unter dem giftigen Einfluss von Blei. Historischen Berichten zufolge traten bei Beethoven in diesem Alter Veränderungen seiner Persönlichkeit zutage. Gleichzeitig begann er, über Magen und Darmbeschwerden zu klagen. Nicht klar ist dagegen, ob auch der Verlust von Beethovens Gehör auf die erhöhten Bleiwerte zurückzuführen ist. Mit etwa 30 Jahren machten sich bei ihm erste Anzeichen einer Otosklerose bemerkbar, die sich unaufhaltsam verschlimmerte. Um sein dadurch schlechter werdendes Hörvermögen auszugleichen, ließ er sein Klavier mit bis zu 4 Saiten bespannen. Bis zum Jahre 1819 war Beethoven völlig ertaubt, so dass er selbst keine Konzerte mehr geben und auch nicht mehr dirigieren konnte. Gespräche führte er mit sogenannten „Konversationsheften, was ausgesprochen mühselig war. Am 29. Juni 1801 schreibt Beethoven an seinen Jugendfreund Franz Gerhard Wegeler: „; nur meine Ohren, die sausen und brausen Tag und Nacht fort. Ich kann sagen, ich bringe mein Leben elend zu; seit zwei Jahren fast meide ich alle Gesellschaften, weils mir nun nicht möglich ist, den Leuten zu sagen: ich bin taub. Hätte ich irgendein anderes Fach, so gings noch eher; aber in meinem Fach ist das ein schrecklicher Zustand Sollte mein Zustand fortdauern, so komme ich künftiges Frühjahr zu Dir: Du mietest mir irgendwo in einer schönen Gegend ein Haus auf dem Lande, und dann will ich ein halbes Jahr ein Bauer werden; vielleicht wirds dadurch geändert. Resignation! Welches elende Zufluchtsmittel, und mir bleibt es doch das einzige übrige. – Durch eine besondere Behandlungsmethode des Wiener Arztes Vering fasst Beethoven wieder Mut und schreibt am 16. November in einem Brief an Wegeler die berühmt gewordenen Sätze: „Ich will dem Schicksal in den Rachen greifen, ganz niederbeugen soll es mich gewiß nicht. – Oh, es ist so schön das Leben tausendmal leben! – Für ein stilles Leben, – nein, ich fühls, ich bin nicht mehr dafür gemacht. – Als seine Schwerhörigkeit, verbunden mit den quälenden Ohrgeräuschen, wieder schlimmer wurde, schrieb er ein Jahr später am 6. Oktober 1802 verzweifelt sein „Heiligenstädter Testament. Dennoch komponierte er in Heiligenstadt die von Lebensfreude und Heiterkeit erfüllte 2. Sinfonie in DDur.