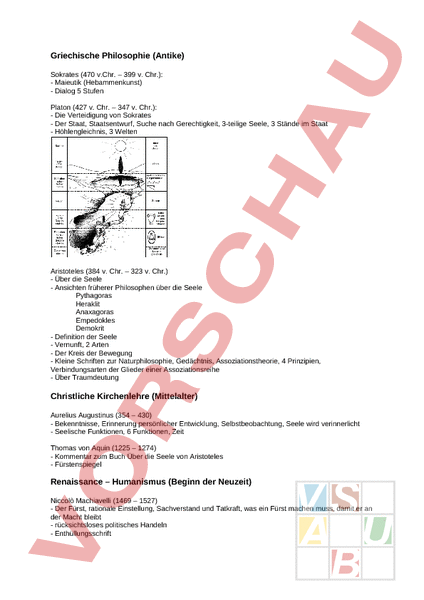Arbeitsblatt: Geschichte der Psychologie
Material-Details
Geschichte der Psychologie
Geschichte
Gemischte Themen
klassenübergreifend
5 Seiten
Statistik
53535
716
0
27.01.2010
Autor/in
romina Gregorini
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Griechische Philosophie (Antike) Sokrates (470 v.Chr. – 399 v. Chr.): Maieutik (Hebammenkunst) Dialog 5 Stufen Platon (427 v. Chr. – 347 v. Chr.): Die Verteidigung von Sokrates Der Staat, Staatsentwurf, Suche nach Gerechtigkeit, 3-teilige Seele, 3 Stände im Staat Höhlengleichnis, 3 Welten Aristoteles (384 v. Chr. – 323 v. Chr.) Über die Seele Ansichten früherer Philosophen über die Seele Pythagoras Heraklit Anaxagoras Empedokles Demokrit Definition der Seele Vernunft, 2 Arten Der Kreis der Bewegung Kleine Schriften zur Naturphilosophie, Gedächtnis, Assoziationstheorie, 4 Prinzipien, Verbindungsarten der Glieder einer Assoziationsreihe Über Traumdeutung Christliche Kirchenlehre (Mittelalter) Aurelius Augustinus (354 – 430) Bekenntnisse, Erinnerung persönlicher Entwicklung, Selbstbeobachtung, Seele wird verinnerlicht Seelische Funktionen, 6 Funktionen, Zeit Thomas von Aquin (1225 – 1274) Kommentar zum Buch Über die Seele von Aristoteles Fürstenspiegel Renaissance – Humanismus (Beginn der Neuzeit) Niccolò Machiavelli (1469 – 1527) Der Fürst, rationale Einstellung, Sachverstand und Tatkraft, was ein Fürst machen muss, damit er an der Macht bleibt rücksichtsloses politisches Handeln Enthüllungsschrift Michel de Montaigne (1533 – 1592) Die Essais Lebenskunst (6 Punkte) unbestechliche Selbstbeobachtung Die Gedankenwaage (5 Punkte), Strukturprinzip, so kann der Verstand funktionieren Französischer Rationalismus (17. Jahrhundert) Vernunft, Beginn der Wissenschaft René Descartes (1596 1663) Über den Menschen, erstmals Reflex Sinnestäuschungen, Vorstellungen sind Illusionen der Träume ich denke, also bin ich Dualismus Julien Offray de la Mettrie (1709 – 1751) erster grosser Seelenforscher Der Mensch eine Maschine, Seelenlehre ohne Seele, Mensch monistisch Britischer Empirismus (17. Jahrhundert) Thomas Hobbes (1588 1679) Anfangsgründe der Philosophie, Körper in der Umgebung, visuelle Wahrnehmung, Mensch ist ein Ego John Locke (1632- 1704) Ein Versuch über den menschlichen Verstand, Erfahrungen, sinnliche Wahrnehmung, Reflexionen Antithese zu Descartes, zu den Rationalisten David Hume (1711 1776) eine Untersuchung über den menschlichen Verstand, Wahrnehmung unterteilt in zwei Arten unterschiedlicher Stärke und Lebendigkeit, Gedanken und Vorstellungen weniger lebhaft, als Sinneseindrücke Assoziationsprinzip, Ähnlichkeit, raum-zeitliche Berührung, Ursache oder Wirkung Methodische Vorschläge, Abwarten von Erfahrung, Trennung von Ursache und Wirkung, Vereinfachungen, Bestimmung der Geltungsbereichs, Vorsicht bei Prognosen Kausalität Deutsche Aufklärung (18. Jahrhundert) am französischen Rationalismus angeknöpft Immanuel Kant (1724 1804) Kritik der reinen Vernunft, Erkenntnis aus zwei Grundquellen: Vorstellungen zu empfangen, durch diese Vorstellungen einen Gegenstand zu erkennen, Erkenntnisse erfolgen priori oder posteriori, Urteile sind analytisch oder synthetisch Arten von Urteilen, analytische Urteile priori, analytische Urteile posteriori, synthetische Urteile priori, synthetische Urteile posteriori In analytischen Urteilen enthält das Prädikat nur, was bereits im Subjekt enthalten ist. Sie sind Urteile priori und vermitteln im strengen Sinne kein neues Wissen. In synthetischen Urteilen enthält das Prädikat immer etwas, was im Subjekt nicht enthalten ist. Damit bringen synthetische Urteile neues Wissen. Synthetische Urteile, die neues Wissen enthalten, das nicht allgemeingültig ist, nennt Kant Urteile posteriori. Ihn interessiert jedoch der Möglichkeit synthetischer Urteile priori, d. h. die Möglichkeit von Urteilen, die allgemeingültiges und zugleich neues Wissen enthalten. Diese Frage diskutiert Kant sowohl für die Mathematik als auch für die reine Naturwissenschaft und die Metaphysik. Christoph Martin Wieland (1733 1813) Geschichte des Agathon, Entwicklungsroman warum scheitert Agathon mehrmals? Karl Philipp Moritz (1756 1793) Anton Reiser, ein psychologischer Roman, mangelndes Selbstvertrauen Adolph Freyherr von Knigge (1752 1795) Über den Umgang mit anderen Menschen, Geltungs- und Wertproblem, geteilte Interessenlage Humanitäre Wissenschaftslehre (18. Jahrhundert) Anschauung der spezifischen Natur des Menschen, um dadurch dessen geistige Natur erfassen zu können, Menschenkenntnis Johann Gottfried Herder (1744 1803) Abhandlung über den Ursprung der Sprache, Menschen schufen Sprache selbst, allen Sinnen liegt Gefühl zugrunde Theorie der Begriffsbildung, Begreifen, Körperhafte Anschaulichkeit, Urteilbildung, Schnelles Sehen, Verlust des Gefühls Johann Wolfgang von Goethe (1749 1832) Die Farbenlehre, ohne Licht keine Farbwahrnehmung, Farben sind Modifikationen des Lichts Wahrnehmungsversuche, Zwei verschiedene Zustände der Retina, Offene Augen in der Finsternis, Augenwendung zur beleuchteten weissen Flächen, Abspannung und Überspannung, Andauern der Zustände, Wiederherstellung der Empfänglichkeit Das Urphänomen, Wahrnehmung von Phänomenen, Exploration des Gegenstandbereichs, Versuch, Weitere Versuche, Vermannigfaltigung der Versuche, Wahrnehmung von Beziehungen, Unterscheidung zwischen notwendigen und zufälligen Bedingungen, Feststellung von Urphänomenen, Feststellung von Modifikationen, Verhältnis von Wissenschaft und Forschungsgegenstand Kritik an Newton Johann Caspar Lavater (1741 1801) Physiognomische Fragmente, Äusseres und Inneres entsprechen sich Georg Christoph Lichtenberg (1742 1799) durch Vernunft gedeutete Empfindung wirkt sich im Traum verstärkt aus Geisteswissenschaftliche Psychologie (19. Jahrhundert) Trennung von geistiger und naturwissenschaftlichen Psychologie Johann Friedrich Herbart (1776 1841) Psychologie als Wissenschaft, erstmals Psychologie als strenge Wissenschaft, Erfahrung Metaphysik und Mathematik, Vorstellungen, Verbindung von Vorstellungen, Hemmung Verdrängung Moritz Lazarus (1824 1903) Völkerpsychologie, das Denken steckt in den Gegenständen und Werkzeugen, das im Werkzeug enthaltene wird zur Norm, Aneignung: bestehendes muss man nicht neu erfinden Hajim (Heymann) Steinthal (1823 1899) Einleitung in die Psychologie und Sprachwissenschaft, das gegenseitige Verständnis ist der geistige Springpunkt der Sprache, Entwicklung der Sprache bei Kindern Wilhelm Dilthey (1833 1911) Ideen über eine beschreibende und zergliedernde Psychologie, geistesw. Psy. verstehend, beschreibend, zergliedert, Strukturgesetz, naturw. Psy. erklärend, Kausalität anhand eigener Erfahrungen und Erlebnisse andere verstehen Die Struktur des Seelenlebens, Äussere Welt, Innere Welt, Wechselwirkung, Einheit, Abgrenzung, Differenzierung Vorgehen der Beschreibenden und zergliedernden Psychologie, Ausgehen vom umfassenden Zusammenhand, Distinguieren einzelner Glieder, Gegenseitige Kompensation der Hilfsmittel, Ergänzung durch fremde Auffassungen, Anschmiegen an den Gegenstand, Psychische Tatsachen Naturwissenschaftliche Entwicklungstheorie (19. Jahrhundert) Industrialisierung an der Konstanz der Arten wird gerüttelt, Biologen und Geologen entdeckten neue Arten, Konflikt mit Kirche Alfred Russel Wallace (1823 1913) Spezies nicht unwandelbar Domestikation ist das was die Arten vorantreibt, so bleiben schwächere Arten erhalten nahe an Darwins Selektionstheorie, künstliche und natürliche Selektion Charles Darwin (1809 1882) ohne Mathematik, aber mit Experimenten und Beobachtungen Entstehung der Arten, natürliche Auslese als wichtigster Mechanismus zur Ausprägung und Erhaltung von Abänderungen Die Selektionstheorie, spontane Variationen, bleibende Veränderungen, Anpassung, bessere Anpassung natürliche Selektion, Wechselbeziehungen, akkumulative Selektion Monismus, kein Dualismus Emotionen, Gefühle basieren auf einer Erkenntnis Abstammungslehre, Ausdruck von Emotionen sind bei Tieren und Menschen in etwa gleich Grundlegung der Ethologie Francis Galton (1822 1911) Vetter Darwins Untersuchungen über die menschlichen Fähigkeiten, Statistiken, psychologische Tests, Erhebung individueller Unterschiede, aus physischen Merkmalen auf psychische schliessen, gründete die Zwillingsforschung Psychodiagnostik erster der die Korrelationen entwickelt hat trug zum Sozialdarwinismus und zum Rassismus bei, nur die geeignetsten dürfen sich fortpflanzen, wollte weniger geeignete sterilisieren Naturwissenschaftliche Psychologie (19. Jahrhundert) psychische Phänomene wurden im Zusammenhang mit der Natur des Menschen verstanden Psychophysik, psychophysischer Parallelismus, orientiert sich an der Physiologie Johannes Peter Müller (1801 1858) die Qualität der Sinneswahrnehmung wird durch die Beschaffenheit der gereizten Sinnesnerven bestimmt, spezifische Sinnesenergien die spezifischen Sinnesenergien werden entsprechend dem priori gegebenen Erbgut betrachtet Spezialisierung der Sinne ist eine Anpassungsleistung des Organismus in der Natur Hermann von Helmholtz (1821 1894) Schüler von Müller physiologische Optik, Wirkkette Reiz-Sinneserregung-Wahrnehmung, Stäbchen und Zapfen, drei farbempfindliche Komponenten fürs Farbsehen, langwelliges Licht Rot, mittelwelliges Licht Grün, langwelliges Licht Blau Ernst Heinrich Weber (1795 1878) Lehre vom Tastsinn, Reizschwellen, wie weit müssen zwei Nadelspitzen entfernt auf die Haut stechen, damit man einen Unterschied merkt? Keine Punkt-zu-Punkt Widerspieglung der äusseren Realität, denn ab gwisser Nähe wird nur noch ein Einstich wahrgenommen Zwei-Punkte-Schwelle Reizschwellen, Reizunterschiede Gustav Fechner (1801 1887) untere Reizschwelle im höheren Bereich der Reizskala ist eine grössere Reizzunahme erforderlich, um noch einen Unterschied zu spüren Das Webersche Gesetz: Ek logR Empfindungsintensität Reizgrösse Konstante (konstanter Schwellenwert) I I Standardreiz die Grösse der Empfindung steht im Verhältnis zum Logarithmus der Grösse des Reizes ebenmerklicher Unterschied Kritik an der klassischen Psychophysik, Fehlende Eingrenzung des Geltungsbereichs, Fragwürdigkeit der Messbarkeit, Unterschiedliche Auslegung bekannte sich zum Monismus, Körper und Geist sind eins, war aber unbewusst eine Art Dualist Wilhelm Wundt (1832 1920) 1879 gründete er das erste psychologische Labor in Leipzig gilt als Vater der experimentellen Psychologie psychophysischen Parallelismus, die beiden Komponenten Seele und Leib entsprechen sich, einem Zustand des Leibes ist ein solcher der Seele zugeordnet und umgekehrt schöpferische Synthese, alles was höher ist, durch diesen Parallelismus entstehen Verbindungen, die psychologisch erklärt werden können, aber auch qualitative Eigenschaften besitzen, die in den Elementen der Verbindungen nicht enthalten sind alles was psychologisch geschieht, hat seinen Ursprung in der Physis Willen, Volontarismus Aufgabe zu den psychischen Phänomenen die physischen Entsprechungen zu suchen war für ihn der Grund zur Gründung des ersten Labors Hermann Ebbinghaus (1850 1909) 1886 richtete das erste Berliner Labor für experimentelle Psychologie ein wollte die bisherige experimentelle Psychologie erweitern und bezieht das Gedächtnis mit ein, er wollte alles untersuchen Selbstversuch, eine sinnlose Silbenreihe wird auswendig gelernt, danach eine Pause gemacht, danach wird gemessen, wie lang er braucht um dieselbe Reihe wieder auswendig zu lernen, dann wieder Pause, usw. braucht immer weniger land bis er die Reihe auswendig kann Vergessenskurve Russische Reflexologie (19. 20. Jahrhundert) erstmals beschriebener Schutzreflex monistischer Ansatz Iwan Michailowitsch Sechenov (1829 1905) Reflexe des Gehirns, Bewusstsein ist Mittelglied zwischen dem äusseren Impuls und der motorischen Reaktion Reflexe sind Antwortbewegungen auf Reize Gedanken sind ebenfalls Reflexe sämtliche psychologische Phänomene kann man als reflexive Reaktionen auf Umwelt-Reize betrachten Wladimir Michailowitsch Bechterew (1857 1927) sämtliche Erscheinungsformen des Psychischen werden als Reflexe oder Reflexverbindungen verstanden, bewusste Erlebnisse gelten als Nebenerscheinungen der Nerventätigkeit Iwan Petrowitsch Pawlow (1849 1936) Reflex ist Antwortreaktion auf eine Reizung der Rezeptoren Reflexbogen, afferenter Teil, zentraler Teil, efferenter Teil, (reafferenter Teil) Konditionierungsmethode, UCS, UCR, CS CR, Löschung, Rekonditionierung, Generalisierung, Diskriminierung Verhalten gelernte Reflexe Amerikanischer Pragmatismus (19. 20. Jahrhundert) Pragma Handlung Lehre vom Handeln Bewusstsein, Bedeutung, Emotionen, Gedächtnis Charles Peirce (1839 1914) Triadische Zeichentheorie, Zeichenkörper, Referent, Interpretant Kommunikation setzt voraus, dass die Objekte der Kommunikation gleich sind oder sich einander anschliessen Identitätsstiftung, Feststellung einer Unklarheit, Klarstellung, Suche nach einem Übergang, Beschaffung von Informationen, Identitätssicherung, Einsicht, Austausch von Überzeugungen auf gleicher Basis bezeichnet seine Methode als Pragmatizismus Relationslogisches Zusammenhangsprinzip, logische Eigenschaften, relationale Eigenschaften, Anwendungsoperationen, relative Multiplikation, Transitivität, relatives Produkt, Erfüllungsinstanzen, Klärung über praktische Wirkungen William James (1842 1910) dem physiologischen Ausdruck der Emotion folgt die kognitive Erfahrung der Emotion James-Lange-Theorie, Zusammenhang von Emotionen und Körperfunktionen, körperliche und emotionale Veränderungen, propriozentive Empfindungen, Emotionen als kognitive Reaktionen, spezifische Affektmuster Bewältigung von Umweltsituationen ermöglicht die Art- und Selbsterhaltung Bewusstseinsstrom, personales Bewusstsein, Veränderlichkeit des Bewusstseins, Kontinuum des Bewusstseins, selektive Aufmerksamkeit, Objektbezogenheit des Bewusstseins, Selbstbewusstsein Radikaler Empirismus, Erfahrung, Wirklichkeit, Erster Teil der Wirklichkeit, Zweiter Teil der Wirklichkeit John Dewey (1859 1952) Reaktionen bestimmen in einer bestimmten Situation entscheidende Reize die Reaktion bestimmen die Art der Reize Der organische Schaltkreis, eine Erfahrung wird durch eine andere Erfahrung ersetzt, die Erfahrung wird ersetzt Würzburger Schule (20. Jahrhundert) höhere psychische Prozesse analysieren Denken, Urteilen, Wollen, Aufmerksamkeit Erfassen von Sinneszusammenhänge Bewusstsein kommt ins Zentrum Oswald Külpe (1862 1915) Schüler von Wundt, hatten aber andere Ansichten Elemente des Bewusstseins zu Einheiten zusammengefasst, in diesen Einheiten stehen eine Aufgabe, ein Gedanke, eine Tendenz und ein Ziel alles andere wird dem Bewusstsein untergeordnet experimentelle Denkpsychologie, den Vpn wird sinnvolles Aufgabenmaterial vorgegeben Karl Marbe (1869 1953) Untersuchungen über das Urteil Bewusstseinszustände sind frei von sensorisch-imaginalen Komponenten Bewusstseinslagen sind Erwartungen, Spannungen, Ungewissheiten, Urteile sind nicht von bildhaften Vorstellungen begleitet, Gedanken sind wichtig Gedanken sind Bewusstseinstatsachen, die schwer zugänglich sind logische Urteile lassen sich nicht auf psychologische Urteile reduzieren Narziss Kaspar Ach (1871 1946) Denkinhalte sind Bewusstheiten Denkprozesse laufen unter der Regie der determinierenden Tendenz (unbewusst) er stellte Aufgaben wie die neun Punkte so zu verbinden, dass jeder Punkt nur einmal berührt wird aufgrund der Aufgabe erfolgt eine Einstellung auf das Denkziel hin Otto Selz (1881 1943) Problemlösung beginnt mit einer schematischen Vorwegnahme der Lösung des Problems, ist aber noch unvollständig und lückenhaft diese gibt aber Anstoss für notwendige Denkvorgänge Sachen die man weiss, muss man aktualisieren um die Lücken zu füllen Karl Bühler (1879 1963) AHA-Erlebnis, unmittelbar vor der Lösungsfindung stellt sich ein lustbetontes Erlebnis des Verstehens ein, ein innerer Ruck, Zusammenhänge werden erkannt, Erfassen von Sinnzusammenhänge Wundts Argumente gegen die Experimente der Würzburger Schule, experimenteller Anspruch, Bestimmbarkeit, Modifizierbarkeit, Replizierbarkeit Wundt und Bühler hatten nicht die gleichen Vorstellungen von einem wissenschaftlichen Experiment Die Krise der Psychologie, Psychologie hat sich verzweigt in sachliche und methodische Richtung, es gibt drei Aspekte der Forschung (innere Erlebnisse, äusseres Verhalten, von Menschen erzeugtes Produkt) diese drei Aspekte können verschieden untersucht werden, alle Arten der Untersuchung sind legitim, nicht nur eine, kein oder sondern ein und Sprachtheorie, Organon-Modell mit den drei Elementen Sender/Empfänger, Gegenstände und Sachverhalte und den drei Funktionen Symbolfunktion (Darstellung), Symtomfunktion (Ausdruck), Signalfunktion (Apell) Grazer Schule (20. Jahrhundert) Ziel ist es die Gestaltenqualität herauszuarbeiten im Zentrum stehen psychische Akte und nicht psychische Inhalte gelten noch nicht als Gestaltpsychologen, aber als deren Vorläufer Alexius Meinong (1853 1920) gründete das erste österreichisch psychologische Labor die Summe der Elemente psychischer Erscheinungen (Wahrnehmung) unterscheiden sich von zusammenhängenden Gesamtheiten, die mehr sind als diese Summe Gesamtheiten nennt er Komplexionen Unterscheidung in vier Gegenstandsklassen Objekte, Objektive, Dignitative (das Wahre, das Gute, ), Desiderative (Gegenstände des Sollens und des Zwecks) diese entsprechen den vier Erlebis-Hauptklassen: Vorstellen, Denken, Fühlen, Begehren ein Subjekt, das sich mit einem Objekt auseinandersetzt Christian Ehrenfels (1859 1932) Gestaltqualität, anhand des Hörens einer Melodie Gestaltqualität der Übersummenhaftigkeit, Gestaltqualität der Transponierbarkeit daraus folgt, dass die Psychologie nicht in einzelne Empfindungen gesehen werden kann Berliner und Frankfurter Schule (20. Jahrhundert) Gestaltpsychologie, stellt das Alltagsverständnis, die menschlichen Wahrnehmungen seien exakt und direkt, in Frage Max Wertheimer (1880 1943) Scheinbewegungen Phi-Phänomen, Abfolge von Reizen, Scheinbewegungen, Simultanität, Sukzessivität Gestaltfaktoren, Faktor der guten Gestalt, Faktor der Gleichartigkeit, Faktor der Nähe, Faktor des gemeinsamen Schicksals, Faktor der Gewohntheit, Faktor der Geschlossenheit Wolfgang Köhler (1887 1967) auf der psychologischen und der physischen Ebene herrschen auch Gestaltgesetze Isomorphie (gleiche Gestalt), nach dem Isomorphieprinzip entsprechen sich kortikale Erregungsstrukturen und Wahrnemungsstrukturen Intelligenzprüfung an Menschenaffen, Doppelstock-Versuch, Denken ist ein automatischer Umstrukturierungsvorgang Kurt Koffka (1886 1941) Konstanzphänomene, Grössenkonstanz, Farbkonstanz, Dingkonstanz, Raumkonstanz Kinderpsychologie, Entwicklungspsychologie Entwicklung ist Reifung und Lernen, beeinflussen einander Funktion des Gedächtnisses, früheste Erinnerung mit zwei Jahren (Kindheitsamnesie) Leipziger Schule (20. Jahrhundert) Ganzheitspsychologie, Struktur geht erst aus einem zunächst noch diffusen ganzheitlichen Erlebnis hervor erste Relevanz ist das gefühlsmässige Erlebnis Felix Krueger (1874 1948) alle psychischen Erscheinungen werden auf das Prinzip der Ganzheit zurückgeführt, das Erleben wird unterschiedlich stark gegliedert, diese Gliederungen nennt er Komplexqualitäten Gefühle sind diffus-komplexe Ganzheiten Friedrich Sander (1889 1971) Aktualgenese, gestaltschaffende Dynamik bzw. das Gestaltwerden im aktuellen seelischen Geschehen Gestaltwerden erfolgt in bestimmten Phasen: ganzheitliche, lebendige Gebilde heben sich allmählich vom Grund ab, meist plötzlich tauchen Vorgestalten auf, bis das erlebte gegliederte als ganzes zur Endgestalt wird, dynamischer Gesamtprozess Albert Wellek (1904 1972) beim Denken unterscheidet er zwischen Fühldenken und Rationalität Fühldenken: vorrationales, prälogisches und von der Gewissheit des Gefühls getragenes Denken, wichtig ist die Intuition, ein blitzartiger Einfall Rationalität: Klarheit und Unterscheidung quantitative Methoden sind notwendig, aber durch Intuition zu ergänzen Thesen seiner psychologischen Position in Fragen der Methodik Methodenstreit der deutschen Psychologie Psychoanalyse (20. Jahrhundert) Theorie des Unbewussten, therapeutische Methode, Seelenzergliederung, wichtigstes Hilfsmittel ist das freie Assoziieren Sigmund Freud (1856 1939) Traumdeutung, Traum als Königsweg zum unbewussten Seelenleben, Träume sind häufig Tagesreste, die sich an verdrängte Kindheitsszenen anheften und einen unbewussten Wunsch hervorrufen manifester Trauminhalt: eigentlicher Traum, so wie er dem Träumenden erscheint, wie er ihn erzählt latenter Traumgedanke: Analyse des Traums durch freies assoziieren und durch Verdichtung und Verschiebung Traumarbeit: Vom manifesten Trauminhalt wird durch assoziieren und analysieren auf den latenten Traumgedanke geschlossen, Verdichtung und Verschiebung, welche die Tagesreste in das Produkt des manifesten Traumes umwandeln Regression um zu den verdrängten Wünschen der Kindheit zu gelangen Anna Freud (1895 1982) Kinderanalyse, stellt eine Gefühlsbindung zum Kind her um es analysieren zu können Deutung von Träumen und Tagträumen mittels zeichnen, spielen, Zusammenarbeit mit den Eltern Ich Auseinandersetzung mit sich selber, Es Triebregungen, Über-Ich Forderungen der Eltern Aberwehrmechanismen sind Mittel, mit denen das Ich Peinliches, schwer Erträgliches und Angstauslösendes abwehrt, Abwehr erfolgt meist unbewusst Abwehrvorgänge: Reaktionsbildung, Verleugnung, Regression, Sublimierung, Rationalisierung, Identifikation, Isolierung, Ungeschehenmachen, Verkehrung ins Gegenteil, Projektion, Wendung gegen die eigene Person Verdrängung ist ein Vorgang, der über die Abwehr hinaus weicht Melanie Klein (1882 1982) Bindung vom Kind an die Mutter gutes Objekt: nährende, beruhigende Brust böses Objekt: abwesende, versagende, leere Brust Kind hat Objektbeziehungen, die Einfluss haben auf spätere Objektbeziehungen introjiziert: gute Objekte werden psychisch einbezogen projiziert: böse Objekte werden ausgestossen und entsprechende Gefühle nach aussen projiziert introjizieren führt zu einem weniger strengen Über-Ich und zu einem ausgleichenden Ich-Ideal entwickelte für die Kinderanalyse eine Spieltechnik John Bowlby (1907 1990) Bindungstheoretiker psychisches Band zwischen Mutter und Kind Neurosen sind durch Umweltfaktoren (z. B. Trennung von der Mutter) der ersten Lebensjahre bedingt Trennung von den Eltern ist sehr schlecht für das Kind Bindungsverhalten: Verhalten, das die Bindung erhält oder aufrechterhält Bindung ist eine reziproke Beziehung