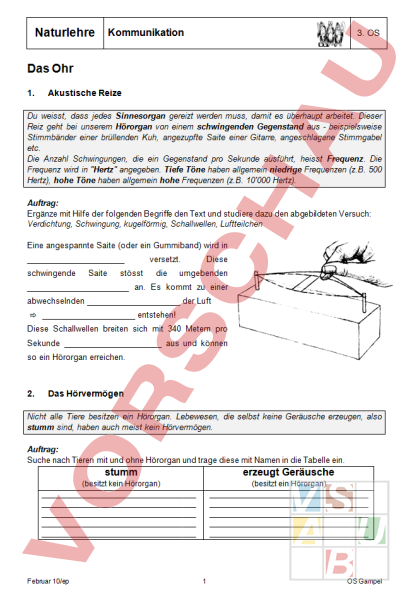Arbeitsblatt: Das Ohr
Material-Details
Arbeitsblätter zum Thema Ohr zur Unterrichtseinheit Kommunikation. Lösungen vorhanden.
Biologie
Anatomie / Physiologie
9. Schuljahr
19 Seiten
Statistik
53599
2053
110
02.02.2010
Autor/in
Erich Pfammatter
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Naturlehre Kommunikation 3. OS Das Ohr 1. Akustische Reize Du weisst, dass jedes Sinnesorgan gereizt werden muss, damit es überhaupt arbeitet. Dieser Reiz geht bei unserem Hörorgan von einem schwingenden Gegenstand aus beispielsweise Stimmbänder einer brüllenden Kuh, angezupfte Saite einer Gitarre, angeschlagene Stimmgabel etc. Die Anzahl Schwingungen, die ein Gegenstand pro Sekunde ausführt, heisst Frequenz. Die Frequenz wird in Hertz\ angegeben. Tiefe Töne haben allgemein niedrige Frequenzen (z.B. 500 Hertz), hohe Töne haben allgemein hohe Frequenzen (z.B. 10�00 Hertz). Auftrag: Ergänze mit Hilfe der folgenden Begriffe den Text und studiere dazu den abgebildeten Versuch: Verdichtung, chtung, Schwingung, kugelförmig, Schallwellen, Luftteilchen Eine angespannte Saite (oder ein Gummiband) wird in schwingende Saite stösst versetzt. die Diese umgebenden an. Es kommt zu einer abwechselnden selnden der Luft entstehen! Diese Schallwellen breiten sich mit 340 Metern pro Sekunde aus und können so ein Hörorgan erreichen. 2. Das Hörvermögen Nicht alle Tiere besitzen ein Hörorgan. Lebewesen, die selbst keine Geräusche erzeugen, also stumm sind, haben auch meist kein Hörvermögen. Auftrag: Suche nach Tieren mit und ohne Hörorgan und trage diese mit Namen in die Tabelle ein. stumm erzeugt Geräusche (besitzt kein Hörorgan) (besitzt ein Hörorgan) Februar 10/ep 1 OS Gampel Naturlehre Kommunikation 3. OS Unser Hörorgan wird nicht von allen Frequenzen genügend gereizt. Gewisse Frequenzen sind für die Menschen unhörbar. Unser Ohr hört deshalb nur innerhalb eines bestimmten Frequenzbereiches. Studiere die folgende Tabelle, die dir den Hörbereich des Menschen im Vergleich zum Hörbereich einiger Tiere aufzeigt. Betrachte auch die untenstehende Grafik „Unser Hörfeld der Sprache. Frequenz Huhn Eidechse Hund Fledermaus Mensch (in Hertz) Untere Grenze 40 ? 5000 16 38�00 10�00 100�00 75�00 20�00 Un e Hö f ld e Sp a ch dB Obere Grenze 120 100 80 Grundtne Grundtöne 60 Konsonanten Konsonanten Vokale 40 Vokale 20 0 50 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz Frequenzen, die das Hörvermögen unseres Ohres übersteigen, gehören zum Bereich des Ultraschalls. Vielleicht weisst du, dass sich beispielsweise Fledermäuse mit Hilfe von Ultraschall orientieren. Merke! Mit zunehmendem Alter nimmt das Hörvermögen des Menschen stetig ab. Februar 10/ep 2 OS Gampel Naturlehre 3. Kommunikation 3. OS Das menschliche Ohr – Übersicht Das Ohr dient nicht nur dem Hören, es enthält auch zwei weitere wichtige Sinnesorgane, den Bewegungs und den Gleichgewichtssinn. Unser Ohr wird in drei Teile gegliedert: äusseres Ohr, Mittelohr und Innenohr! Auftrag: Die folgende Abbildung zeigt dir eine Übersicht zum Bau des menschlichen Ohres. Beschrifte die Ziffern 1-11 mit Hilfe der folgenden Begriffe: Ohrtrompete, Trommelfell, Amboss, Gehörgang, Gehörschnecke, Bogengänge, Gehörnerv, Hammer, Steigbügel, Ohrmuschel, Knochen 5 1. 7. 2. 8. 3. 9. 4. 10. 5. 11. 6. Februar 10/ep 3 OS Gampel Naturlehre 4. Kommunikation 3. OS Das äussere Ohr Auftrag: Lies und ergänze den Text zum äusseren Ohr mit Hilfe der folgenden Begriffe: Luftschwingungen, Schallfänger, Sinnesorgan, Mittelohr, Trommelfell, Drüsen, Gehörgang, Schallwellen, Fremdkörpern, Ohrmuschel, Ohrenschmalz äusserer, Das Ohr ist das für die Aufnahme von . Sichtbar ist nur sein Teil. Was uns am Ohr zuerst auffällt, ist sicher die, die bei den Menschen unterschiedlich in Form und Grösse sein kann (beispielsweise die Segelohren von Prinz Charles!). Die Ohrmuschel dient als und leitet die Schallwellen in den. Die Haare am Eingang zum Gehörgang verhindern das Eindringen von . In den Wänden des Gehörgangs sind tausende von eingebettet, die das fettige absondern. Der Gehörgang wird an seinem inneren Ende von einer zarten, elastischen und gespannten Haut, dem, abgeschlossen. Es ist ein rundes Häutchen von ca. 1 cm Durchmesser und 0,1 mm Dicke. Das Trommelfell übernimmt die ankommenden, die jeder Ton erzeugt, und leitet sie zum weiter. 5. Das Mittelohr Auftrag: Lies den folgenden Text zum mittleren Ohr. Das Mittelohr ( Paukenhöhle) ist ebenfalls mit Luft gefüllt. Durch die Ohrtrompete ( Eustachische Röhre) ist sie mit der Nasen- und Rachenhöhle verbunden. Die wichtigsten Teile des Mittelohrs sind drei winzige Knöchelchen: Hammer, Amboss und Steigbügel! Diese mechanischen Hebelarme verstärken einerseits die Schwingungen und leiten sie andererseits vom Trommelfell an das ovale Fensterchen weiter. Dieses überträgt die Schwingungen an das Gehörwasser in der Gehörschnecke. Ausser durch die Schädelknochen ist das mittlere Ohr vom Innenohr noch durch das runde Fensterchen getrennt. Die drei Gehörknöchelchen bilden also die Brücke vom äusseren zum inneren Ohr. Nachfolgend siehst du eine Skizze zum Bau von Mittelohr und Innenohr. Beschrifte mit Hilfe des obenstehenden Lesetextes und der Zeichnung auf dem Arbeitsblatt die Ziffern 1-12. Februar 10/ep 4 OS Gampel Naturlehre Kommunikation 3. OS 1. 7. 2. 8. 3. 9. 4. 10. 5. 11. 6. 12. 6. Das innere Ohr Hörvorgang Auftrag: Lies den nachfolgenden Text zum Hörvorgang im Innenohr aufmerksam durch und unterstreiche danach die wichtigsten Begriffe. Studiere dazu anschliessend die nachfolgenden Skizzen und Abbildungen, welche dir beim Verständnis des Textes behilflich sein können. Mache Notizen zu den Zeichnungen. Das Innenohr, gut geschützt in der Tiefe des Schädelknochens, trägt wegen seines komplizierten Baues die Bezeichnung Labyrinth. Es enthält die Sinneszellen für das Hören sowie für den Lage und Bewegungssinn. Deutlich lassen sich drei Teile im Innenohr erkennen: Ein kugeliges ges Gebilde, der Vorhof, setzt sich unten in die Gehörschnecke fort. Auf dem Vorhof sind die drei henkelförmigen Bogengänge aufgesetzt. Vorhof, Gehörschnecke und Bogengänge sind zarthäutige Gebilde, stehen miteinander in Verbindung und sind mit dem Gehörwasser Gehörwa ( Perilymphe) ausgefüllt. Die Schnecke ist mit der sie umgebenden Knochenwand verwachsen verwachsen und bildet das eigentliche Gehörorgan. hörorgan. Sie enthält in ihren etwa 2 mm weiten Windungen drei Kanäle: Einen oberen Kanal, ausgehend vom ovalen Fensterchen, einen mittleren Kanal, gebildet aus der häutigen Gehörschnecke, und einen unteren Kanal, endend beim runden Fensterchen. Oberer und unterer Kanal sind miteinander verbunden und mit Aussenlymphe ( Perilymphe) gefüllt. Die SinSin neszellen für das Hören (ca. 25�00) befinden sich im inneren Kanal, der mit Innenlymphe ( Endolymphe) gefüllt ist. Sobald nun das ovale Fenster durch die ihm zugeleiteten Schallwellen aus dem Mittelohr in Schwingung gerät, entsteht in der Aussenlymphe des oberen und unteren Kanals eine Wellenbewegung. llenbewegung. Das wiederum reizt die Sinneszellen im mittleren Kanal. Die Weiterleitung Februar 10/ep 5 OS Gampel Naturlehre Kommunikation 3. OS dieser Erregungen besorgt der Gehörnerv, der direkt mit dem Hörzentrum des Gehirns verbunden ist. Das Gehirn empfindet nun die Reize als Geräusche, Töne oder Sprache. Die ie Sinneszellen ruhen auf ungleich langen Nervenfasern. Ihre Länge nimmt von einem Ende der Schnecke bis zum anderen zu. So sind sie auf die verschiedenen Töne abgestimmt, die längsten auf die tiefen, die kurzen auf die hohen, so dass jeder Ton von bestimmten bestimm Sinneszellen aufgefangen werden kann. Februar 10/ep 6 OS Gampel Naturlehre 7. Kommunikation 3. OS Bewegungs- und Lagesinnesorgan Auftrag: Die folgenden Abbildungen zeigen dir unser Bewegungs- und Lagesinnesorgan im Innenohr. Lies den nachfolgenden Text und ergänze ihn mit folgenden Begriffen. Lagesinneszellen, sinneszellen, Bogengängen, Wimpernschopf, Gleichgewichtssinne, Kristalle, Bläschen, entgegengesetzter, Bewegungssinn, Bogengang, rechtwinklig, Lage, Kristalle, Bewegungssinnesorgane, Lagesinn, Sinneshärchen Ein Betrunkener torkelt über die Strasse. Der Alkohol, ein Nervengift, hat seine betäubt. Unser Gleichgewicht ist vom und vom abhängig. Die liegen am Grunde zweier Säckchen im Vorhof hof des inneren Ohres. Auf den Sinneshärchen,, ruhen zahlre zahlreiche die durch kleine Gallerte zusammengehalten werden. Je nachdem, wie unser Körper steht oder verschiedener liegt, infolge drücken ihrer Weise die Schwere auf . in die Dadurch teilen uns die Sinneszellen mit, in welcher wir uns im Moment gerade befinden. In den drei sitzen die . Sie zeigen uns jede Bewegung gung an, die unser Kopf oder unser Körper gerade ausführt. ist mit Jeder Flüssigkeit angefüllt und am Ende bläschenförmig erweitert. In den sitzen Sinneszellen, deren Sinneshärchen chen zu einem verklebt sind. Bewegt sich nun der Kopf, so bewegen sich die drei Bogengänge mit. Die Flüssigkeit aber verharrt wegen der Trägheit in ihrer Lage und strömt scheinbar in Richtung. tung. Dabei biegt sich der Wimpernschopf mehr me oder weniger stark rk zur Seite. Da die drei Bogengänge gänge zueinander stehen, wird bei jeder jeder Bewegung mindestens ein Wimpernschopf pernschopf besonders stark gereizt. Februar 10/ep 7 OS Gampel Naturlehre 8. Kommunikation 3. OS Lärm Wie wir zu Beginn des Kapitels über das Ohr gelernt haben, nimmt unser Ohr Schwingungen von Gegenständen auf. Diese durch die Luft weitergeleiteten Schallwellen werden von unserem Ohr aufgenommen, in akustische Reize umgewandelt und ins Gehirn weitergeleitet, wo sie als verschiedene Töne (laut, leise, hoch, tief) wahrgenommen werden. Je weniger Schwingungen unser Ohr pro Sekunde erreichen, desto ist der Ton! Je mehr Schwingungen unser Ohr pro Sekunde erreichen, desto ist der Ton! Das menschliche Ohr ist in der Lage, Schwingungen zwischen 16 20�00 Hertz (ein Hertz eine Schwingung pro Sekunde) wahrzunehmen. Was ist Lärm? Lärm ist ein von verschiedenen, die vom menschlichen Ohr unterschiedlich stark wahrgenommen werden! Wie wird die Lautstärke gemessen? Die Masseinheit für die Lautstärke ist das Phon oder Dezibel [dB A]! Die untere Grenze der Hörbarkeit beträgt 0 dB (A), die Schmerzschwelle liegt bei 130 dB (A). Dauernder Lärm kann sich auf den Menschen unterschiedlich auswirken. Eine Belastung von 40 60 dB (A) während dem Tag kann Unruhe, Ärger, Konzentrationsstörungen und Unmut zur Folge haben. Belastungen von über 60 dB (A) verursachen Belastung des Nervensystems, Gesprächsstörungen, Blutdruckanstieg. Während der Nacht bewirken Töne von über 45 dB (A) Schlafstörungen (auch wenn man dabei nicht erwacht!!) Gesundheitliche Auswirkungen von Lärm auf den Menschen Schwerhörigkeit ist ein Krankheitszeichen, das verschiedene Ursachen haben kann. Vorübergehende Schwerhörigkeit findet sich beim Ohrenschmalzpfropfen und bei der Fremdkörpereinklemmung im Gehörgang. Beides kann durch Ausspülen mit Wasser behandelt werden. Akute Mittelohrentzündung und Tubenkatarrh ( Schleimhautschwellung in der Ohrtrompete) erzeugen ebenfalls eine vorübergehende Schwerhörigkeit. Schwerhörigkeit kann ausserdem durch indirekte Auswirkungen von Schlag, Stoss oder Fall zustande kommen. Knall und Explosion lassen nach anfänglicher Besserung häufig einen Dauerschaden zurück. Chronischer ( dauernder) Lärm kann im Bereich der Innenohrsinneszellen Entartungs- und sogar Rückbildungsvorgänge auslösen (beispielsweise bei Schmieden, Stahlarbeitern, bei häufigen Discobesuchen, Kopfhörer tragen etc.), was eine dauernde Schwerhörigkeit oder Hörverlust zur Folge hat. Februar 10/ep 8 OS Gampel Naturlehre Kommunikation 3. OS Ein Hörverlust kann viele Ursachen haben: • Erkrankung des Innenohres durch: • Infektionen • Überlastung des Gehörs (zu hohe Lautstärke)!! • Altersschwerhörigkeit Das menschliche Gehör hat nur bei jungen Menschen einen Frequenzumfang von etwa 20 Hz bis 20 kHz. Mit zunehmendem Alter wird das Hörfeld deutlich eingeschränkt. eingeschrä • Angeborene Schwerhörigkeit (Oft durch Infektionskrankheiten der Mutter Schwangerschaft übertragen; Masern, Röteln) während der • Schalltrauma Ein heftiger, kurzer Schall, wie ein Knall, Schuss oder eine Explosion, kann das Gehör irreparabel schädigen. Dieselbe Störung tritt auch bei langanhaltendem oder häufigem Lärm auf. • Tinnitus Tinnitus oder besser bekannt unter „Ohrensausen ist ein ernstzunehmendes Anzeichen einer sich anbahnenden Hörschädigung!) Hier helfen nur Vorsichtsmassnahmen: • Hörschutzgeräte tragen • dem Lärm ausweichen • Lärm verhindern Auftrag: Notiere für dich aktuelle Lärmquellen und gib jeweils an, mit welchen Vorsichtsmassnahmen eine Hörschädigung vermieden werden kann. Februar 10/ep 9 OS Gampel Naturlehre Kommunikation 3. OS LÖSUNG Das Ohr 1. Akustische Reize Du weisst, dass jedes Sinnesorgan gereizt werden muss, damit es überhaupt arbeitet. Dieser Reiz geht bei unserem Hörorgan von einem schwingenden Gegenstand aus beispielsweise Stimmbänder einer brüllenden Kuh, angezupfte Saite einer Gitarre, angeschlagene Stimmgabel etc. Die Anzahl Schwingungen, ngungen, die ein Gegenstand pro Sekunde ausführt, heisst Frequenz. Die Frequenz wird in Hertz\ angegeben. Tiefe Töne haben allgemein niedrige Frequenzen (z.B. 500 Hertz), hohe Töne haben allgemein hohe Frequenzen (z.B. 10�00 Hertz). Auftrag: Ergänze mit Hilfe der folgenden Begriffe den Text und studiere dazu den abgebildeten Versuch: Verdichtung, Schwingung, kugelförmig, Schallwellen, Luftteilchen Eine angespannte Saite (oder ein Gummiband) wird in Schwingung versetzt. Diese schwingende Saite stösst die umgebenden Luftteilchen an. Es kommt zu einer abwechselnden Verdichtung der Luft Schallwellen entstehen! Diese Schallwellen breiten sich mit 340 Metern pro Sekunde kugelförmig aus und können so ein Hörorgan erreichen. 2. Das Hörvermögen Nicht alle Tiere besitzen ein Hörorgan. Lebewesen, die selbst keine Geräusche erzeugen, also stumm sind, haben auch meist kein Hörvermögen. Auftrag: Suche nach Tieren mit und ohne Hörorgan und trage diese mit Namen in die Tabelle ein. stumm erzeugt Geräusche (besitzt kein Hörorgan) (besitzt ein Hörorgan) Schnecken Löwen Regenwürmer Adler Spinnen (Schallaufnahme über Sinneshärchen) Frösche Fliegen Krokodile Bakterien Haifische Februar 10/ep 1 OS Gampel Naturlehre Kommunikation 3. OS LÖSUNG Unser Hörorgan wird nicht von allen Frequenzen genügend gereizt. Gewisse Frequenzen sind für die Menschen unhörbar. Unser Ohr hört deshalb nur innerhalb eines bestimmten Frequenzbereiches. Studiere die folgende Tabelle, die dir den Hörbereich des Menschen im Vergleich zum Hörbereich einiger Tiere aufzeigt. Betrachte auch die untenstehende Grafik „Unser Hörfeld der Sprache. Frequenz Huhn Eidechse Hund Fledermaus Mensch (in Hertz) Untere Grenze 40 ? 5000 16 38�00 10�00 100�00 75�00 20�00 Un e Hö f ld e Sp a ch dB Obere Grenze 120 100 80 Grundtne Grundtöne 60 Konsonanten Konsonanten Vokale 40 Vokale 20 0 50 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz Frequenzen, die das Hörvermögen unseres Ohres übersteigen, gehören zum Bereich des Ultraschalls. Vielleicht weisst du, dass sich beispielsweise Fledermäuse mit Hilfe von Ultraschall orientieren. Merke! Mit zunehmendem Alter nimmt das Hörvermögen des Menschen stetig ab. Februar 10/ep 2 OS Gampel Naturlehre Kommunikation 3. OS LÖSUNG 3. Das menschliche Ohr – Übersicht Das Ohr dient nicht nur dem Hören, es enthält auch zwei weitere wichtige Sinnesorgane, den Bewegungs und den Gleichgewichtssinn. Unser Ohr wird in drei Teile gegliedert: äusseres Ohr, Mittelohr und Innenohr! Auftrag: Die folgende Abbildung zeigt dir eine Übersicht zum Bau des menschlichen Ohres. Beschrifte die Ziffern 1-11 mit Hilfe der folgenden Begriffe: Ohrtrompete, Trommelfell, Amboss, Gehörgang, Gehörschnecke, Bogengänge, Gehörnerv, Hammer, Steigbügel, Ohrmuschel, Knochen 5 1. Ohrmuschel 7. Steigbügel 2. Gehörgang 8. Gehörschnecke 3. Bogengänge 9. Ohrtrompete (Eustachische Röhre) 4. Gehörnerv 10. Trommelfell 5. Knochen 11. Hammer 6. Amboss Februar 10/ep 3 OS Gampel Naturlehre Kommunikation 3. OS LÖSUNG 4. Das äussere Ohr Auftrag: Lies und ergänze den Text zum äusseren Ohr mit Hilfe der folgenden Begriffe: Luftschwingungen, Schallfänger, Sinnesorgan, Mittelohr, Trommelfell, Drüsen, Gehörgang, Schallwellen, Fremdkörpern, Ohrmuschel, Ohrenschmalz äusserer, Das Ohr ist das Sinnesorgan für die Aufnahme von Schallwellen. Sichtbar ist nur sein äusserer Teil. Was uns am Ohr zuerst auffällt, ist sicher die Ohrmuschel, die bei den Menschen unterschiedlich in Form und Grösse sein kann (beispielsweise die Segelohren von Prinz Charles!). Die Ohrmuschel dient als Schallfänger und leitet die Schallwellen in den Gehörgang. Die Haare am Eingang zum Gehörgang verhindern das Eindringen von Fremdkörpern. In den Wänden des Gehörgangs sind tausende von Drüsen eingebettet, die das fettige Ohrenschmalz absondern. Der Gehörgang wird an seinem inneren Ende von einer zarten, elastischen und gespannten Haut, dem Trommelfell, abgeschlossen. Es ist ein rundes Häutchen von ca. 1 cm Durchmesser und 0,1 mm Dicke. Das Trommelfell übernimmt die ankommenden Luftschwingungen, die jeder Ton erzeugt, und leitet sie zum Mittelohr weiter. 5. Das Mittelohr Auftrag: Lies den folgenden Text zum mittleren Ohr. Das Mittelohr ( Paukenhöhle) ist ebenfalls mit Luft gefüllt. Durch die Ohrtrompete ( Eustachische Röhre) ist sie mit der Nasen- und Rachenhöhle verbunden. Die wichtigsten Teile des Mittelohrs sind drei winzige Knöchelchen: Hammer, Amboss und Steigbügel! Diese mechanischen Hebelarme verstärken einerseits die Schwingungen und leiten sie andererseits vom Trommelfell an das ovale Fensterchen weiter. Dieses überträgt die Schwingungen an das Gehörwasser in der Gehörschnecke. Ausser durch die Schädelknochen ist das mittlere Ohr vom Innenohr noch durch das runde Fensterchen getrennt. Die drei Gehörknöchelchen bilden also die Brücke vom äusseren zum inneren Ohr. Nachfolgend siehst du eine Skizze zum Bau von Mittelohr und Innenohr. Beschrifte mit Hilfe des obenstehenden Lesetextes und der Zeichnung auf dem Arbeitsblatt die Ziffern 1-12. Februar 10/ep 4 OS Gampel Naturlehre Kommunikation 3. OS LÖSUNG 1. Trommelfell 7. Ohrtrompete 2. Hammer 8. Bogengänge 3. Amboss 9. Vorhof 4. Steigbügel 10. Gehörschnecke 5. Rundes Fensterchen 11. Gehörnerv 6. Ovales Fensterchen 12. Lagesinnesnerven 6. Das innere Ohr Hörvorgang Auftrag: Lies den nachfolgenden Text zum Hörvorgang im Innenohr aufmerksam durch und unterstreiche danach die wichtigsten Begriffe. Studiere dazu anschliessend die nachfolgenden Skizzen und Abbildungen, welche dir beim Verständnis des Textes behilflich sein können. Mache Notizen zu den Zeichnungen. Das Innenohr, gut geschützt in der Tiefe des Schädelknochens, trägt wegen seines komplizierten Baues die Bezeichnung Labyrinth. Es enthält die Sinneszellen für das Hören sowie für den Lage und Bewegungssinn. Deutlich lassen assen sich drei Teile im Innenohr erkennen: Ein kugeliges Gebilde, der Vorhof, setzt sich unten in die Gehörschnecke fort. Auf dem Vorhof sind die drei henkelförmigen Bogengänge aufgesetzt. Vorhof, Gehörschnecke und Bogengänge sind zarthäutige Gebilde, stehen hen miteinander in Verbindung und sind mit dem Gehörwasser ( Perilymphe) ausgefüllt. Die Schnecke ist mit der sie umgebenden Knochenwand verwachsen verwachsen und bildet das eigentliche Gehörorgan. hörorgan. Sie enthält in ihren etwa 2 mm weiten Windungen drei Kanäle: Einen oberen Kanal, ausgehend vom ovalen Fensterchen, einen mittleren Kanal, gebildet aus der häutigen Gehörschnecke, und einen unteren Kanal, endend beim runden Fensterchen. Oberer und unterer Kanal sind miteinander verbunden und mit Aussenlymphe ( Perilymphe) gefüllt. Die Sinneszellen für das Hören (ca. 25�00) befinden sich im inneren Kanal, der mit Innenlymphe ( Endolymphe) gefüllt ist. Sobald nun das ovale Fenster durch die ihm zugeleiteten Schallwellen aus dem Mittelohr in Schwingung gerät, entsteht in der Aussenlymphe des oberen und unteren Kanals eine Wellenbewegung. Das wiederum reizt die Sinneszellen im mittleren Kanal. Die Weiterleitung Februar 10/ep 5 OS Gampel Naturlehre Kommunikation 3. OS LÖSUNG dieser Erregungen besorgt der Gehörnerv, der direkt mit dem Hörzentrum des Gehirns verbunden ist. Das Gehirn empfindet nun die Reize als Geräusche, Töne oder Sprache. Die Sinneszellen ruhen auf ungleich langen Nervenfasern. Ihre Länge nimmt von einem Ende der Schnecke bis zum anderen zu. So sind sie auf die verschiedenen Töne abgestimmt, die längsten auf die tiefen, die kurzen auf die hohen, so dass jeder Ton von bestimmten Sinneszellen aufgefangen werden kann. Februar 10/ep 6 OS Gampel Naturlehre Kommunikation 3. OS LÖSUNG 7. Bewegungs- und Lagesinnesorgan Auftrag: Die folgenden Abbildungen zeigen dir unser Bewegungs- und Lagesinnesorgan im Innenohr. Lies den nachfolgenden Text und ergänze ihn mit folgenden Begriffen. Lagesinneszellen, sinneszellen, Bogengängen, Wimpernschopf, Gleichgewichtssinne, Kristalle, Bläschen, entgegengesetzter, Bewegungssinn, Bogengang, rechtwinklig, Lage, Kristalle, Bewegungssinnesorgane, ssinnesorgane, Lagesinn, Sinneshärchen Ein Betrunkener torkelt über die Strasse. Der Alkohol, ein Nervengift, hat seine Gleichgewichtssinne betäubt. Unser Gleichgewicht ist vom Lagesinn und vom Bewegungssinn abhängig. Die Lagesinneszellen liegen am Grunde zweier Säckchen im Vorhof des inneren Ohres. Auf den Sinneshärchen ruhen zahlreiche kleine Kristalle,, die durch Gallerte zusammengehalten werden. Je nachdem, wie unser Körper steht oder liegt, drücken die Kristalle infolge ihrer Schwere in verschiedener Weise auf die Sinneshärchen Dadurch teilen uns die Sinneszellen mit, in welcher Lage wir uns im Moment gerade befinden. In den drei Bogengängen sitzen die Bewegungssinnesorgane Sie zeigen uns jede Bewegung an, die unser Kopf oder unser Körper Kö gerade ausführt. Jeder Bogengang ist mit Flüssigkeit angefüllt und am Ende bläschenförmig erweitert. In den Bläschen sitzen Sinneszellen, deren Sinneshärchen zu einem Wimpernschopf verklebt sind. Bewegt sich nun der Kopf, so bewegen sich die drei Bogengänge engänge mit. Die Flüssigkeit aber verharrt wegen der Trägheit in ihrer Lage und strömt scheinbar in entgegengesetzter Richtung. Dabei biegt sich der Wimpernschopf mehr oder weniger stark zur Seite. Da die drei Bogengänge rechtwinklig zueinander stehen, wird wir bei jeder Bewegung mindestens ein Wimpernschopf besonders stark gereizt. Skizzenerklärung siehe nächste Seite Februar 10/ep 7 OS Gampel Naturlehre Kommunikation 3. OS LÖSUNG Februar 10/ep 8 OS Gampel Naturlehre Kommunikation 3. OS LÖSUNG 8. Lärm Wie wir zu Beginn des Kapitels über das Ohr gelernt haben, nimmt unser Ohr Schwingungen von Gegenständen auf. Diese durch die Luft weitergeleiteten Schallwellen werden von unserem Ohr aufgenommen, in akustische Reize umgewandelt und ins Gehirn weitergeleitet, wo sie als verschiedene Töne (laut, leise, hoch, tief) wahrgenommen werden. Je weniger Schwingungen unser Ohr pro Sekunde erreichen, desto tiefer ist der Ton! Je mehr Schwingungen unser Ohr pro Sekunde erreichen, desto höher ist der Ton! Das menschliche Ohr ist in der Lage, Schwingungen zwischen 16 20�00 Hertz (ein Hertz eine Schwingung pro Sekunde) wahrzunehmen. Was ist Lärm? Lärm ist ein Durcheinander von verschiedenen Tönen, die vom menschlichen Ohr unterschiedlich stark wahrgenommen werden! Wie wird die Lautstärke gemessen? Die Masseinheit für die Lautstärke ist das Phon oder Dezibel [dB A]! Die untere Grenze der Hörbarkeit beträgt 0 dB (A), die Schmerzschwelle liegt bei 130 dB (A). Dauernder Lärm kann sich auf den Menschen unterschiedlich auswirken. Eine Belastung von 40 60 dB (A) während dem Tag kann Unruhe, Ärger, Konzentrationsstörungen und Unmut zur Folge haben. Belastungen von über 60 dB (A) verursachen Belastung des Nervensystems, Gesprächsstörungen, Blutdruckanstieg. Während der Nacht bewirken Töne von über 45 dB (A) Schlafstörungen (auch wenn man dabei nicht erwacht!!) Gesundheitliche Auswirkungen von Lärm auf den Menschen Schwerhörigkeit ist ein Krankheitszeichen, das verschiedene Ursachen haben kann. Vorübergehende Schwerhörigkeit findet sich beim Ohrenschmalzpfropfen und bei der Fremdkörpereinklemmung im Gehörgang. Beides kann durch Ausspülen mit Wasser behandelt werden. Akute Mittelohrentzündung und Tubenkatarrh ( Schleimhautschwellung in der Ohrtrompete) erzeugen ebenfalls eine vorübergehende Schwerhörigkeit. Schwerhörigkeit kann ausserdem durch indirekte Auswirkungen von Schlag, Stoss oder Fall zustande kommen. Knall und Explosion lassen nach anfänglicher Besserung häufig einen Dauerschaden zurück. Chronischer ( dauernder) Lärm kann im Bereich der Innenohrsinneszellen Entartungs- und sogar Rückbildungsvorgänge auslösen (beispielsweise bei Schmieden, Stahlarbeitern, bei häufigen Discobesuchen, Kopfhörer tragen etc.), was eine dauernde Schwerhörigkeit oder Hörverlust zur Folge hat. Februar 10/ep 9 OS Gampel Naturlehre Kommunikation 3. OS LÖSUNG Ein Hörverlust kann viele Ursachen haben: • Erkrankung des Innenohres durch: • Infektionen • Überlastung des Gehörs (zu hohe Lautstärke)!! • Altersschwerhörigkeit Das menschliche Gehör hat nur bei jungen Menschen einen Frequenzumfang von etwa 20 Hz bis 20 kHz. Mit zunehmendem Alter wird das Hörfeld deutlich eingeschränkt. • Angeborene Schwerhörigkeit (Oft durch Infektionskrankheiten der Mutter Schwangerschaft übertragen; Masern, Röteln) während der • Schalltrauma Ein heftiger, kurzer Schall, wie ein Knall, Schuss oder eine Explosion, kann das Gehör irreparabel schädigen. Dieselbe Störung tritt auch bei langanhaltendem oder häufigem Lärm auf. • Tinnitus Tinnitus oder besser bekannt unter „Ohrensausen ist ein ernstzunehmendes Anzeichen einer sich anbahnenden Hörschädigung!) Hier helfen nur Vorsichtsmassnahmen: • Hörschutzgeräte tragen • dem Lärm ausweichen • Lärm verhindern Auftrag: Notiere für dich aktuelle Lärmquellen und gib jeweils an, mit welchen Vorsichtsmassnahmen eine Hörschädigung vermieden werden kann.individuell Februar 10/ep 10 OS Gampel