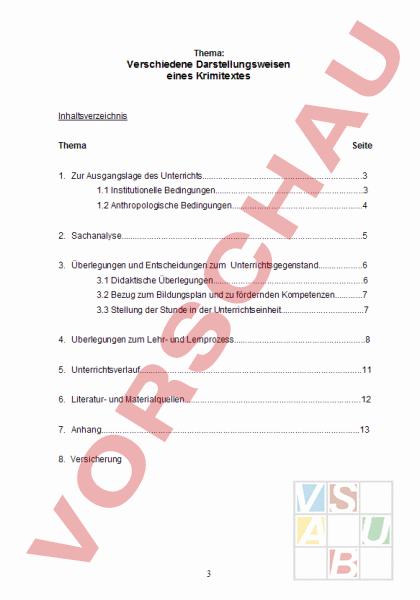Arbeitsblatt: Unterrichtsentwurf Krimi
Material-Details
Handlungs-und produktionsorientierter Umgang mit Krimis: Comics zeichnen, Hörspiel, Texte weiterschreiben, Theaterspiel
Deutsch
Texte schreiben
6. Schuljahr
17 Seiten
Statistik
5417
4039
178
19.03.2007
Autor/in
Patricia Koebrich
Haibe 8
D- 72218 Wildberg
D- 72218 Wildberg
oo497054-932295
Land: Deutschland
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Thema: Verschiedene Darstellungsweisen eines Krimitextes Inhaltsverzeichnis Thema Seite 1. Zur Ausgangslage des Unterrichts.3 1.1 Institutionelle Bedingungen3 1.2 Anthropologische Bedingungen.4 2. Sachanalyse.5 3. Überlegungen und Entscheidungen zum Unterrichtsgegenstand.6 3.1 Didaktische Überlegungen.6 3.2 Bezug zum Bildungsplan und zu fördernden Kompetenzen7 3.3 Stellung der Stunde in der Unterrichtseinheit.7 4. Überlegungen zum Lehr- und Lernprozess.8 5. Unterrichtsverlauf.11 6. Literatur- und Materialquellen12 7. Anhang13 8. Versicherung 3 1.2 Anthropologische Bedingungen Sachstruktureller Entwicklungsstand Im ersten Kurstreffen sollten die Schüler Auskunft über ihre bisherigen Erfahrungen mit Krimis geben. Viele nannten bekannte Krimiserien wie: „K11 „Niedrig und Kundt, „Columbo und „Mord ist ihr Hobby. Krimiautoren, sowohl klassische wie moderne, waren ihnen unbekannt. Ein Schüler vermutete, dass „Sherlock Holmes ein Autor gewesen wäre. Einige Schüler nannten Strukturelemente von Krimis wie: Motiv, Alibi, Täter, Opfer und Detektiv. Gemeinsam wurden anhand eines Kurzkrimis typische Krimielemente herausgearbeitet. Wir stellten dabei fest, dass ein Krimi stets ein Verbrechen und seine Auflösung behandelt. Neben „Mord und „Diebstahl, fielen als Verbrechensdefinition auch Begriffe wie „Entführung und „sexueller Missbrauch. Den Schülern gelang es, den Kurzkrimi „Mord am Abend in ein Rollenspiel umzusetzen und anschließend Vermutungen über den Täter anzustellen. Sie waren außerdem in der Lage einen Weg zu schildern, wie die Polizei den Täter überführen könnte. In dieser Stunde werden die Schüler mit einem Text konfrontiert, der ihnen noch mehr Gelegenheit zum eigenen Nachdenken und Gestalten bietet. In der Folgestunde werden wir uns mit der „Figur des Detektivs am Beispiel von Rätselkrimis beschäftigen. 2. Sachanalyse Für die Textart, die vor allem Verbrechen und Mord thematisiert, hat sich der Oberbegriff „Krimi in der literaturwissenschaftlichen Forschung durchgesetzt. Der Krimi entstand im 18. Jahrhundert als Produkt der Aufklärung. Als Vorläufer des Krimis gelten Schauer – und Abenteuerromane.1 Den Anfang der Gattungsgeschichte machte Edgar Allan Poes Erzählung „The Murders in the Rue Morgue 1841. Als Nachfolger gelten Autoren wie Arthur Conan Doyle, Gilbert Keith Chesterson und Agatha Christi. Sie erschufen Detektivfiguren, die sich vor allem wegen ihrer Exzentrität und Genialität auszeichneten. Parallel dazu entwickelte sich im 19. Jahrhundert das Genre der Kinder – und Jugendkrimis. Mit Erich Kästners Roman: „Emil und die Detektive erreicht das Genre einen Höhepunkt. Der Roman beeinflusste nachhaltig die Entwicklung der Detektivgeschichten für Kinder. Weitere 1 Vgl. Lange, Günter: Krimi- Analyse eines Genres. In: Josting, Petra Stenzel, Gudrun (Hrsg.):Auf heißer Spur in allen Medien. Kinder- und Jugendkrimis zum Lesen, Hören, Sehen und Klicken, S.12. 4 klassische Kinderkrimis sind Astrid Lindgrens: „Kalle Blomquist – der Meisterdetektiv, Enid Blytons „Fünf Freunde, und Alfred Hitchcocks „Die drei ???, um nur einige zu nennen. 2 Krimis weisen spezifische Elemente auf. Der Text dreht sich um ein Verbrechen und dessen Aufklärung. Dabei gibt es eine Vorgeschichte, den Fall und die Detektion. Richard Alewyn unterscheidet zwischen dem Kriminalroman und dem Detektivroman. Er berücksichtigte dabei die unterschiedlichen Erzählweisen. Der Kriminalroman behandelt, nach Alwyn, die Geschichte eines Verbrechens. Dem Leser ist der Verbrecher früher bekannt als der Hergang der Tat. Im Gegensatz dazu thematisiert der Detektivroman die Aufklärung. Dessen typische Strukturelemente sind u.a., dass der Detektiv im Mittelpunkt der Handlung steht. Meist wird er von einem „dümmlichen Gefährten begleitet.3 Das Verbrechen steht am Anfang der Handlung, die Auflösung in der großen Schlussszene.4 Ein weiteres Element des Krimis ist die Begrenzung auf eine bestimmte Personenkonstellation. Das erleichtert dem Leser das Mitdenken. Diese Personen stehen in einer Beziehung zum Opfer. Der Krimi als Genre ist an einer realistischen Darstellungsweise interessiert. Autoren bemühen sich „Spezialkenntnisse in ihre Krimis einzubringen. „Milieutreue und räumliche Details zählen dazu. 5 3. Überlegungen und Entscheidungen zum Unterrichtsgegenstand 3.1 Didaktische Überlegungen Warum sollte man Krimis als Unterrichtsgegenstand auswählen? Der Krimi stellt eine variationsreiche und trotzdem übersichtliche Literaturgattung dar. Man kann mit ihm Schülern formale Gestaltungsprinzipien eines literarischen Textes nahe bringen und spezifische Gattungsmerkmale thematisieren. Kriminalgeschichten bieten durch ihren spannenden Erzählstil einen motivierenden Anreiz für die Schüler. Eine mögliche „Lesebarriere wird weggeräumt. „Die strukturelle Vielfalt des Krimis spiegelt sich 2 Vgl. Kammler, Clemens Wilczek Reinhard: Krimi- Neue Ansätze für eine Einbindung von Kriminalliteratur in den Deutschunterricht, S.8 –10. 3 Vgl.Mittelberg, Ekkehart: Klassische und moderne Kriminalgeschichte. Unterrichtskommentar, S. 6-8. 4 Vgl. Alewyn Richard: Der Detektiv. In: Mittelberg, Ekkehart: Klassische und moderne Kriminalgeschichte, S.126-127. 5 Vgl. Lange, Günter: Zum Krimi als literarischem Genre. In: Pech, Klaus Ulrich, Siegle, Rainer (Hrsg.):Perfekte Morde- eine Krimi –Anthologie, S.168 – 171. 5 aber auch in verschiedenen Lesemodi wieder, wie dem lustvollen Lesen (Spannungsleser), dem ausdrucksstarken performativen Lesen (Action–Szenen), dem dialogischen Lesen (Wortduelle), dem sprachbewussten oder analytischen Lesen (detektivisches Lesen).6 Bewusstes Lesen ist notwendig, wenn man dem Handlungsgang folgen möchte. Logisch–rationales und analytisches Denken wird gefördert. Je nach Lerngruppe kann es aus funktionalen Gründen legitim sein einen sprachlich unkomplizierten Text auszuwählen, wenn man die grundlegende Lesekompetenz fördern möchte. Außerdem eröffnen Krimis eine Vielzahl von Rezeptionsmöglichkeiten. Ihre Nähe zu anderen Kunstformen und Medien wie, z.B. Film oder Hörspiel können im Unterricht zur Entwicklung medialer Kompetenz dienen. Durch die literarische Figur „Detektiv erhalten die Schüler eine Identifikationsfigur. 7 3.2 Bezug zum Bildungsplan und zu fördernden Kompetenzen Bildungsplan: „Das an Interesse und Lesefreude orientierte Lesen bekommt einen bedeutenden eigenen Stellenwert. Geeignet sind Lektüren, die an Erfahrungen und Vorwissen anknüpfen, Identifikationsfiguren anbieten, unterhaltsam, überschaubar und ansprechend gestaltet sind. Die Überfrachtung mit inhaltlichen und formalen Fragestellungen ist zu vermeiden, damit Raum bleibt für Eigenaktivität und Kreativität.8 „Handlungs- und Projektorientierung sind wichtige Unterrichtsprinzipien.9 Zu fördernde Kompetenzen: Schüler können zunehmend besser: Methodenkompetenz • Arbeitsanweisungen lesen und umsetzen. • Texte auf verschiedene Art – auch handlungsorientiert – umsetzen z.B. Texte vertonen, Texte zu Bildern verarbeiten. Sozialkompetenz: 6 Vgl. Kammler, Clemens, Wilczek, Reinhard: Krimi – Neue Ansätze für eine Anbindung von Kriminalliteratur in den Deutschunterricht. In Praxis Deutsch 192/ Juli 2005 Krimi, S.6 – 14. 7 Ebd., S.11. 8 Ministerium für Kultus und Sport: Bildungsplan 2004 Hauptschule, S.56. 9 Ebd., S.55. 6 • in Gruppen arbeiten.10 3.3 Stellung der Stunde in der Unterrichtseinheit Dieser Stunde vorangegangen ist die Einführung in das Genre Krimi anhand eines Kurzkrimis. Dabei wurde den Schülern auch Gelegenheit gegeben, ihr Vorwissen zum Thema „Krimi mitzuteilen. Das Zentrum dieser Stunde soll der handlungs – und produktionsorientierte Umgang mit einem Krimitext sein. Die Schüler erhalten die Möglichkeit über mehrere Kanäle einen eigenen Zugang zu dieser Literaturgattung zu erhalten. Der Text bietet durch den fehlenden Schluss Raum für eigenes kreatives Denken. In der Folgestunde wird die „Figur des Detektivs am Beispiel von Rätselkrimis wieder aufgegriffen. Die Schüler können nun ihr eigenes Handlungsmuster mit dem der Detektivfigur vergleichen. 4. Überlegungen zum Lehr- und Lernprozess Einstieg: Nachdem ich die Schüler begrüßt habe, werde ich als stillen Impuls ein Bild mit britischen Polizisten auf den Tageslichtprojektor legen. Im Hintergrund des Bildes ist die britische Flagge zu sehen. Die Schüler dürfen sich frei dazu äußern. Das Bild bietet einen guten Anknüpfungspunkt an den Text der heutigen Stunde. Alternativ hätte ich auch das Geräusch einer Polizeisirene abspielen lassen können. Ich habe mich dagegen entschieden, da das Bild eine bessere Hinführung auf den Krimitext darstellt. Die beiden Polizisten in der Geschichte sind nicht mit der Sirene zum Tatort unterwegs. Hinführung: Nach dem Bild wird nun der Text auf den Tageslichtprojektor gelegt. Ihm zugrunde liegt ein Textauszug aus Colin Dexters: „Ihr Fall, Inspektor Morse.11 Ich habe den Textauszug schülergerecht aufbereitet. Die Straßennamen habe ich ersetzt, damit die Schüler keine Schwierigkeiten mit der Aussprache haben. Auch wurden einige schwere Textstellen ausgelassen ohne jedoch den Sinn des Textes zu verändern. Diese didaktische Reduktion war notwendig, da sonst zu 10 Ebd., S. 59/60. Vgl. Dexter, Colin: Phantasie und Wirklichkeit .In: Mittelberg, Ekkehart: Klassische und moderne Kriminalgeschichte. Unterrichtskommentar, S.67 –69. 11 7 viel Zeit auf die Erklärung einzelner Wörter verwendet werden müsste. Anstelle des Wortes Mord, fügte ich Verbrechen12 ein, damit die Schüler freier in der Darstellung der Tat sein können. Der sehr offen gehaltene Schluss wird später durch die Arbeitsanweisungen eingegrenzt, sodass die Schüler gut mit dieser Textgrundlage arbeiten können. Der Text bietet den Anfang einer klassischen Detektivgeschichte, die idealerweise noch in Großbritannien spielt. So haben die Schüler klare Vorgaben, die ihnen trotzdem genug Raum für Eigenaktivität lassen. Der Text wird zunächst selbstständig leise von den Schülern erlesen. Dann darf ein Schüler, der es sich zutraut, ihn laut vor der Klasse vorlesen. Der Inhalt des Textes wird kurz aufgegriffen, die Lösung aber nicht andiskutiert. Mögliche Fragen der Schüler zum Text werden beantwortet. Gruppeneinteilung: Mit dem Hinweis darauf, dass wir uns den Rest der Stunde mit diesem Text beschäftigen werden, klappe ich die Tafel auf. Sichtbar werden nun die vier Gruppenplakate: Hörspiel, Text weiterschreiben, Comic und Theaterspiel. Ich gehe davon aus, dass sofort einige spontane Äußerungen von den Schülern gemacht werden. Ich lege den Schülern nahe über ihre persönlichen Stärken und Interessen nachzudenken. Jeder Schüler erhält anschließend die Möglichkeit sein Namensschild einer Gruppe zuzuordnen. Alternativ hätte ich die Gruppen selbst zuteilen können. Das wäre, meiner Meinung nach, jedoch für die Lernmotivation nicht förderlich. Mir ist das „Risiko einer freien Gruppenzuordnung bewusst. Ich ziehe dabei in Betracht, dass suboptimale Gruppenkonstellationen auftreten könnten. Da ich die Lerngruppe aber erst eine Doppelstunde unterrichtet habe, könnte ich dieses Risiko auch bei einer Gruppeneinteilung nicht ausschließen. Zur Selbstständigkeitserziehung finde ich die Methode der eigenen Gruppenzuordnung sehr geeignet. Die Schüler können dabei lernen sich und ihre Fähigkeiten einzuschätzen. Wenn eine ungleiche Verteilung in den Gruppen auftritt, wird gemeinsam nach einer Lösung gesucht. Jede Gruppe benötigt eine gewisse Mindestanzahl von Mitgliedern, Die Gruppenstärke kann, je nach Schüleranzahl der heutigen Stunde, flexibel variiert werden. Sollte es zu keiner Lösung des Problems kommen, werden einige Schüler durch auswürfeln anderen 12 Vgl. im Anhang: Schülertext Zeile 9. 8 Gruppen zugeteilt. Durch den Würfel wird die Gruppenzusammensetzung nach dem Zufallsprinzip entschieden. Ich habe den handlungs- und produktionsorientierten Umgang mit dem vorliegenden Text gewählt, weil dieser Ansatz erfahrungsgemäß hochmotivierend auf die Schülerbeteiligung wirkt. Alle Lerntypen können durch einen unterschiedlichen Kanal Zugang zu dem Text, der hier exemplarisch für das Genre Krimi steht, erhalten. Ein Lernen mit allen Sinnen wird ermöglicht. Die Schüler werden von mir darüber informiert, wie viel Zeit sie zur Bearbeitung der Gruppenaufträge haben. Außerdem auch darüber, dass die Arbeitsphase durch ein akustisches Signal beendet wird. Die Schüler sollen sich dann in einem Stuhlhalbkreis vor der Tafel zusammenfinden. Arbeitsphase in den Gruppen: Jede Gruppe bekommt eine vorbereitete Kiste, die alle benötigten Materialien enthält. Die Gruppe Hörspiel hat ihren Arbeitsplatz auf dem Flur vor dem Klassenzimmer, da sie für die Kassettenaufnahmen mehr Ruhe benötigt. Aus Aufsichtsgründen wird die Klassenzimmertür während dieser Unterrichtsphase leicht geöffnet sein. Ich werde in dieser Zeit die Gruppen bei ihrer Arbeit beobachten und bei Fragen als Beraterin zur Verfügung stehen und wenn notwendig werden sollte Impulse geben. Präsentation: Ein akustisches Signal (Glöckchen) beendet die Gruppenarbeitsphase. Die Schüler kommen in einem Stuhlhalbkreis vor der Tafel zusammen. Die Gruppen präsentieren ihre erarbeiteten Ergebnisse, auch wenn diese noch nicht komplett fertig sein sollten. Die Ergebnisse werden nicht gewertet. Am Schluss jeder Präsentation darf kurz durch maximal drei Wortmeldungen, fantasiert werden, wie der Fall weitergeht und wer als Täter in Frage kommen könnte. Abschlussreflexion: 9 Die Schüler dürfen ihre Meinung zur Gruppenarbeit und ihrer Gruppenzugehörigkeit äußern. Zum Abschluss gebe ich den Gruppen noch eine kurze Rückmeldung über ihre Arbeitsweise. Anhang: Text: „Nun fahren Sie schon! „Ich werde dort sein, so schnell ich kann, Sir! Das bin ich immer. „Was soll das nun wieder heißen? Lewis bog an der Ampel links ab, hinunter in die High Street, dann über die West Bridge und schließlich vorbei an den asiatischen Lebensmittelgeschäften und den indischen Restaurants in der Park Road. „Ich meine, sagte Lewis nach einer Weile, „ hier haben wir wieder ein Verbrechen am Hals und Sie werden es schaffen dieses zu lösen, oder? Sie schaffen es immer! „Fast immer, räumte Inspektor Morse ein. „Und ich nicht. Ich habe einen kleinen Verstand! Unterschätzen Sie sich nicht, Lewis! Lassen Sie das die anderen für Sie tun. Fahren Sie langsamer! Inspektor Morse hatte einen Stadtplan von Oxford studiert und zeigte jetzt mit seinem Finger nach rechts. „Hier ist es, Lewis, Bond Street. Welche Nummer haben Sie gesagt? „Wahrscheinlich dort, wo die beiden Polizeiwagen stehen, Sir. Es war 8:50 Uhr an diesem trüben Montag, dem 15. Februar 1993. Die Oxford City Police hatte vor einer Stunde einen Notruf von einem gewissen Paul Bayley erhalten. Er war der Mieter des schmalen einstöckigen Hauses in der Bond Street. Als Inspektor Morse und Lewis ihren Wagen verließen, hatte sich bereits eine Gruppe Schaulustiger vor dem Haus eingefunden. 10 Comic zeichnen Arbeitsauftrag: 1. Teilt den Text in verschiedene Szenen ein, die ihr zeichnen möchtet. Überlegt euch, was am Tatort geschehen sein könnte! Zeichnet auch, wie es weitergeht. 2. Zeichnet immer nur eine Szene auf ein Blatt. Nutzt den Platz aus und zeichnet groß genug. 3. Gebt eurem Comic einen Titel. 4. Bestimmt jemanden aus eurer Gruppe, der euer Comic an der Tafel präsentiert. TIPP: Arbeitet die Aufgaben nacheinander ab und streicht diese dann durch! Hörspiel Arbeitsauftrag: 1. Schreibt den Text als Hörspieltext um. Überlegt euch, was am Tatort geschehen sein könnte. Stellt auch die Befragung der Zeugen dar. 2. Welche Rollen sind notwendig? 3. Findet einen Titel für euer Hörspiel. 4. Verteilt die Rollen und übt das Stück. Nehmt danach das Stück auf Kassette auf. 5. Bestimmt jemanden aus der Gruppe, der euer Hörspiel vor der Klasse präsentiert. TIPP: Arbeitet die Aufgaben nacheinander ab und streicht diese dann durch! 11 Text weiterschreiben Arbeitsauftrag: 1. Überlegt euch, was am Tatort geschehen sein könnte. Stellt dar, wie Inspektor Morse die Zeugen befragt. 2. Schreibt eure Geschichte auf. Findet eine passende Überschrift für sie. 3. Bestimmt jemanden aus eurer Gruppe, der euren Text vor der Klasse präsentiert. TIPP: Arbeitet die Aufgaben nacheinander ab und streicht diese dann durch! Theaterspiel Arbeitsauftrag: 1. Überlegt euch, was am Tatort geschehen sein könnte. 2. Schreibt den Text in einen Rollentext um und stellt auch die Befragung der Zeugen dar. 3. Verteilt die Rollen und probt euer Stück. 4. Überlegt euch einen Titel für euer Theaterstück. 5. Bestimmt jemanden aus eurer Gruppe, der euer Theaterstück ansagt. TIPP: Arbeitet die Aufgaben nacheinander ab und streicht diese dann durch! 12 6. Literatur- und Materialquellen • Josting, Petra Stenzel, Gudrun: Auf heißer Spur in allen Medien – Kinderund Jugendkrimis zum Lesen, Hören, Sehen und Klicken. 54.Jg.,13.Beiheft 2002. • Ministerium für Kultus und Sport Baden Württemberg: Bildungsplan 2004 Hauptschule. • Mittelberg, Ekkehart: Klassische und moderne Kriminalgeschichten,1999 Cornelsen Verlag, Berlin. • Mittelberg, Ekkehart: Klassische und moderne Kriminalgeschichten – Unterrichtskommentar, 1999 Cornelsen Verlag, Berlin. • Pech, Klaus – Ulrich Siegle Rainer (Hrsg.): Perfekte Morde, Ernst Klett Schulbuchverlag, Leipzig 2004. • Praxis Deutsch Zeitschrift für den Deutschunterricht Nr. 123/ Januar 1994: Handlungs – und produktionsorientierter Literaturunterricht • Praxis Deutsch Zeitschrift für den Deutschunterricht Nr. 192/ Juli 2005: Krimi. Bildnachweis: • Britische Polizisten html?pbild1 • Clip Arts Microsoft Works Suite 2000. Picture it! 2000 Setup und Picture Art. 13 14 Thema: Verschiedene Darstellungsweisen eines Krimitextes Klasse/Gruppe: Krimiworkshop 5-7 Phase Zeit Lehrer- Schüler- Interaktion Medien Einstieg Ca. 3 min Die Lehrerin begrüßt den Besuch und die Schüler. Impulsbild mit den Polizisten wird auf den TLP gelegt. Schüler betrachten dieses und dürfen sich dazu äußern. Folie mit dem Bild von britischen Polizisten Hinführung Ca.7 min Als weiteren Impuls wird der Text auf den TLP gelegt. Schüler erlesen diesen zuerst leise für sich. Ein Schüler, der es sich zutraut darf den Text laut vorlesen. Die Schüler dürfen sich nach dem Lesen dazu äußern. Entstandene Fragen werden beantwortet. Folie mit dem Text Gruppeneinteilung Ca. 5 min Die Tafel wird aufgeklappt. Die Gruppenplakate hängen an der Innenseite. Jeder Schüler bekommt die Möglichkeit, sich nach seinen Stärken und Vorlieben einer Gruppe zuzuordnen. Da die Gruppenkapazität begrenzt ist, wird bei einer ungleichen Verteilung gewürfelt. Tafel, Magnete Gruppenplakate, Namenskärtchen, Würfel Arbeitsphase in den Gruppen Materialkisten Ca.20 Die Schüler bekommen pro Gruppe Hörspiel Comic/ Text weiter schreiben/ Min Theaterspiel) eine Kiste mit vorbereiteten Materialien. Die Lehrerin ordnet den Gruppen ihren Arbeitsplatz zu. Die Schüler arbeiten in ihren Gruppen. Die Lehrerin steht als Beraterin zur Verfügung und gibt notfalls Impulse. Präsentation Ca.20 Ein akustisches Signal beendet die Arbeitsphase. Die Schüler kommen im Stuhlhalbkreis Glöckchen min vor der Tafel zusammen. Die Gruppen stellen ihre Ergebnisse vor. Nach jeder Gruppe darf kurz fantasiert werden, wer wohl der Täter sein könnte. Abschlussreflexion Ca.5 min Die Schüler dürfen ein Statement zu ihrer Arbeit in den Gruppen abgeben. Zum Abschluss gibt die Lehrerin den Gruppen kurz Rückmeldung über ihr Arbeitsverhalten. 3 4 3