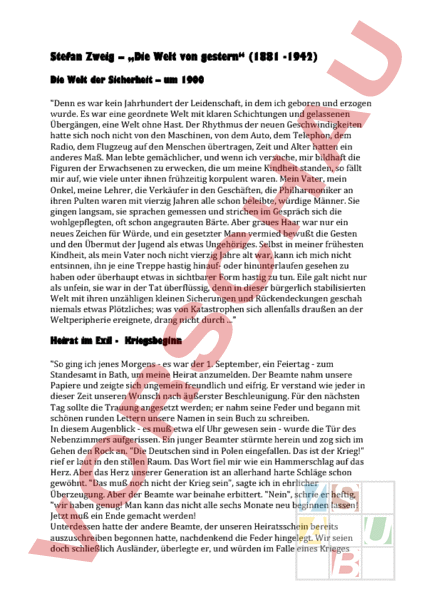Arbeitsblatt: Stefan Zweig: Die Welt von gestern
Material-Details
Auszüge aus "Die Welt von gestern" (St.Zweig): Als Einstiegslektüre in den ersten Weltkrieg
(Vor dem Krieg, während dem Kriegsbeginn).
Geschichte
Neuzeit
9. Schuljahr
2 Seiten
Statistik
54285
1502
8
07.02.2010
Autor/in
Tobias Hochstrasser
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Stefan Zweig – „Die Welt von gestern (1881 -1942) Die Welt der Sicherheit – um 1900 Denn es war kein Jahrhundert der Leidenschaft, in dem ich geboren und erzogen wurde. Es war eine geordnete Welt mit klaren Schichtungen und gelassenen Übergängen, eine Welt ohne Hast. Der Rhythmus der neuen Geschwindigkeiten hatte sich noch nicht von den Maschinen, von dem Auto, dem Telephon, dem Radio, dem Flugzeug auf den Menschen übertragen, Zeit und Alter hatten ein anderes Maß. Man lebte gemächlicher, und wenn ich versuche, mir bildhaft die Figuren der Erwachsenen zu erwecken, die um meine Kindheit standen, so fällt mir auf, wie viele unter ihnen frühzeitig korpulent waren. Mein Vater, mein Onkel, meine Lehrer, die Verkäufer in den Geschäften, die Philharmoniker an ihren Pulten waren mit vierzig Jahren alle schon beleibte, würdige Männer. Sie gingen langsam, sie sprachen gemessen und strichen im Gespräch sich die wohlgepflegten, oft schon angegrauten Bärte. Aber graues Haar war nur ein neues Zeichen für Würde, und ein gesetzter Mann vermied bewußt die Gesten und den Übermut der Jugend als etwas Ungehöriges. Selbst in meiner frühesten Kindheit, als mein Vater noch nicht vierzig Jahre alt war, kann ich mich nicht entsinnen, ihn je eine Treppe hastig hinauf- oder hinunterlaufen gesehen zu haben oder überhaupt etwas in sichtbarer Form hastig zu tun. Eile galt nicht nur als unfein, sie war in der Tat überflüssig, denn in dieser bürgerlich stabilisierten Welt mit ihren unzähligen kleinen Sicherungen und Rückendeckungen geschah niemals etwas Plötzliches; was von Katastrophen sich allenfalls draußen an der Weltperipherie ereignete, drang nicht durch . Heirat im Exil Kriegsbeginn So ging ich jenes Morgens es war der 1. September, ein Feiertag zum Standesamt in Bath, um meine Heirat anzumelden. Der Beamte nahm unsere Papiere und zeigte sich ungemein freundlich und eifrig. Er verstand wie jeder in dieser Zeit unseren Wunsch nach äußerster Beschleunigung. Für den nächsten Tag sollte die Trauung angesetzt werden; er nahm seine Feder und begann mit schönen runden Lettern unsere Namen in sein Buch zu schreiben. In diesem Augenblick es muß etwa elf Uhr gewesen sein wurde die Tür des Nebenzimmers aufgerissen. Ein junger Beamter stürmte herein und zog sich im Gehen den Rock an. Die Deutschen sind in Polen eingefallen. Das ist der Krieg! rief er laut in den stillen Raum. Das Wort fiel mir wie ein Hammerschlag auf das Herz. Aber das Herz unserer Generation ist an allerhand harte Schläge schon gewöhnt. Das muß noch nicht der Krieg sein, sagte ich in ehrlicher Überzeugung. Aber der Beamte war beinahe erbittert. Nein, schrie er heftig, wir haben genug! Man kann das nicht alle sechs Monate neu beginnen lassen! Jetzt muß ein Ende gemacht werden! Unterdessen hatte der andere Beamte, der unseren Heiratsschein bereits auszuschreiben begonnen hatte, nachdenkend die Feder hingelegt. Wir seien doch schließlich Ausländer, überlegte er, und würden im Falle eines Krieges automatisch zu feindlichen Ausländern. Er wisse nicht, ob eine Eheschließung in diesem Falle noch zulässig sei. Es tue ihm leid, aber er wolle sich jedenfalls nach London um Instruktionen wenden. Dann kamen noch zwei Tage Warten, Hoffen, Fürchten, zwei Tage der grauenhaftesten Spannung. Am Sonntagmorgen verkündete das Radio die Nachricht, England habe Deutschland den Krieg erklärt. Kriegstaumel im kaiserlichen kaiserlichen Wien „Am nächsten Morgen in Östereich!. Die Züge füllten sich mit frisch eingerückten Rekruten, Fahnen wehten. Musik dröhnte, in Wien fand ich die ganze Stadt in einem Taumel. Der erste Schrecken über den Krieg.war um geschlagen in einen plötzlichen Enthusiasmus.Um der Wahrheit die Ehre zu geben, muss ich bekennen, dass in diesem Aufbruch etwas Grossartiges, Hinreissendes und Verführerisches lag, dem man sich schwer entziehen konnte. Wie nie fühlten sich Tausende und Hunderttausende Menschen, was sie besser im Frieden hätten fühlen sollen: dass sie zusamengehörten. Alle Unterschiede der Stände, der Sprachen, der Klassen, der Religionen waren überflutet für diesen einen Augenblick von dem strömenden Gefühl der Brüderlichkeit. Was wussten, nach fast einem halben Jahrhundert des Friedens, die grossen Massen vom Kriege? Sie kannten ihn nicht, er war eine Legende. Sie sahen ihn immer noch aus der Perspektive der Schullesebücher und der Bilder in den Galerien: Blendende Reiterattacken in blitzblanken Uniformen, der tödliche Schuss jeweils grossmütig mitten ins Herz, der ganze Feldzug ein schmetternder Siegesmarsch. Ein wildes und männliches Abenteuer – so malte sich der Krieg 1914 in der Vorstellung des einfachen Mannes, und die jungen Menschen hatten sogar ehrlich Angst, sie könnten das Wundervoll-Erregende in ihrem Leben verpassen; deshalb drängten sie ungestüm zu den Fahnen, deshalb jubelten und sangen sie in den Zügen, die sie zur Schlachtbank führten. Wien um 1900