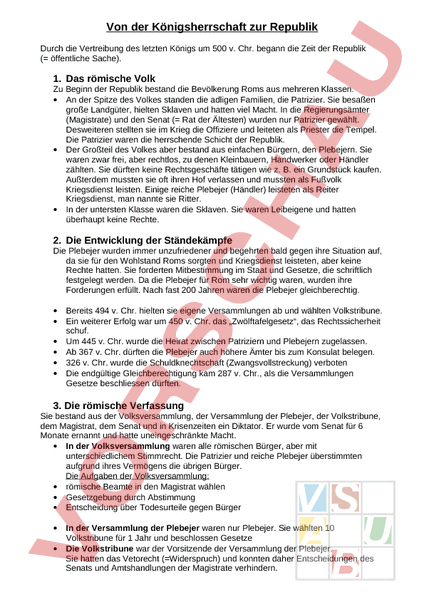Arbeitsblatt: Römische Verfassung
Material-Details
Republik in Rom Verfassung Ständekämpfe Plebejer Patrizier
Volksversammlung Tribune Senat Magistrat
Geschichte
Mittelalter
9. Schuljahr
2 Seiten
Statistik
54824
1519
5
15.02.2010
Autor/in
Silvia Sauter
Land: Deutschland
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Von der Königsherrschaft zur Republik Durch die Vertreibung des letzten Königs um 500 v. Chr. begann die Zeit der Republik ( öffentliche Sache). 1. Das römische Volk Zu Beginn der Republik bestand die Bevölkerung Roms aus mehreren Klassen. • An der Spitze des Volkes standen die adligen Familien, die Patrizier. Sie besaßen große Landgüter, hielten Sklaven und hatten viel Macht. In die Regierungsämter (Magistrate) und den Senat ( Rat der Ältesten) wurden nur Patrizier gewählt. Desweiteren stellten sie im Krieg die Offiziere und leiteten als Priester die Tempel. Die Patrizier waren die herrschende Schicht der Republik. • Der Großteil des Volkes aber bestand aus einfachen Bürgern, den Plebejern. Sie waren zwar frei, aber rechtlos, zu denen Kleinbauern, Handwerker oder Händler zählten. Sie dürften keine Rechtsgeschäfte tätigen wie z. B. ein Grundstück kaufen. Außterdem mussten sie oft ihren Hof verlassen und mussten als Fußvolk Kriegsdienst leisten. Einige reiche Plebejer (Händler) leisteten als Reiter Kriegsdienst, man nannte sie Ritter. • In der untersten Klasse waren die Sklaven. Sie waren Leibeigene und hatten überhaupt keine Rechte. 2. Die Entwicklung der Ständekämpfe Die Plebejer wurden immer unzufriedener und begehrten bald gegen ihre Situation auf, da sie für den Wohlstand Roms sorgten und Kriegsdienst leisteten, aber keine Rechte hatten. Sie forderten Mitbestimmung im Staat und Gesetze, die schriftlich festgelegt werden. Da die Plebejer für Rom sehr wichtig waren, wurden ihre Forderungen erfüllt. Nach fast 200 Jahren waren die Plebejer gleichberechtig. • • • • • • Bereits 494 v. Chr. hielten sie eigene Versammlungen ab und wählten Volkstribune. Ein weiterer Erfolg war um 450 v. Chr. das „Zwölftafelgesetz, das Rechtssicherheit schuf. Um 445 v. Chr. wurde die Heirat zwischen Patriziern und Plebejern zugelassen. Ab 367 v. Chr. dürften die Plebejer auch höhere Ämter bis zum Konsulat belegen. 326 v. Chr. wurde die Schuldknechtschaft (Zwangsvollstreckung) verboten Die endgültige Gleichberechtigung kam 287 v. Chr., als die Versammlungen Gesetze beschliessen dürften. 3. Die römische Verfassung Sie bestand aus der Volksversammlung, der Versammlung der Plebejer, der Volkstribune, dem Magistrat, dem Senat und in Krisenzeiten ein Diktator. Er wurde vom Senat für 6 Monate ernannt und hatte uneingeschränkte Macht. • In der Volksversammlung waren alle römischen Bürger, aber mit unterschiedlichem Stimmrecht. Die Patrizier und reiche Plebejer überstimmten aufgrund ihres Vermögens die übrigen Bürger. Die Aufgaben der Volksversammlung: • römische Beamte in den Magistrat wählen • Gesetzgebung durch Abstimmung • Entscheidung über Todesurteile gegen Bürger • In der Versammlung der Plebejer waren nur Plebejer. Sie wählten 10 Volkstribune für 1 Jahr und beschlossen Gesetze • Die Volkstribune war der Vorsitzende der Versammlung der Plebejer. Sie hatten das Vetorecht (Widerspruch) und konnten daher Entscheidungen des Senats und Amtshandlungen der Magistrate verhindern. • • • • • Magistrate wurden für 1 Jahr gewählt. An der Spitze des Magistrats standen zwei Konsuln, dann 6 – 8 Prädoren, 4 Ädilen, 20 Quästoren. Die Aufgaben der Magistrate reichten vom Verwalter der Geldkasse bis zur Führung des Heeres. Der Senat bestand aus ca. 300 ehemaligen Magistraten. Sie besaßen aufgrund ihres Reichtums und ihrem Adelstitel großen Einfluß. Die Senatoren wurden auf Lebenszeit ernannt. Der Senat hatte eine beratende Funktion: Sie bereiteten Gesetze vor Beamte waren an die Beschlüsse gebunden sie berieten die Magistrate