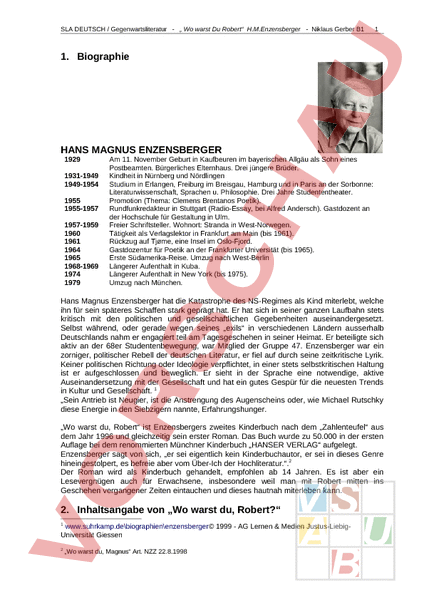Arbeitsblatt: "Wo warst du Robert?"
Material-Details
Eine ausführliche Arbeit zum Buch "Wo warst du Robert?" von H.M.Enzensberger als Arbeitsmittel zur Klassenlektüre (Klassensatz bei ZKL verfügbar)
Deutsch
Leseförderung / Literatur
9. Schuljahr
15 Seiten
Statistik
57348
3039
43
20.03.2010
Autor/in
Niklaus Gerber
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
SLA DEUTSCH Gegenwartsliteratur „ Wo warst Du Robert H.M.Enzensberger Niklaus Gerber B1 1 1. Biographie HANS MAGNUS ENZENSBERGER 1929 1931-1949 1949-1954 1955 1955-1957 1957-1959 1960 1961 1964 1965 1968-1969 1974 1979 Am 11. November Geburt in Kaufbeuren im bayerischen Allgäu als Sohn eines Postbeamten. Bürgerliches Elternhaus. Drei jüngere Brüder. Kindheit in Nürnberg und Nördlingen Studium in Erlangen, Freiburg im Breisgau, Hamburg und in Paris an der Sorbonne: Literaturwissenschaft, Sprachen u. Philosophie. Drei Jahre Studententheater. Promotion (Thema: Clemens Brentanos Poetik). Rundfunkredakteur in Stuttgart (Radio-Essay, bei Alfred Andersch). Gastdozent an der Hochschule für Gestaltung in Ulm. Freier Schriftsteller. Wohnort: Stranda in West-Norwegen. Tätigkeit als Verlagslektor in Frankfurt am Main (bis 1961). Rückzug auf Tjøme, eine Insel im Oslo-Fjord. Gastdozentur für Poetik an der Frankfurter Universität (bis 1965). Erste Südamerika-Reise. Umzug nach West-Berlin Längerer Aufenthalt in Kuba. Längerer Aufenthalt in New York (bis 1975). Umzug nach München. Hans Magnus Enzensberger hat die Katastrophe des NS-Regimes als Kind miterlebt, welche ihn für sein späteres Schaffen stark geprägt hat. Er hat sich in seiner ganzen Laufbahn stets kritisch mit den politischen und gesellschaftlichen Gegebenheiten auseinandergesetzt. Selbst während, oder gerade wegen seines „exils in verschiedenen Ländern ausserhalb Deutschlands nahm er engagiert teil am Tagesgeschehen in seiner Heimat. Er beteiligte sich aktiv an der 68er Studentenbewegung, war Mitglied der Gruppe 47. Enzensberger war ein zorniger, politischer Rebell der deutschen Literatur, er fiel auf durch seine zeitkritische Lyrik. Keiner politischen Richtung oder Ideologie verpflichtet, in einer stets selbstkritischen Haltung ist er aufgeschlossen und beweglich. Er sieht in der Sprache eine notwendige, aktive Auseinandersetzung mit der Gesellschaft und hat ein gutes Gespür für die neuesten Trends in Kultur und Gesellschaft. 1 „Sein Antrieb ist Neugier, ist die Anstrengung des Augenscheins oder, wie Michael Rutschky diese Energie in den Siebzigern nannte, Erfahrungshunger. „Wo warst du, Robert ist Enzensbergers zweites Kinderbuch nach dem „Zahlenteufel aus dem Jahr 1996 und gleichzeitig sein erster Roman. Das Buch wurde zu 50.000 in der ersten Auflage bei dem renommierten Münchner Kinderbuch „HANSER VERLAG aufgelegt. Enzensberger sagt von sich, „er sei eigentlich kein Kinderbuchautor, er sei in dieses Genre hineingestolpert, es befreie aber vom Über-Ich der Hochliteratur2 Der Roman wird als Kinderbuch gehandelt, empfohlen ab 14 Jahren. Es ist aber ein Lesevergnügen auch für Erwachsene, insbesondere weil man mit Robert mitten ins Geschehen vergangener Zeiten eintauchen und dieses hautnah miterleben kann. 2. Inhaltsangabe von „Wo warst du, Robert? 1 www.suhrkamp.de\biographien\enzensberger 1999 AG Lernen Medien Justus-LiebigUniversität Giessen 2 „Wo warst du, Magnus Art. NZZ 22.8.1998 SLA DEUTSCH Gegenwartsliteratur „ Wo warst Du Robert H.M.Enzensberger Niklaus Gerber B1 2 Der Roman „Wo warst du, Robert handelt von einem vierzehnjährigen aufgeweckten und eigenständigen Jungen. Die Geschichte spielt um 1995 in Deutschland, in der Küche im Hause seiner Familie – beginnend im Prolog und endend im Epilog. In den sieben dazwischen liegenden Kapiteln ist er auf Zeitreisen in andere Länder, in andere Zeiten. Er „leidet unter einem sonderbaren Tick, indem er in konzentrierter Geistesabwesenheit, die Augen reibt und Dinge sieht, die nur er sehen kann. Seine Eltern vermuten ein Augenleiden und haben wenig Verständnis für seine Träumereien. Als er eines Tages alleine zuhause vor dem Fernseher sitzt und sich in eine Szene eines russischen Filmes vertieft, sich dabei die Augen reibt, taucht er unversehens mitten in die Szene im Film und findet sich wachen Geistes in Sibirien um 40 Jahre zurückversetzt. Auf diese Weise gleitet er sieben Mal zeitlich rückwärts mitten in ein Geschehen, das ihm in der vorausgegangenen Welt als Bild begegnet ist. In seinen Hosentaschen führt er ständig irgendwelche Utensilien mit, die ihn in die zurückliegenden Epochen begleiten und dort immer wieder Verwunderung auslösen. Er geniesst diese Reisen, er lernt Neues, lebt verschiedene Rollen, erlebt schönes und Schwieriges. Während der siebten Reise nach Amsterdam erinnert er sich an zu Hause und sehnt sich in seine vertraute Welt zurück. Er malt die Situation, wie er vor zwei Jahren zu Hause vor dem Fernseher sass, versieht sich in das Bild, reibt sich die Augen, und dann geschieht, was immer geschieht in einer solchen Situation, er reist zurück in seine vertraute Umgebung. Seine Welt- und Zeitreise dauert zwei Jahre. Am Schluss kehrt er aber unbemerkt am Ort des Beginns seiner Reise, im Zimmer vor dem Fernseher wieder zurück Die sieben Reisen unternimmt er unbemerkt. Keiner fragt ihn, wo er gewesen sei. Die ganze Geschichte spielt von aussen betrachtet innerhalb eines Augenblicks. Robert ist um zwei Jahre älter geworden und es ist für ihn noch nicht klar, wie er in seinem vertrauten Umfeld mit seinem Zeitvorsprung umgehen soll. 3. Die Figur Roberts „Ich kann nichts dafür – es ist etwas mit meinen Augen. [] wenn man sich abends vor dem Einschlafen die Augen reibt – was man da alles sieht? Lauter bunte Bilder. Nur dass mir dabei noch ganz andere Sachen passieren. Wenn ich mir irgendwas im Kino oder Fernseher anschaue, natürlich ohne mir viele dabei zu denken, gerate ich manchmal in diesen Zustand, du weißt schon – nenn es, wie du willst -, meine Lehrerin sagt dann immer, ich sei geistesabwesend (ENZENSBERGER 1998, S. 89) Robert Robert ist ein Einzelkind wohlhabender Eltern. Das Familienleben ist äusserlich betrachtet soweit intakt. Tiefere emotionale Beziehungen werden zwischen den einzelnen Familienmitgliedern allerdings nicht gelebt. Robert ist oft mit sich allein und auf sich selber gestellt. Seine Mutter steht ihm am nächsten, sie ist vor allem um sein vermeintliches Augenleiden besorgt. Auch ausserhalb der Familie ist Robert ein Einzelgänger. Er hat nur einen wirklichen Freund Ratibor. „Ratibor ist Roberts bester Freund. Ursprünglich konnten sich die beiden nicht ausstehen, und das war kein Wunder. Weil sie sich doch in vielem völlig unterschiedlich waren, aber „eines Tages bemerkten die beiden, dass sie sich beneideten. Dann fingen sie an, einander zu bewundern. Und eines Tages stellten sie fest, dass sie zusammen unschlagbar waren. Seitdem sind sie unzertrennlich. (ENZENSBERGER 1998 S. 10/11). Robert ist ein aufgeschlossener, neugieriger und eigenständiger Junge im Alter von 14 Jahren. Er grenzt sich gerne ab und ist gerne für sich. „ doch Robert will nicht, Robert lümmelt rum.[] immer in Bewegung. Robert ist einer, der nicht stillsitzen kann. SLA DEUTSCH Gegenwartsliteratur „ Wo warst Du Robert H.M.Enzensberger Niklaus Gerber B1 3 (ENZENSBERGER 1998, S. 7). Er ist einerseits unauffällig, aber immer in Bewegung, macht einen hyperaktiven und zerstreuten Eindruck. „er ist nur zerstreut, (ENZENSBERGER 1998, S.14). Was ihn besonders kennzeichnet, ist sein geheimnisvoller Ausdruck: „Aber seine Augen sind sonderbar, sehr hell und ziemlich grün. Woher er das nur hat, diesen starren Blick, den niemanden einfangen kann? Er blickt an seiner Mutter vorbei, er schaut durch sie hindurch []. Ich weiss nicht, was diesem, Jungen fehlt, er hat doch alles. (ENZENSBERGER 1998, S. 8) fragt sich seine Mutter. Sie registriert die gewisse Eigenart Roberts und schreibt diese dem zu vielen Fernsehen und Computerspielen zu und ermahnt ihn, sich zu beschränken. In Wahrheit ist es aber diese innere Unruhe, „Ja, irgend etwas flimmert vor seinen Augen, oder in seinem Gehirn. Aber das hat nichts mit fernsehen zu tun, und es macht ihm nichts aus. Im Gegenteil, es gefällt ihm. Wie das angefangen hat weiss Robert nicht. Das ist lange her, länger als er denken kann. Er braucht nur die Augen zu schliessen, zum Beispiel vor dem Einschlafen, und schon geht es los. (ENZENSBERGER 1998, S. 8). Selbst der Arzt kann keine Abnormität seiner Augen feststellen. Das Augenkino geschieht einfach. Niemand weiss von seinen visuellen Erlebnissen und er hütet sich, sie preiszugeben. „Nein, Robert hat gelernt, sich nichts anmerken zu lassen, besonders, seitdem er auch untertags auf Empfang gegangen ist, vor allem in der Schule, im Biologieunterricht. Geistesabwesend, sagt Frau Dr Korn. Ihr Sohn ist oft geistesabwesend! (ENZENSBERGER 1998, S.9). er ist aber trotzdem nicht schlecht in der Schule, er kann sich auf sein photographisches Gedächtnis verlassen. Von seinen Lehrern hält er im allgemeinen nicht viel, die Schule scheint ihn zu langweilen. Nur den Zeichnungslehrer Winzinger hat es ihm angetan. Das photographische Gedächtnis, die Fähigkeit sich Bilder zu verinnerlichen und die Besonderheit des Augenreibens, des Flimmerns des Augenkinos sind jeweils der Ausgangspunkt seiner Reisen, die Begegnung eines Bildes, die Verinnerlichung der dargestellten Szene und das Hineintauchen in diese Welt. „Er ist müde und es wird ihm ein wenig schwindlig. Er reibt sich die Augen. Auf dem Bildschirm ganz nah tauchen zwei, drei, vier Uniformierte in langen Ledermänteln auf.[.] Neben ihr springt ein Junge ins Bild, ein behänder Teufel. Er ist von hinten nicht zu sehen, sein Nacken, seine blaue Jacke. Er sieht aus wie Robert. Aber wo ist Robert? Es wird ihm schwarz vor Augen. [] Robert ist nicht mehr da. Nur der Fernseher läuft, (ENZENSBERGER 1998, S.15/16). Er hat die Angewohnheit, sich verschiedene Gegenstände, die ihm begegnen mitlaufen zu lassen, Gegenstände, die ihn während der Reisen begleiten und ihre besondere Bedeutung erhalten werden. Robert ist einerseits ein unerschrockener und „cooler Junge. Andererseits aber vielseitig interessiert, überall wo er hinkommt, ist er lernwillig, was die Welt ihm bietet und abverlangt. Wir erleben Robert in den verschiedensten Reisen und es macht den Eindruck, dass er an allen Stationen seiner Reisen im Grunde immer derselbe ist, sich aber entwickelt und am Ende gereift in seine vertraute Umgebung zurückkehrt. 4. Formale Analyse 4.1. Zeitreise/Abenteuer Der Roman entführt den Leser in andere Welten anderer Zeiten. Er führt uns Schauplätze der Geschichte vor Augen, indem er uns mit Robert zurückreisen lässt. Er eröffnet uns die Situationen der Vergangenheit, lässt aber den Faden in unsere Gegenwart nie reissen, Robert bleibt immer der Heutige. Im Zurückreisen mit Robert verbindet sich das Vergangene unmittelbar mit der Gegenwart, insbesondere der „Besuch bei seiner Urgrossmutter im Jahre 1930 in Deutschland. Er hat dort gelebt, gewirkt und hat gewissermassen im Kleinen seine Geschichte selber mitgestaltet. 4.2. Aufbau des Romans SLA DEUTSCH Gegenwartsliteratur „ Wo warst Du Robert H.M.Enzensberger Niklaus Gerber B1 4 Der Roman gliedert sich in drei Teile. Den Prolog, die Kapitel mit den sieben Reisen und den Epilog. Im Prolog wird uns Robert in seinem Zuhause vorgestellt. Wir erfahren etwas über sein Verhältnis zur Schule und über seine Familie. Im Hauptteil werden uns die sieben Reisen vorgestellt, gegliedert in sieben Kapitel. Enzensberger legt das Hauptaugenmerk auf den Inhalt der Traumreisen und Robert steht dabei jederzeit im Zentrum der Erzählung. Die geschichtlichen Inhalte der verschiedenen Lebenswelten scheinen authentisch. Es sind zum Verständnis des Romans keine geschichtlichen Vorkenntnisse notwendig, es werden aber auch keine grösseren Zusammenhänge vermittelt. Wie zufällig werden Augenblicke aus der Vergangenheit herausgeschnitten und isoliert betrachtet. Diese wirken im Erleben des Alltages umso konkreter und unmittelbarer. Die Spannung der Geschichte wird genährt durch überraschenden Szenenwechsel und die Unabsehbarkeit des Endes. Im Epilog kehrt er wieder an seinen Ausgangspunkt zurück, in die Küche seines Elternhauses in das Jahr 1995 zurück. Er verwischt letzte Spuren seiner Abenteuer und macht sich Gedanken, wie er um viele Erfahrungen reicher, fortan sein Leben gestalten soll. In dieser Offenheit bleibt eine Spannung erhalten, es bleibt dem Leser überlassen, Roberts Leben nach seiner Rückkehr auszumahlen. 4.3. Stil/Sprache Der Roman ist in auktorialer Erzählform geschrieben. Die Sprache erscheint konzentriert und präzis und wenig ausschweifend, aber kindgerecht leicht lesbar und unkompliziert. Die Reisen haben einen einfachen Handlungsstrang, sind aber spannend geschrieben. 4.4. Übersicht der Reisen Die folgende Zusammenstellung der Inhalte der sieben Reisen hat mir als Arbeitsmittel gedient und war hilfreich als Übersicht zur besseren Erfassung der Zusammenhänge. Ich habe die Aspekte der Betrachtung so gewählt, dass die verschiedenen Rollen Roberts in den einzelnen Reisen herausgearbeitet werden konnten. Die Zusammenstellung erhebt nicht Anspruch auf Vollständigkeit. Jahr: gibt das Jahr an ,in welchem Robert zur Stelle war. Personen: alle Personen, die Robert am Ort der Reise angetroffen hat und für ihn relevant waren. Klasse/Stand und beschreibt die Lebenssituation bezüglich gesellschaftlicher, Zeitgeschehen: standesgemässer oder politischer Umstände. Kulissenerinnerungen: in all den Reisen kommen Robert Erinnerungen an ähnliche Bilder und Eindrücke aus Büchern, Filmen, Opern, etc. in den Sinn. Roberts Aufenthalt: beschreibt sehr knapp die Reiseerlebnisse Roberts Rolle: beschreibt Roberts persönliche Rolle in der Situation der Reise Roberts Verhalten: beschreibt Roberts Rollenverhalten Roberts Befinden: beschreibt Roberts Erleben, Befinden der Situation und Geschehnisse Siebensachen Robert hat immer irgendwelche Gegenstände in seinen Hosentaschen, von zu Hause hat er bereits einige mitgenommen, aber auch auf den reisen hat er sich immer wieder irgend welche „Souvenirs beschafft, die aufgeführten Gegenstände haben in der entsprechenden Reise eine bestimmte Rolle gespielt Gelerntes: auf verschiedenen Reisen hat er zum Teil völlig neue Kenntnisse und Fertigkeiten hinzugewonnen. Roberts Abgang: beschreibt die Umstände, die ihm in die jeweilig nächste Reise verholfen haben. SLA DEUTSCH Gegenwartsliteratur „ Wo warst Du Robert H.M.Enzensberger Niklaus Gerber B1 5 Übersicht der Reisen Reise Jahr Personen 1. Nowosibirsk 2. Australien 3. Zu hause Deutschland 1930 Lea, Magda, Frau Scherz, Herr Scherz Arbeiterfamilie 1956 Olga und ihre Grossfamilie, Polizei, Professor, deutscher Diplomat Aufnahme in grosser Arbeiterfamilie, ärmliche Verhältnisse im Kommunismus 1946 Caroline Lea, Michael, Mr Sutton, Crombie, Mr Arbuthnot in besserem Hause im Umfeld von Armut Zeitgeschehen Sibirische Aufstände, raue Zeiten Klassengesellschaft in Australien, klar abgegrenzt von den Ureinwohnern und Wanderarbeitern Weltwirtschaftskrise, verworrene Zeit, Hellseherei, Aberglaube Kulissenerinne rung Chaplin Film Szene in Theaterstück die Schatzinsel Roberts Aufenthalt gerät zwischen die Fronten einer Demo, in Olgas Familie, Verhaftung nach Nowosibirsk und Moskau freundliche Aufnahme durch Leas Familie, Caroline. möchte mit ihm weg, es gelingt nicht, er verrät ihr sein Geheimnis, sie denkt er sei verrückt Probefahrt mit Crombie, Vorwürfe Michaels Roberts Rolle in Windeln gewickelt Von der Pflegemutter geliebt, pfelgebedürftig, krank, in Hausgemeinschaft integriert prominenter Spion, sehr ergiebiger Fund von der Pflegemutter geliebt, Entdecker, Finder, Spielgefährte, Geliebter er erfuhr manches, wovon Leas Familie keine Ahnung hatten vertraute Heimatstadt, erinnerungen im Schwimmbad, Heilsarmee, Suche der Grossmutter, stört sich an Judenplakaten, Teddybär für Magda, er will ihr das Geheimnis anvertrauen, Streit mit Scherz, er gerät in Demo, wird verletzt von der Pflegemutter geliebt, ich habe das zweite Gesicht, sie glaubte ihm alles, er wusste mehr, als die anderen, Macht, Erregung, emanzipierter Besserwisser, geschäftstüchtig Klasse/Stand 4. Norwegen 5. Westfalen 1860 Pfarrer, Mogens (Künstler) Tidemann Emmanuel (Lehrer) einfaches Fischerdorf, abgelegen, hinterweltlerisch, spiessbürgerlich abgelegenes Dorf Spiessbürger, Künstler und Spinner 1702 Prinzessin, Treibnitz (Philosoph) 1648 Ratibor, Räuberbande 1621 Meister David und seine Frau Adel, Fürstenclan Räuberbande Künstler, bescheidene Verhältnisse, Weltstadt höfisches Treiben, oberflächlich mehr Schein als Sein im Kontrast dazu Intellektuelle, Philosophie Märchenbücher, Hollywood, Oper im Schlosspark er verliebt sich in die Prinzessin, Bekanntschaft mit Treibnitz, nimmt am Leben teil, wird von der Prinzessin versetzt. Robert geht mit Treibnitz weg vom Schloss, Frustration Treibnitz am perfekteren Rechner Roberts unbedeutender Gast, Wissender, höfischer Zeitvertreib, standeskritisch, Hellseher, Wunderkind verlorner Sohn, vorwitzig, Überlegenheit, Macht, er fühlt sich dieser Gesellschaft Dreissigjähriger Krieg, Gewalt, Anarchie, Wunderwerke und Schweinereien städtisches Treiben, Blüte der Künste blutrünstiger Räuber Maler sucht die Räuberbande auf, wird integriert, engagiert sich, erlebt Ridomars Hinrichtung, muss flüchten, gerät in Hinterhalt, das vielsagende Bild in die Ewigkeit im bunten Amsterdam, zu Hause bei Meister David, Beginn der Malerlehre Sein eigenes Werk integriert, Führungsrolle, selbständig, engagiert, Berater, Visionär, Angeber, Unternehmer, wer bin ich eigentlich? Die Frage der verschiedenen Roberts der Lernende, disziplinierte verlorener Sohn, die alten Meister, eine Vorliebe für Geschichte Struwelpeter Logie beim sensationslüsternen Pfarrer, beim Freund Mogens, dann bei Tidemann bis Robert seine Geschichte beweisen will, stirbt Tidemann Findelkind, R. ist Mittelpunkt des Geschehens, hält sich verdeckt, Heimweh, Sensation, Entzauberung, verachtet, gemieden, bei Tidemann geistesverwandt, Seher ohne Zauberei, Wissender, 6. Strassburg 7. Amsterdam SLA DEUTSCH Gegenwartsliteratur „ Wo warst Du Robert H.M.Enzensberger Niklaus Gerber B1 R. Verhalten bei Olga integriert, freundschaftlich bringt die Verwaltung in Aufruhr, widerspenstig lebenslustig, angepasst, abenteuerlustig, verliebt, verkracht sich mit Michael sorgt für Gastfamilie, verdient sich den Lebensunterhalt, verkracht sich mit Scherz R. Befinden mütterliche Geborgenheit bei Olga, Vertrautheit, war stolz auf die prominente Eskorte und den Zirkus um ihn, stolz wie sie wohl zu Hause auf sein Verschwinden reagierten? Schlafwandler, er war Lea sehr dankbar, ärgert sich am Hauslehrer, verliebt in Caroline, er ist glücklich, nach Querelen mit Michael will er weg, ob sie ihn zu Hause überhaupt vermissten? Scherz mag ihn nicht, er langweilt sich zunehmend, wohl oder übel musste er sich in der Vergangenheit zurechtfinden, Überall der unangenehme Ton Siebensachen Kugelschreiber als Rechner u.a., Souvenir: KGB-Stempel und russisches Wörterbuch russisch russisches Wörterbuch, Feuerrad Souvenir: Opal Groschen, sie sind der handgreifliche Beweis, dass er er war Gelerntes R. Abgang1623 Reise seine Lage ist ausweglos Flucht ins Kino, Verzweiflung, Selbstmitleid 1. Nowosibirsk Kricket, Opale schürfen er erkennt in Leas Fotoalbum das Schwimmbad seines Dorfes, unerreichbar? tritt ein in den Moment der Entstehung des Bildes 2. Australien wird in Demo verletzt, Laden, Stich 3. Zu hause Deutschland 6 eigenständig, Sensation/Reflektion/ Identität Robert spielt mit seiner Rolle, hält sich vor den Spiessbürgern bedeckt, vor seinen Freunden möchte er verstanden werden überlegen Intellektueller Flegel Gespiele, er bleibt am Rande es Geschehens integrierend, balancierend zwischen Preisgabe und Zurückhaltung R. irritiert Treibnitz er kann nicht fechten, jagen tanzen, zu viele Bücher gelesen, ist nicht des richtigen Standes und erlangt deshalb die Liebe nicht, bei Treibnitz fühlt er sich wohl unter seinesgleichen Führungsrolle aktiv, entschlossen, neugierig, fatalistisch: „was sollte er machen? geschätzter Lehrling, pflichtbewusst, diszipliniert findet sich gut zurecht, Zweifel war das seine Person? wie ein Korken auf dem Meer verwildern, er reitet fort auf der Flucht vor sich selbst, Schuld am Tod Ratibors Siebensachen sind der einzige Beweis seiner Identität Porsche, Bild Ridomars nicht müde frisch neugierig, auf jedes Abenteuer gefasst, von einem Schlamassel in den anderen geraten, begeistert von der Malkunst, es führte ihn eine unsichtbare Hand Sehnsucht nach Hause Foto Ridomar, Gulden von1630 Kupferstiche Höfischer Alltag wirtschaften malen nach dem Tod von Tiedemann flüchtet er auf das Schiff, versieht sich in ein Gemälde Tränen des Auges, Blutegel, Ekel Blick in der Prinzessin Album, Intrige, Raubüberfall, in den Schacht der Zeit gestürzt Falle in brennendem Haus, Gemälde, Russ in den Augen er träumt sein Bild voraus, „sucht es getreu haargenau nichts falsch machen zu malen, im zweiten Versuch klappt es ist ihm langweilig, Interesse mag er nicht, Desinteresse mag er nicht, die Schwebe der Wahrheit, er will kein gewöhnlicher sein, Tidemanns „Mitwissen verunsichert ihn, Heimweh Brief an Mutter alle Siebensachen 4. Norwegen 5. Westfalen 6. Strassburg 7. Amsterdam SLA DEUTSCH Gegenwartsliteratur „ Wo warst Du Robert H.M.Enzensberger Niklaus Gerber B1 7 4.5. Roberts verschiedene Rollen im Kontext verschiedener Situationen Robert tritt seine Reisen an, indem er langweilige, unangenehme oder bedrohliche Situationen flieht. Das Reiseziel ergibt sich in der jeweiligen Situation und einem darin vorhandenen Abbild einer früheren Episode in der Geschichte. Er wählt sich das Reiseziel nicht vorsätzlich, es stösst ihm zu oder er steuert unbewusst darauf hin und nimmt es wahr. Der Antritt erfolgt aber aktiv, indem er das Bild im Fernseher, als Druck oder gemalt wahr nimmt, sich darin vertieft und seine Augen reibt. Unversehens findet er sich am Ort des Bildes wieder. Kaum angekommen, kann er sich schnell orientieren und nimmt unmittelbar am Geschehen teil. Seine wirkliche Herkunft und Identität ist ihm jederzeit bewusst. Die in den Hosentaschen mitgeführten „Siebensachen sind ihm jederzeit der Beweis seiner Herkunft und der Wirklichkeit seiner Erfahrungen. Bei allen Reisen lebt er sich in einer ersten Phase in die angetroffene Welt gut ein, lernt Sprachen, Umgangsformen, Fertigkeiten und fügt sich rasch in die soziale Situation ein. In einer zweiten Phase tritt er aus der Unscheinbarkeit heraus und es kommt zu Auseinandersetzungen und Konfrontationen. Bis sich die Krisen jeweils zuspitzen und Robert in die Flucht zur neuen Reise zwingen. Robert fragt sich selber, ob er auf all den verschiedenen Reisen der Gleiche sei und er wird sich angesichts der kontrastierenden Schauplätze selber oft fremd. Robert bleibt aber Robert, so verschieden die Rollen in den unterschiedlichen Situationen auch sind, ist er immer im Besitze seines Bewusstseins und seiner Persönlichkeit. Die Situationen in den verschiedenen Reisen charakterisiert Robert wiefolgt: 1. Reise: Sibirien „untergekrochen 2. Reise: Australien „Carolines Freund und Glückspilz 3. Reise: In seiner Heimatstadt in Deutschland „Untermieter bei der Grossmutter 4. Reise: Norwegen „Findelkind 5. Reise: Westfalen „als Page im Schloss und Adlatus vom Treibnitz 6. Reise: Elsass „blutrünstiger Strassenräuber „ 7. Reise: Amsterdam „Lehrling Drei Reisen sollen nachfolgend näher betrachtet werden. 4.6. In Sibirien Robert landet in einer unwirtlichen, rauen Welt, „Robert hatte Angst. (ENZENSBERGER 1998, S. 18) In Windeln gewickelt wird er von Olga herzlich aufgenommen, „war er in drei Betttücher gehüllt durch die nächtliche Stadt gewandert (ENZENSBERGER 1998, S. 21). Olga, eine warmherzige Apothekerin, ist Roberts mütterliche Vertrauensperson im rauen Sibirien „, dann fütterte sie ihn wie ein kleines Kind mit dem Löffel. (ENZENSBERGER 1998, S. 25) Trotz der Unruhen nimmt sie ihn fürsorglich auf und gibt ihm eine Bleibe in ihrer Grossfamilie. Er erfährt Geborgenheit und lebt als integriertes Familienmitglied und macht sich auch nützlich. In einer zweiten Phase wird er als geheimnisvoller Spion verdächtigt und inhaftiert. Er ärgert sich zusehends über seinen unfreiwilligen Aufenthalt in Russland. Er wird nach Moskau überführt und erfährt dort eine respektvollere Behandlung, „Ich werde dafür sorgen, dass du bei uns gut behandelt wirst. Ja mein Lieber! Ich halte dich nämlich für einen sehr ergiebigen Fund. (ENZENSBERGER 1998, S. 48) verspricht ihm der zuständige Professor. Die mitgeführten „Siebensachen verleihen ihm einen Sonderstatus. Das Gehabe um seine Person verleiht ihm einen gewissen Stolz. Er weigert sich aber, über seine Herkunft Auskunft zu geben setzt sich resolut zur Wehr und bringt die Verwaltung in Aufruhr. Man droht ihm mit der Einweisung ins Irrenhaus. Er ist nahe der Verzweiflung und voller Selbstmitleid „Robert war dem Heulen nah. (ENZENSBERGER 1998, S. 57). Er flieht und rettet sich in ein Kino, wo er über einen Film in die nächste Reise abtaucht. Robert erscheint hier in einer passiven und hilfebedürftigen Kinder- und dann Opferrolle. Er setzt sich zwar resolut zur Wehr, fühlt sich aber hilflos und verlassen. SLA DEUTSCH Gegenwartsliteratur „ Wo warst Du Robert H.M.Enzensberger Niklaus Gerber B1 8 4.7. In seiner Heimatstadt in Deutschland Es ist der einzige Reiseort, den er bewusst aufsucht. „1930 das war wirklich keine gute Wahl, als hätte er sich das Ziel selber ausgesucht. (HME 1998, S. 129). Zurück zu seinen Wurzeln, seinen Vorfahren, an die Möbiusstrasse, (gleichzeitig zurück in Enzensbergers 1. Altersjahr). „Wo er diesmal gelandet war, das war sonnenklar. Aber wann? (HME 1998, S. 99). Er fühlt sich wie ein Privatdetektiv „Ein Detektiv ist immer ein Lauscher an der Wand, anders kommt er nicht ans Ziel. (HME 1998, S. 111). Die Zeit, die Ansichten und Haltungen scheinen ihm aus der Situation, aber auch aus seiner Erinnerung an Schilderungen seiner Eltern unverständlich, suspekt, „Was sie immer mit den Juden haben, dachte Robert, [] 1930 – was für eine verworrene Zeit das war! Er verstand nicht, warum sie alle aufeinander eindroschen, [] dieser unangenehme Ton am Leib, (HME 1998, S. 109/12). Er erlebt, wie unruhig und gereizt das Leben ist, Aggressivität von Seiten der Kommunisten und Nationalsozialisten. „Wohl oder übel musste er sich in der Vergangenheit zurechtfinden, die nun zu seiner Gegenwart geworden war (HME 1998, S.122). Er sucht seine Urgrossmutter auf und kommt bei ihr unter. Sie nimmt ihn freundlich auf und er kümmert sich fürsorglich um sie. Er vertraut ihr sein „zweites Gesicht an. „er wusste mehr als die anderen, [] das verlieh ihm Macht, die ihm unheimlich war, die ihn erregte (HME 1998, S.125) Er zieht die Bewunderung Magdas auf sich und erfährt sich als erfolgreichen Geschäftsmann, indem er seinen Opal verkauft. Herr Scherz ist ein pflichtbewusster und kaltschnäuziger Polizist, der ihn als Spion verdächtigt und aus dem Haus weist. Robert kümmert sich seinerseits fürsorglich um seine Vorfahren, er ist geschäftstüchtig, beschafft Geld und bemüht sich um ihr Wohlergehen. Er nimmt auch das soziale und politische Umfeld wahr und setzt sich mit der Zeit kritisch auseinander. Robert spürt den schwelenden unguten Geist dieser Zeit und erfährt dies am eigenen Leib. 4.8. In Amsterdam Trotz Roberts Verunsicherung: „Die neue Fahrt ins Ungewisse machte ihm gar nichts aus. [] Er war einfach neugierig und auf jedes neue Abenteuer gefasst, [] Die Sprachen waren wie Kleider, ungewohnt zuerst und unbequem bis man sich nach und nach daran gewöhnte [] Man bewegte sich anders darin und verwandelte sich ihnen an, ja, man wurde beinahe ein anderer Mensch. [] wieder einmal von vorne anzufangen, konnte Robert nicht schrecken. (ENZENSBERGER 1998, S. 245). An Europas berühmtestem Handelsplatz Amsterdam findet Robert wieder ein familiäres Zuhause beim Künstler David, einem cholerischer aber im Grunde warmherziger Lehrmeister Roberts. Ihn interessiert nur die Kunst. Solange Robert fleissig an der Arbeit ist, hat er seine Anerkennung, ja sogar seine Bewunderung, für dessen fotografischen Gedächtnisses geht. Die Frau des Malers ist die gute Seele des Hauses und übernimmt eine mütterliche Rolle für Robert. Keinen Müssiggang wie zu Hofe, keine herablassende Überheblichkeit gegenüber Spiessbürgerlichkeit, kein Philosophieren, kein Ausspielen seiner (Zeit)-Vorsprünge, keine Selbstinszenierung vor Publikum. Seine grossen Auftritte hat er hinter sich, er beginnt hier als Lehrling, er ist neugierig und willig das Handwerk des Malens zu lernen und macht sich sehr diszipliniert an die Arbeit. Aber „ Die Lehre war mühsam, ein Ende war nicht abzusehen, und obwohl David mit ihm zufrieden schien, machte sich Robert keine Illusionen. Nie würde er die Meisterschaft seines Lehrmeisters erreichen, dazu war er zu flatterhaft und wahrscheinlich zu unbegabt. [] und überhaupt, was hatte er in diesem geschäftigen Amsterdam verloren? (ENZENSBERGER 1998, S. 261). Es begegnet ihm wieder die Geschichte vom verlorenen Sohn. Das Bild seiner Heimkehr erscheint ihm im Traum und er ringt darum, es auch wahrheitsgetreu zu malen. „Eine zehrende Sehnsucht überfiel ihn, nicht nur nach Ratibor und nach seiner Mama, sondern auch nach der Badewanne zu Hause, nach seinem Fernseher, ja sogar nach der U-Bahn und dem Supermarkt, [] vor allem vermisste er aber sein eigenes Bett, das so unerreichbar war wie das Paradies. (ENZENSBERGER 1998, S.251). SLA DEUTSCH Gegenwartsliteratur „ Wo warst Du Robert H.M.Enzensberger Niklaus Gerber B1 9 Er verscherzt es beinahe mit seinem Lehrmeister, als dieser das Foto von Ratibor entdeckt und völlig verwirrt wird. Durch einen Traum kommt ihm die rettende Idee. Er besucht sich selber in seiner Küche: „Das Sonderbarste aber war, dass er sich selber auf dem Hocker an der Theke sitzen sah, in seiner alten blauen Leinenjacke, vor dem Fernseher. Nur dass der zweite Robert kein Schinkenbrot in der Hand hielt, sondern einen riesigen Pinsel, von dem rote Farbe auf den Boden tropfte. (ENZENSBERGER 1998, S. 262). Und so macht er sich an die Arbeit und versucht die Szene in seiner Küche zu malen. Es gelingt ihm erst im zweiten Anlauf, indem er sich um zwei Jahre jünger malt, so wie er zu Beginn der Reise ausgesehen hat. Dieser Situation kann er auch nicht einfach ausweichen, es gibt keine Rückkehr nach Hause ohne dieses genaue Abbild seiner selbst in seinem Zuhause. Um zwei Jahre gealtert kehrt Robert nach Hause zurück. Er ist der Gegenwart um zwei Erlebensjahre voraus und sehr darauf bedacht, diesen (Zeit)Vorsprung nicht zu verraten. „Von nun an ist Robert zwei Jahre älter als alle andern in der Klasse. Man sieht es ihm nicht an. Aber wenn es herauskommt, ist der Teufel los. (ENZENSBERGER, 198, S. 274). Er weiss um seine Genialität und muss sie vertuschen. Er trachtet nicht mehr nach Vojeurismus, Ausspielung, Macht, Kitzel, Überlegenheit, wie auf seinen Reisen, sondern er zeigt sich nach seiner Rückkehr in gewisser Zurückhaltung und Bescheidenheit im Umgang mit seinem erweiterten Horizont. 5. Roberts Reisen als Selbst Erfahrung in der Welt (Schwerpunktthema 1) 5.1. Das Phänomen der Zeitreise Auch ohne Zeitreise könnte diese Geschichte ein unterhaltender und vollwertiger Roman sein, als Reise in der Zeit, von Ort zu Ort mit ähnlichen Erfahrungen. Durch die Zeitreise erhalten der Roman mit den erzählten Geschichten aber eine ganz andere Gestalt und Bedeutung. Und gleich zu Anfang gerät das Element der Zeitreise ins Zentrum. Der Besuch beim Hausarzt und der Untersuch von Roberts Augen lassen eine Auflösung von Normalität erahnen. Das Andersrumlesen der Ausdrücke „normal, „Traum, „Halluzination ,und „Fatamorgana (ENZENSBERGER1998, S. 11) rücken die Erzählung aus der Wirklichkeit. Die in der Einleitung erwähnten Fragen drängen sich auf. Warum die Form der Zeitreise, wie funktioniert sie, was bedeutet sie. Im Kapitel 6.2. Zeitreise – Gleichzeitigkeit der Erfahrung wird näher darauf eingegangen werden. Wie es zu den Reisen kommt, ist im Prolog nur sehr knapp beschrieben. Die Reisen fallen fast unverhofft ins Geschehen. „eigentlich war er nur aus Versehen verreist [] „Es war ein ganz gewöhnlicher Tag, als Robert verschwand, . (ENZENSBERGER 1998, S. 65/7), ohne besonderen Anlass oder Vorkommnisse, „Alles wie immer. (ENZENSBERGER 1998, S. 7). .Und plötzlich geschieht es: „ Robert braucht nur den Kopf zu wenden, dann kitzeln ihn die zitternden Lichtflecken im Gesicht [.] Jetzt braucht er nur noch seine Augen zu reiben, ganz leicht mit den Knöcheln über die geschlossenen Lider. Schon treten aus dem Wimmelmuster Bilder hervor: . (ENZENSBERGER 1998, S. 7, 8). Die Voraussetzung jedoch ist Geistesabwesenheit und ein leerer Kopf, „Dein Kopf muss völlig leer sein ENZENSBERGER 1998, S. 91) und „geistesabwesend sozusagen, ohne nachzudenken „Es geschah ihm ja nicht zum ersten Mal, das er auf diese Weise in der Zeit herumgeschubst wurde. Er wusste zwar nicht, wie das zuging und warum es ausgerechnet ihm passieren musste, aber dass es so war, damit musste er sich abfinden. Er konnte höchstens aufpassen, dass es nicht noch öfters geschah. Erstens war es riskant, zu weinen, und zweitens durfte er nicht die Augen reiben, sonst ging es vielleicht von neuem los. (ENZENSBERGER 1998 S. 99). (ENZENSBERGER 1998, S. 97). „.und das Sonderbarste an seinem Verschwinden war, SLA DEUTSCH Gegenwartsliteratur „ Wo warst Du Robert H.M.Enzensberger Niklaus Gerber B1 10 dass niemand es bemerkt hat, nicht einmal seine Mutter. (ENZENSBERGER 1998, S. 7). Oder fast unbemerkt, als die Mutter nach Ihrem Ausgang heimkehrt, wird sie stutzig: Ich hatte die ganze Zeit über so ein komisches Gefühl [.] Ich weiss nicht warum, aber auf einmal dachte ich: was ist mit Robert? Vielleicht braucht er mich. (ENZENSBERGER 1998, S.275) und sie bemerkt auch die rote Farbe aus dem Amsterdamer Atelier. Aber sie beruhigt sich selber und fragt nicht nach „So was Dummes! und bagatellisiert ihre ungutes Gefühl. Die im Titel des Buches gestellte Frage: „Wo warst Du, Robert?, wird im Anschluss an seine Reisen gar nie gestellt, weil es ihm gelingt die Spuren seines Wegseins zu beseitigen. 5.2. Roberts Flucht aus dem Alltag Die Lebenswelt von Robert ist geprägt von Schulalltag und Elternhaus. Beides vermag ihn wenig zu begeistern. Die Schule ist oft langweilig und wenig ergiebig und zu Hause lebt er mit den Eltern, ist aber häufig allein und auf sich selber gestellt. So ist Robert der Schule überdrüssig. Die Lehrer beklagen sich über Roberts Geistesabwesenheit und seine mangelhafte Begeisterungsfähigkeit. Er ist kein schlechter Schüler, seine gute Auffassungsgabe erlaubt es ihm, zeitweilig abzuschweifen. Da seine Eltern oft abwesend und kaum für ihn da sind, sitzt er viel vor dem Fernseher oder Computer und vertreibt sich so die Zeit, was seine Eltern aber missbilligen. Roberts scheinbare Gleichgültigkeit ist aber mehr als gedankenloses Herumlümmeln. Im Grunde ist Robert neugierig und ungeduldig. Er weiss sich in Anbetracht seiner wenig inspirierenden Umgebung zu helfen und geht auf Entdeckungsreisen. „Jede Flucht aber, wie töricht, wie ohnmächtig sie sein mag, kritisiert das, wovon sie sich abwendet. Drei Erklärungsmodelle für touristische Leitbilder ähneln den Ansätzen Enzensbergers, auch wenn sie zum Teil in Abgrenzung von ihnen entwickelt wurden. Enzensberger stellt die beiden Leitbilder der unberührten Landschaft und der unberührten Geschichte ins Zentrum des touristischen Blicks. Auch der Tourismushistoriker Hasso Spode interpretiert den Tourismus als Zeit-Reise mit Rückfahrschein. Diese Zeitreise führt nicht nur in die unberührte Geschichte, sondern auch zu ursprünglichen Landschaften und Völkern. Mittelalter, Exotik oder Strandspiele überall suchen wir das Andere, Frühere, Verlorene. Für Henning dient das Reisen dazu, »der eingespielten sozialen Ordnung vorübergehend zu entkommen nicht in blinder Flucht, sondern als produktive menschliche Leistung, die neue Erfahrungen ermöglicht.3 Auf den ersten Blick erweckt Robert den Eindruck, als ob er im Überdruss der realen, unbefriedigenden Situation seiner gewachsenen Umwelt entfliehen will. Im Verlauf des Romans erkennt man aber, dass der Akzent nicht die Flucht ist, sondern der Aufbruch ist zu neuen, anderen Realitäten. Er sucht förmlich neue Herausforderungen und Auseinandersetzungen. Er taucht unvoreingenommen in verschiedene Lebenswelten ein. Er verreist räumlich und zeitlich, er gewinnt Abstand zu seinem normalen Alltag. Er ist alleine unterwegs auch hier auf sich selber gestellt, keiner der ihm die Zusammenhänge erklärt und ihn vorgängig ins Bild setzt. In all den Reisen nimmt er aktiv am Leben teil. Er bleibt nicht Zuschauer, sondern gestaltet die Geschichten selber mit, ohne die Konsequenzen vorher abzusehen. 5.3. Roberts Erleben der Reisen Er erlebt die Reisen als real, nicht traumhaft. Den Beweis der Realität der Erfahrungen bringt er mit: den Pinsel, die Farbe und den verlorenen Handschuh der Mutter. Robert ist sich der Sensation seiner Reise bewusst, erst erschrickt er, als er gewahr wird, dass er vor sein Geburtsjahr zurückreist. „Aber der grösste Schock stand ihm noch bevor. [] Es war die Prawda. Er schlug schnell nach und stellte fest, dass es „die Wahrheit bedeutete. [] dann fiel Roberts Blick auf das Datum und da stand es schwarz auf weiss: 12 dekbar 1956. 3 Erscheinungsdatum: 11. 11. 1999 Von Thomas E. Schmidt SLA DEUTSCH Gegenwartsliteratur „ Wo warst Du Robert H.M.Enzensberger Niklaus Gerber B1 11 Unmöglich, dachte Robert. Da war er ja noch gar nicht geboren, [] Er war also nicht nur im hintersten Russland gelandet, sondern auch in ein tiefes Zeitloch gefallen. (ENZENSBERGER 1998, S. 31). Er gibt sich der Situation neugierig hin, ist gespannt, was wohl weiter passieren sollte. „Robert fragte sich, ob er jemals wieder in seinem eigenen Bett schlafen würde. Alles, was er kannte, war weg, abhanden gekommen, verschwunden: sein Freund Ratibor, die Malstunde bei Winzinger, der Kühlschrank in der Küche. Wie seine Mutter wohl auf sein Verschwinden reagierte? Ob sie ihn vermisste? Ob sie zur Polizei gegangen war? Nun war er nicht mehr bloss „geistesabwesend, wie Frau Dr Korn immer sagte, er war abwesend, ganz und gar abgetaucht, mit Leib und Seele. (ENZENSBERGER 1998, S. 29/30). Er hätte sich gerne mit Olga über die „Zeitmaschine (ENZENSBERGER 1998, S. 32) unterhalten, in einer Verwunderung da hineingeraten zu sein, aber doch mit einer gewissen Akzeptanz des Schicksals. „Sein ganzes Leben war ja zu einer Reise ohne Ticket geworden (ENZENSBERGER 1998, S. 33). Aber Robert wundert sich nicht, sondern sucht einen pragmatischen und „coolen Umgang mit den Reisen, die ihn mitnehmen. Er zweifelt nicht an der Realität seiner Erfahrungen. Er fragt sich lediglich, wo er sich zwischen den einzelnen Reisen aufgehalten hätte, der Moment des „shifts entzieht sich seiner bewussten Wahrnehmung. Die Reisen reihen sich für Roberts Erleben wie zufällig und unvorhersehbar aneinander. Im Grunde ist aber jede mit ihrer Vorangegangenen verknüpft. Er tritt auch nicht aus den Reisen hinaus, sondern steigt, indem er sich in ein Bild (noch tiefer) vertieft in die nächste Reise. „Was aber mochte der Maler malen? Robert trat noch näher heran, um das Bild im Bild im Bild zu prüfen. Am Ende war es das Gemälde vor dem er selber stand. (ENZENSBERGER 1998, S. 240). Auf diese Weise sind alle Reisen miteinander verbunden in einem Erlebnisstrang, am Ende als Schleife im Kreis geschlossen bei seiner Rückkehr. 5.4. Roberts Erfahrung des Gegebenen Robert wurde in der Schule erstmals mit Geschichte konfrontiert. Mit der Geschichte aus Büchern, als etwas Distanziertem und Aussenliegendem. Es sind vermittelte und interpretierte und nicht mehr authentische und unmittelbare Geschehnisse. Dieser Distanz ist man sich insbesondere in der schulischen Vermittlung von Geschichte bewusst: „[] die didaktische Relevanz des geschichtsorientierten Abenteuerbuches lässt sich damit begründen, dass Geschichte erfahrbar wird. Romane mit historischem Hintergrund können ein Panoptikum gelebten Lebens sein, was es heutigen LeserInnen ermöglicht, jede Zeitspanne zu überwinden. Vergangenheit muss dabei nicht distanziert und interesselos betrachtet werden, wie das häufig im Geschichtsunterricht der Fall sein wird, sondern kann durchaus im Sinne eines Involvierten miterlebt werden. [] ist das gewagte Leben, das irgendwo doch einen Grund besitzt im Herkommen; der Ausbruch aus dem Gewohnten, der produktive Sprung in die Unsicherheit als Freiheit und dann die Rückkehr aus den Fährnissen der Reise ins Offene, in die Geborgenheit einer neuen Heimat. 4 Robert schafft diese Unmöglichkeit durch die Zeitreise und steckt plötzlich mittendrin. „Er hatte in der Schule von der Sowjetunion gehört, [] Und nun steckte er auf einmal mittendrin und kannte niemanden, mit dem er darüber reden konnte. „Er wusste, dass die Vergangenheit das fremdeste aller Länder war. (ENZENSBERGER 1998, S. 145) Robert schafft durch seine Reisen den Ausbruch, oder besser den Einbruch in ihre Gründe und besucht seine Geschichte am Ort ihres Geschehens. Er liefert er sich der Situation völlig aus und lässt es mit sich geschehen, kostet sie förmlich aus und findet einen eigenen kreativen Umgang mit ihnen, macht Erlebnisse und gewinnt an Fertigkeiten hinzu. Am Ende kehrt er verändert von den Reisen zurück. Es gelingt ihm aus der Geschichte zu lernen, weil er die Geschichte nicht nur lernt als Wissen, sondern sie in Erfahrung bringt. „Wohl oder übel musste er sich in der Vergangenheit zurechtfinden, die nun zu seiner Gegenwart geworden war (ENZENSBERGER 1998, S.122). Er hat sich in den Kontext der Geschichte gestellt und sie zu einem Teil seiner 4 Lange Gümter, „Taschenbuch der Kinder- und Jugendliteratur, 2000, Schneider Verlag, Hohengehren GmbH, 436 SLA DEUTSCH Gegenwartsliteratur „ Wo warst Du Robert H.M.Enzensberger Niklaus Gerber B1 12 selbst gemacht. Auf diese Weise gelangt er zu einem unmittelbaren und intuitiven Verständnis der Geschichte. Enzensberger spricht an anderer Stelle davon, dass die Menschen nicht allzu viel aus der Geschichte lernen. „Das bleibt dann so zwei bis drei Generationen in den Köpfen der Leute, ist dann aber vergessen5 was zum Ausdruck bringt, wie schnell uns die geschichtlichen Gegebenheiten entschwinden. 5.5. Roberts Erfahrung seiner Persönlichkeit „Wer bin ich eigentlich, fragt sich Robert. [] in all diesen Stationen der Reise, war das ein und dieselbe Person? Einmal dies, einmal das; es war, als würde er hin und her geworfen wie ein Korken auf dem Meer, bis er nicht mehr ein noch aus wusste (ENZENSBERGER 1998, S. 230) Roberts Persönlichkeit ist in allen Reisen dieselbe. Er wird uns aber in verschiedenen, sich entwickelnden Rollen vorgestellt (siehe Kapitel 4.5. Roberts verschiedene Rollen) wie er die aufeinander folgenden Lebensphasen als Entwicklungsschritte erfährt, quasi als Lehr- und Wanderjahre. Als vierzehnjähriger Robert lebt er eher zurückgezogen und zurückhaltend. Doch ist eine zunehmende persönliche Reife und Eigenständigkeit festzustellen. Vom pflegebedürftigen Findelkind erwächst ein unabhängiger, selbstbewusster aktiver Mann bis hin zu einem reflexionsfähigen Künstler und Philosophen. Robert ist eigentlich selbstbewusst und eigensinnig. In seiner Hingabe in die Reisen öffnet er sich der gegebenen Situation. Er lässt sich ein, er gibt sich hin und lässt sich in das Geschehen einflechten. Und doch kann man aber eine gewisse Schwierigkeit im Umgang mit Realität erkennen. Weder auf seinen Reisen noch in der angestammten Welt sind seine Persönlichkeit und die jeweilige Umwelt völlig kompatibel. Auf den Reisen kommt ihm, bei allem guten Willen, sich in die Situation einzufügen, seine Herkunft aus der jüngeren Zeit in die Quere. Am Ende jeder Reise scheitert er. Es ist ihm nicht mehr wohl. Die Umwelt spuckt ihn förmlich aus. Darauf folgt immer wieder die Neuorientierung im Ausgeliefert sein, „schon wieder die alten Fragen durch den Kopf: Wo bin ich? Und vor allem: wann bin ich? (ENZENSBERGER 1998 S. 172) Seine letzte Reise unterscheidet sich von allen anderen. Die Rückkehr in die Jetztzeit muss er erkämpfen. Im Jahre 1621 existiert kein Bild von Roberts Lebenswelt, er muss es selber kreieren. Keine andere Reise hat ihn soviel Anstrengung gekostet. Erst muss er das Handwerk des Malens erlernen und was ihm besondere Mühe bereitet, ist die Darstellung wirklichkeitsgetreue seiner selbst. 5.6. Roberts Erfahrung seiner Selbstwirksamkeit Warum macht sich Robert auf zu seinen Abenteuern? Durch eine gewisse Diskrepanz seiner Persönlichkeit und der Umwelt, das Aufeinandertreffen von Neugierde, Interesse und Erfahrungslust auf seine für ihn langweiligen, unattraktive, ausgeräumte Umwelt entsteht ein unbändiges Bedürfnis, das Leben in Erfahrung zu bringen. Er sucht sich neue Schauplätze. Ein „elan vitale treibt oder zieht ihn vorwärts und lässt ihn Möglichkeiten suchen, auszubrechen, zu realisieren und in gelebtes Leben umzusetzen. Er sieht das Bild und erweckt es zum Leben, er belebt eine schlummernde Welt. Es gelingt ihm ganz neue Kreise der Erfahrung hinzuzufügen. Durch die Verknüpfung verschiedener Realitäten und die Betrachtung aus verschiedenen Perspektiven ist es ihm möglich seine Wirklichkeit, seinen Horizont zu erweitern. In der Auseinandersetzung mit den äusserlichen Gegebenheiten verwebt er Inneres und Äusseres zu Neuem. Er balanciert zwischen Selbstbehauptung und Offenheit und erlebt sich in verschiedenen Rollen. Dabei erlebt er verschiedene Aspekte seiner Persönlichkeit. Er erfährt sich selbst als bedeutend in der Anerkennung durch seine Gefährten und als wirksam in der Möglichkeit der Einflussnahme in der Umwelt. 5 Julian Reiss, Hermann Angerer SLA DEUTSCH Gegenwartsliteratur „ Wo warst Du Robert H.M.Enzensberger Niklaus Gerber B1 13 Nach seiner Rückkehr ist seine einzige Sorge, wie er wohl seine Erfahrung unentdeckt halten könnte. Er trägt aber sein Geheimnis in reifer Zurückhaltung. Er hat sich verändert, seine Persönlichkeit hat er entfaltet und die Welt hat ihn erfahren, er hat seine Bedeutung in der Welt erlangt und er ist gespannt, wie seine neue Rolle und die zukünftigen Aufgaben aussehen werden. „Daher kommt so viel darauf an, wofür der Einzelne leben und wirken will. Er muss wissen, wo er steht. Sein eigenes Wesen und der Gang der Dinge hängt davon ab, dass er es belangreich findet, was er, auch in seinen winzigsten Entscheidungen, tut. [] Die Welt geht nicht von selbst ihren einen durch Gesetze nach Analogie von Naturgesetzen bestimmten, unveränderlichen Gang, ist nicht ein irgendeinem Denken zugänglicher, vorherbestimmter oder durch uns fremde Entscheidungen gelenkter Schicksalsprozess, sondern was wird, hängt ab von jedem einzelnen Menschen in einer für ihn im Ganzen unberechenbaren Weise.6 „Was wird Robert jetzt machen, wo er wieder zu Hause ist? wird H.M. Enzensberger gefragt anlässlich eines Interview von Angelika Overath. „Das weiss ich auch nicht. Sicher ist er jetzt trickreicher geworden, gewappneter. Er ist stärker, hat an Selbstvertrauen gewonnen. Es könnte sein, dass es ihm jetzt besser geht. Vielleicht sieht er manches gerechter, nicht wie viele Kinder in ihrer Langeweile und ihrer Verwöhntheit. Er sehnt sich ja in der Vergangenheit nicht nur nach seiner Mama, er sehnt sich auch nach seinem Telefon. Es könnte sein, dass er ein besserer Beobachter geworden ist. Insofern ist es ein optimistisches Buch. Es wird ja nicht behauptet, dass es einen Fortschritt gibt, aber der Jammer relativiert sich, die Wehleidigkeit relativiert sich. Natürlich kann man das Buch fortschrittsgläubig nennen oder konservativ. Aber das ist mir egal.7 6. Wo warst Du nun wirklich, Robert? (Schwerpunktthema 2) 6.1. Zeitreise – Verrückung von Standpunkt und Blickpunkt Des Menschen erste Priorität, ist das Überleben, also die Sicherung der Existenz. Es haftet seinem natürlichen, biologischen Dasein an. Von dieser Sicht, seiner „ersten Logik aus hat der Mensch eine bestimmte Art zu denken, nämlich die Welt zu vereinfachen, Komplexität zu reduzieren und einfache Zusammenhänge zu definieren um handlungsfähig zu bleiben. Es ist auch die grosse Fähigkeit unseres Gehirns die Welt auf das Lebenswichtige zu konzentrieren und für das Existentielle weniger relevante auszublenden. „Denn die Horizontbeschränkung ist gleichzeitig auch Komplexreduktion, die die Aktion erleichtert; wüssten wir immerzu „alles, so vermöchten wir vor lauter Ambivalenz vielleicht gar nicht mehr zu handeln, also zu überleben. [] also keine beklagenswerte Unzulänglichkeit, sondern eine weise Konzentration auf das Wesentliche dar, die dem Überleben dient. (Ciompi, 1999, S. 42). Was aber den Menschen im Besonderen kennzeichnet, ist ein Bedürfnis, das dem oben erwähnten entgegensteht. Er will nicht nur überleben, sondern sein Dasein auch begreifen. Er sucht nach seinem Woher, Wohin und Warum. „Leer und daher gierig, strebend und daher unruhig geht es in unserem unmittelbaren Sein her. Aber all dies empfindet sich nicht, es muss dazu erst aus sich herausgehen. Dann spürt es sich als „Drang, als ganz vagen und unbestimmten. [] Dieser Durst meldet sich stets und nennt sich nicht.8 6 Jaspers Karl, „Werk und Wirken, piper Verlag, 1963 „Wo warst du Magnus von Angelika Overath, NZZ 22.8.1198 8 Bloch ernst, „Das Prinzip Hoffnung, Surkamp Verlag, 1959, S. 49 7 SLA DEUTSCH Gegenwartsliteratur „ Wo warst Du Robert H.M.Enzensberger Niklaus Gerber B1 14 Der Mensch reflektiert und hinterfragt, um zu einem Verständnis seines Lebens zu gelangen. Er muss über sich hinaus denken und sich relativieren können. Robert tritt aus seiner Realität hinaus und wechselt die Perspektiven, Indem er sich selber zum Objekt der Geschichte macht, gelingt es ihm, den nötigen Abstand zu seiner eigenen Geschichte zu gewinnen, um sie objektiver einordnen zu können. „Selbsterkenntnis heisst eben nicht, sich allem uneigenen zu entledigen, um den wahren Kern an den Tag zu bringen, sondern sich im umweltlichen Kontext zu spiegeln. Es geht auch um die Erkenntnis, sich als Machwerk des Vorangegangenen und Gegebenen zu erkennen. Er begibt sich ausserhalb seiner Vertrautheit und ermöglicht sich sieben verschiedene Perspektiven auf seine Lebenswelt. Martin Meyer sagt von Enzensberger selber: „er ist ein bedeutender Reisender. Daraus folgt Bildung aus der Begegnung mit Kulturen, welche ihre Lebenswelten je verschieden gewichten [] freilich auf diskrete Weise – pflegt Enzensberger seinerseits die Kultur der Selbstbeobachtung. Daraus resultiert die Einsicht in die Ambivalenzen unseres Tuns und Verhältnis zwischen (moralischer) Theorie und (eigennütziger) Praxis.9 Das Heraustreten Roberts aus seiner real existierenden Welt in andere, wiederum verschiede Welten, ermöglichen ihm einen „shift aus seiner gewohnten Welt. Er enthebt sich seiner Realität und wird sich der Relativität seiner Wirklichkeit bewusst. Im Gegensatz zum höfischen Treiben auf Schloss in Westfahlen, wo es fast unerträglich ist, zu realisieren, dass sich nur der Mond, und möglicherweise noch ohne Beobachter um die Erde dreht „ich freue mich, dass uns wenigstens der Mond begleitet, da die Planeten sich nicht um uns kümmern. (ENZENSBERGER 1998 S. 180), dreht sich Robert nicht egozentrisch um sich selbst. Er begibt sich in eine andere „Haut, was ihm eine nicht isolierte Betrachtung, eine Verbindung der verschiedenen Realitäten ermöglicht. Und er tut dies, indem er verschiedene Teilabschnitte von „beschränkten Horizonten aneinander fügt, aber im Bewusstsein, dass es nur eine Erweiterung ist, ohne Anspruch auf etwas wie absolute Wahrheit. „Denn letztlich ist die Subjektivität das einzige, was wir wirklich besitzen. Die Objektivität ist eine Chimäre, eine Fiktion, denn Objektivität im strengen Sinne ist nichts als ein mit bestimmter Methodologie erzielter Konsens von Subjektivitäten – also selbst ein subjektives Konstrukt,.(Ciompi, 199, S.333), „Die Gewahrwerdung von Diversität, Multiplizität, Gegensätzlichkeit der Weltbilder ist eine potenzielle Bereicherung, [] Mit Piaget könnte man zudem von einem zusätzlichen Schritt der Dezentration – also des stufenweise Absehens von einer kindlich-egozentrischen Weltsicht sprechen,. Die einerseits eine Bewusstseinserweiterung und grössere Flexibilität .mit sich bringt. (Ciompi, 1999, S. 338) „Gewiss ist unser Horizont immer in vielfacherweise eingeengt. Aber „beschränkter Horizont „ ist nicht gleichbedeutend mit „kein Horizont. Was wir gewahren, ist in irgendeiner Weise signifikant; wir wissen bloss nicht genau, für was. So dürfen wir getrost hoffen, dass auch in unsrem Beitrag „ein Körnchen Wahrheit enthalten sein mag (Ciompi, 1999, S. 44). Mit „ein Körnchen Wahrheit meint Ciompi, dass nicht die subjektive Erfahrung an sich relativ und gewissermassen nicht „ernst zu nehmen sei, sondern unsere Sicht und Interpretation derselben. Denn mit jeder Erfahrung geschieht ein Stück Wahrheit. „Die Natur ist eine Einheit, und wir suchen unter den Ideen, die wir bereits besitzen, diejenigen, in die wir sie einordnen können. – Die Natur ist, was sie ist, und da unsere Intelligenz, die einen Teil der Natur ausmacht, weniger umfassend als sie ist, ist es zweifelhaft, dass irgend eine unsrer aktuellen Ideen weit genug ist, um sie zu erfassen. Arbeiten wir also daran, unsere Gedanken zu erweitern, tun wir unserem Verstande Gewalt an, zerbrechen wir, wenn es nötig ist, unsere Denkformen, aber versuchen wir nicht, die Wirklichkeit in das Proskrustesbett unserer Ideen einzuzwängen, da es doch Aufgabe unserer Ideen ist, sich nach Massgabe der Wirklichkeit umzuformen und zu erweitern (Claude Brenard) (Bergson, 197, S. 233). Und gerade deshalb ist uns die Fähigkeit des Denkens gegeben, so Bergson, weil wir nie im Besitze einer Gesamtschau sein werden, sondern damit wir die Lücken in unserer Wahrnehmung ausfüllen können. Man hat den Eindruck, dass Robert sicher auf beiden Füssen steht so wie er von seinen Reisen zurückkehrt. Er hat die „Welt gesehen. 9 Meyer Martin, „Nähe und Nachsicht, NZZ, 5. 6.2003 SLA DEUTSCH Gegenwartsliteratur „ Wo warst Du Robert H.M.Enzensberger Niklaus Gerber B1 15 6.2. Zeitreise als Gleichzeitigkeit der Erfahrung Von aussen betrachtet spielt sich Roberts Traumreise ausschliesslich in seinem Kopf ab. Aus seiner Sicht sind es aber nicht nur Bilder der Erfahrungen, aus denen die Erlebnisse generiert werden. Das bisherige Erfahrungsmaterial reicht nicht, um die Geschichten auszufüllen. Er hat zwar die sonderbare Gabe des fotographischen Gedächtnisses und ist fähig, förmlich in die Bilder, die sich ihm präsentieren, hineinzufallen, aber er gewinnt hinzu auf seinen Reisen, an Wissen an Fähigkeiten und Fertigkeiten. Es bleibt aber ungewiss, in welchen Räumen und in welcher Realität sich die Reisen abspielen. „Da stand er nun, mitten im (sibirischen) Winter, auf einer breiten, schnurgeraden, verschneiten Strasse, die er nie zuvor gesehen hatte. Oder doch? Die Frauen mit den Kopftüchern, [] – das kannte er doch (ENZENSBERGER 1998, S. 17). Wo war Robert nun? In dieser Unsicherheit liegt der Zauber dieses Romans. Robert hat ohne Zweifel hinzugewonnen, und dies in einem zeitlosen Raum. Es war plötzlich alles da, die vergangenen Zeiten und die dazugehörenden Räume oder besser, es war ihm plötzlich bewusst. „Nach Leibnitz ist im Ausgedehnten keine Vergangenheit und keine Zukunft. Es gibt da nur Gegenwart. Hingegen die Monade: sie konzentriert in ihrer Gegenwart alle vergangenen und zukünftigen Zustände. [] Als Widerspiegelung des ganzen Universums fasst sie gewissermassen alle vergangenen und alle potentiellen Zustände des Universums in ihrer Innerlichkeit zusammen. [] Die Monade ist der fortwährende lebendige Spiegel des Universums. (Hersch, 1997, S. 130) In dieser Art beschreibt Leibnitz die Allgegenwart des Existierenden. Wir sind uns ihrer nur nicht oder zuwenig bewusst. Er entwickelt aber auch ein Model für einen beschränkten Zugang. „die kleinen Wahrnehmungensie sichern die Kontinuität, die Identität jedes Individuums durch die Zeit. Leibnitz beschreibt, dass sich die Monaden unterschieden in ihrem einzigartigen und unterschiedenen Blickpunkt auf das Universum und immer nur einen individuellen Aspekt klar ausleuchteten. „Da sie aber alle das eine Universum spiegeln, können sie als Monaden in ihrem Inneren miteinander kommunizieren Hersch, 1997, S.132). Roberts Welt wurde grösser und heller durch diese „kleinen Wahrnehmungen, aber wie? Bereits im ersten Satz des Romans, vermittelt es den Eindruck, dass alles Kommende in diesem Buch für die Aussenwelt gar nie wirklich passiert ist. Es heisst, dass Robert verschwand, das heisst, dass die ganze Geschichte nicht lediglich in seinem Kopf, als Traum geschehen ist, sondern dass mit ihm tatsächlich etwas geschehen ist. Diese Unmöglichkeit erhebt die Geschichte in etwas Sonderbares, Geheimnisvolles. Es ist Roberts Aufmerksamkeit, die ihm diese Bilder gewahr werden lässt, seine besondere Fähigkeit des konzentrierten Fokus und seiner Empathie, die ihm die Räume für seine Erfahrung öffnet. Es wird als eine „konzentrierte Geistesabwesenheit beschrieben, als Intuition oder „ein unmittelbares nicht durch Reflexion herbeigeführtes Erkennen. Wenn er bemerkt, dass es wieder soweit ist, fragt er nicht nach Pässlichkeit, sondern springt aus seiner Realität und lässt sich mitnehmen. Er taucht in das Geschen der Bilder und lebt mit, er versetzt sich in die Bilder und macht sich zu einem Teil des Geschehens. Auf diese Weise gelangt er zu einem einmaligen Erleben und Verständnis des jeweiligen geschichtlichen Schauplatzes „Wir bezeichnen hier als Intuition die Sympathie, durch die man sich und das Innere eines Gegenstandes versetzt, um mit dem, was er Einzigartiges und infolgedessen Unaussprechliches an sich hat, zu koinzidieren. Dagegen ist die Analyse die Operation, die den Gegenstand auf schon bekannte Elemente zurückführt, d.h. auf Elemente, die dieser Gegenstand mit anderen gemeinsam hat. Analysieren besteht also darin, eine Sache als Funktion von dem, was nicht sie selbst ist, auszudrücken. [] in ihrem ewig unbefriedigten Bestreben, den Gegenstand zu umfassen, um den sie verdammt ist zu kreisen, häuft die Analyse endlos die Gesichtspunkte. Um die immer unvollständig bleibende Vorstellung auszufüllen, variiert unaufhörlich die Symbole, um die immer unvollkommene Übersetzung zu vervollkommnen. Anders die Intuition, wenn sie möglich ist, ist ein einfacher unteilbarer Akt. (Bergson, 2000, S. 14). Diese pure und unmittelbare Gewahrwerden von Dingen und ihrer wirklichen Intention wird der Formulierung des „hermeneutischen Zirkel Heideggers beschrieben: „ Im hermeneutischen Zirkel verbirgt sich eine positive Möglichkeit ursprünglichen Erkennens, die freilich in echter Weise nur dann ergriffen ist, wenn die Auslegung verstanden hat, dass ihre erste, ständige und letzte Aufgabe bleibt, sich jeweils Vorhabe, Vorsicht und Vorgriff nicht durch Einfälle und SLA DEUTSCH Gegenwartsliteratur „ Wo warst Du Robert H.M.Enzensberger Niklaus Gerber B1 16 Volksbegriffe vorgeben zu lassen, sondern in deren Ausarbeitung aus den Sachen selbst her das wissenschaftliche Thema zu sichern.10 Der unteilbare Augenblick Roberts erscheint mir als eine unmittelbare Schau. Als ein konzentrierter Fokus und einer Empathie seiner Erfahrungswelt. Dies setzt aber eine hohe Sensibilität und Reflexionsfähigkeit voraus. „Im Gegensatz zu den Bäumen haben es Montaigne und Diderot vermieden, einen festen Standpunkt einzunehmen11 meint Enzensberger und will damit sagen, dass wir sensibler auf unsere Vor-bewusste-Wahrnehmung einerseits und unser Vor-bewusstes-Urteil andererseits bewusster vermeiden oder entlarven sollten. 7. Schlussgedanken Das Lesen und Wiederlesen des Romans führte mich zu Räumen und Ahnungen, die zwar immer dichter wurden, sich aber auch immer wieder änderten. Es bleibt ein Chanchieren, sowohl im Lesen, als auch im Verstehen. Es lebt vom Wechsel, von einer Zeit zur anderen, von einer Realität in die andere. Es wird nicht zwischen Traum oder Wirklichkeit entschieden, nicht zwischen Sein und Nichtsein, sondern es wird mehr nach dem Werden, nach Erfahrung und Verwirklichung gefragt. Die Frage der Kausalität wird aufgehoben im „das Bild im Bilde im Bild des Malers aus Amsterdam. Es wird faktisch unmöglich zu klären, was Ursache und was Wirkung ist. In verschiedenen Stellen des Romans stellt sich diese Frage. Geht Robert auf Reisen oder stossen sie ihm zu, sind es die Bilder die sich öffnen und Robert fällt hinein oder ist es Robert, der die Welt des Bildes zum Leben erweckt, gestaltet Robert die Reisen oder sind sie ihm gegeben, sind es seine Rollen oder spielt er sie nur. Es lässt vermuten, dass es Enzensbergers Absicht ist, diesen Sicht- und Erlebenswechsel als einen alltäglichen „shift zwischen verschiedenen Wirklichkeiten zu zeigen. Es ist mir nicht gelungen, das Buch als verstanden beiseite zu legen. die Spannung bleibt, und ich bin unsicher, ob ich es verstanden habe, zumal Enzensberger immer auch etwas Relevantes anklingen lässt, wenn er schreibt – und ich es nicht abschliessend erfasst zu haben meine. „Die reine Poesie war niemals das letzte Ansinnen dieses Autors, Enzensberger hielt und hält es mit der Reflexion, mit Anspielung und Argument. [] wichtiger als Laut und Klang sind Bezug und Verweis. [] er zeigt seine Kraft im Epigramm oder im Philosophieren darüber, wie wir leben, wenn wir nicht nur träumen, sondern Geschichte gestalten.12 „Man müsste eine paradoxe poetische Unschärferelation formulieren: Manches verstehen wir nur so lange, wie wir es nicht vollends verstehen. Ich halte gegenüber Büchern sowohl wie Menschen ein lückenloses Verstehen für ein wenig uninteressant als erspriesslich (Robert Walser). Es soll uns nie ganz behaglich werden mit der Literatur: soll sie ihren Zauber bewahren, müssen wir auch mit dem Stachel leben, dass ein Rest an Unaussprechlichem zurückbleibt, dass uns immer ein wenig der Boden unter den Füssen wankt, wenn wir uns unter Bücher wie unter Menschen begeben.13 Am Lebensabend, nach einem reichen engagierten Schreiben, schlägt Enzensberger ein neues Kapitel auf: er schreibt ein Kinderbuch. In einem Interview14 zum Erscheinen dieses Buches Autobiographien seien prekäre Genre, aber es sei nicht auszuschliessen, dass autobiographisches eingeflossen sei. Es fragt sich, ob Enzensberger diese Reisen retrospektiv 10 „Wahrheit und Methode H.G.Gadamer, 1190, S. 270 Meyer Martin, „Nähe und Nachsicht, NZZ, 5. 6.2003 12 Meyer Martin, „Nähe und Nachsicht, NZZ, 5. 6.2003 13 Bucheli Roman, „Bücher und Menschen, NZZ, 31.5.2003 14 Overath, Angelika, NZZ, 22.8.1998 11 SLA DEUTSCH Gegenwartsliteratur „ Wo warst Du Robert H.M.Enzensberger Niklaus Gerber B1 17 als seine Stationen im zurückliegenden Leben aufzeichnet und nun in aller Offenheit und gespannter Erwartung von all seinen Reisen zurückkehrt in die Geborgenheit einer persönlichen Heimat. H.M. Enzensberger betrachtete zeitlebens das Zeitgeschehen aus einem gewissen Abstand und stand doch selber mittendrin. Nicht distanziert, aber immer in einer gewissen Distanz und mit einer engagierten Kritik allem Herrschenden und Etablierten, letztendlich auch sich selber gegenüber. 8. Anhang SLA DEUTSCH Gegenwartsliteratur „ Wo warst Du Robert H.M.Enzensberger Niklaus Gerber B1 Der Augenschein 15 Du sagst: Ich mache die Augen auf und sehe was da ist Zum Beispiel dort an der Wand diese nackte Frau da Oder hier diesen öden Bleistift Oder das Auge das mich unaufhörlich anstarrt zum Verrücktwerden Ich mache die Augen zu und sehe was nicht da ist So einfach ist das So leicht bist du zu täuschen Denn in Wirklichkeit steht die Wirklichkeit Kopf Auch dein Kopf auch das Kino in deinem Kopf Woher weißt du ob sich das Auge bewegt und das Bild steht still Oder das Auge steht still und das Bild bewegt sich? Sicher ist nur dass das Verschwundene nicht verschwunden