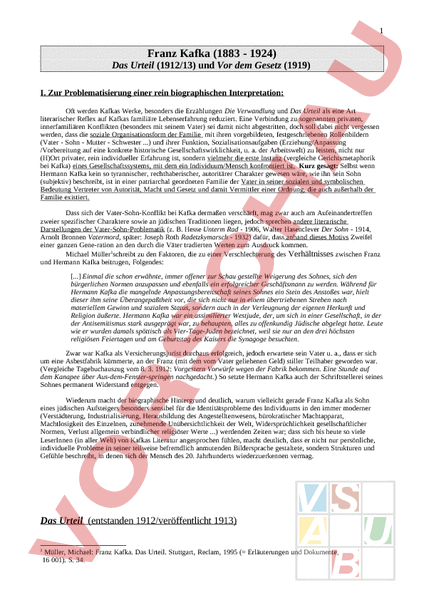Arbeitsblatt: Kafka "Das Urteil"
Material-Details
Merkblatt zu der Erzählung
Deutsch
Leseförderung / Literatur
12. Schuljahr
3 Seiten
Statistik
59352
1098
6
22.04.2010
Autor/in
Martina Frick
Land: Österreich
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
1 Franz Kafka (1883 1924) Das Urteil (1912/13) und Vor dem Gesetz (1919) I. Zur Problematisierung einer rein biographischen Interpretation: Oft werden Kafkas Werke, besonders die Erzählungen Die Verwandlung und Das Urteil als eine Art literarischer Reflex auf Kafkas familiäre Lebenserfahrung reduziert. Eine Verbindung zu sogenannten privaten, innerfamiliären Konflikten (besonders mit seinem Vater) sei damit nicht abgestritten, doch soll dabei nicht vergessen werden, dass die soziale Organisationsform der Familie mit ihren vorgebildeten, festgeschriebenen Rollenbildern (Vater Sohn Mutter Schwester .) und ihrer Funktion, Sozialisationsaufgaben (Erziehung/Anpassung /Vorbereitung auf eine konkrete historische Gesellschaftswirklichkeit, u. a. der Arbeitswelt) zu leisten, nicht nur (H)Ort privater, rein individueller Erfahrung ist, sondern vielmehr die erste Instanz (vergleiche Gerichtsmetaphorik bei Kafka) eines Gesellschaftssystems, mit dem ein Individuum/Mensch konfrontiert ist. Kurz gesagt: Selbst wenn Hermann Kafka kein so tyrannischer, rechthaberischer, autoritärer Charakter gewesen wäre, wie ihn sein Sohn (subjektiv) beschreibt, ist in einer patriarchal geordneten Familie der Vater in seiner sozialen und symbolischen Bedeutung Vertreter von Autorität, Macht und Gesetz und damit Vermittler einer Ordnung, die auch außerhalb der Familie existiert. Dass sich der Vater-Sohn-Konflikt bei Kafka dermaßen verschärft, mag zwar auch am Aufeinandertreffen zweier spezifischer Charaktere sowie an jüdischen Traditionen liegen, jedoch sprechen andere literarische Darstellungen der Vater-Sohn-Problematik (z. B. Hesse Unterm Rad 1906, Walter Hasenclever Der Sohn 1914, Arnolt Bronnen Vatermord, später: Joseph Roth Radetzkymarsch 1932) dafür, dass anhand dieses Motivs Zweifel einer ganzen Gene-ration an den durch die Väter tradierten Werten zum Ausdruck kommen. Michael Müller1schreibt zu den Faktoren, die zu einer Verschlechterung des Verhältnisses zwischen Franz und Hermann Kafka beitrugen, Folgendes: [.] Einmal die schon erwähnte, immer offener zur Schau gestellte Weigerung des Sohnes, sich den bürgerlichen Normen anzupassen und ebenfalls ein erfolgreicher Geschäftsmann zu werden. Während für Hermann Kafka die mangelnde Anpassungsbereitschaft seines Sohnes ein Stein des Anstoßes war, hielt dieser ihm seine Überangepaßtheit vor, die sich nicht nur in einem übertriebenen Streben nach materiellem Gewinn und sozialem Status, sondern auch in der Verleugnung der eigenen Herkunft und Religion äußerte. Hermann Kafka war ein assimilierter Westjude, der, um sich in einer Gesellschaft, in der der Antisemitismus stark ausgeprägt war, zu behaupten, alles zu offenkundig Jüdische abgelegt hatte. Leute wie er wurden damals spöttisch als Vier-Tage-Juden bezeichnet, weil sie nur an den drei höchsten religiösen Feiertagen und am Geburtstag des Kaisers die Synagoge besuchten. Zwar war Kafka als Versicherungsjurist durchaus erfolgreich, jedoch erwartete sein Vater u. a., dass er sich um eine Asbestfabrik kümmerte, an der Franz (mit dem vom Vater geliehenen Geld) stiller Teilhaber geworden war. (Vergleiche Tagebuchauszug vom 8. 3. 1912: Vorgestern Vorwürfe wegen der Fabrik bekommen. Eine Stunde auf dem Kanapee über Aus-dem-Fenster-springen nachgedacht.) So setzte Hermann Kafka auch der Schriftstellerei seines Sohnes permanent Widerstand entgegen. Wiederum macht der biographische Hintergrund deutlich, warum vielleicht gerade Franz Kafka als Sohn eines jüdischen Aufsteigers besonders sensibel für die Identitätsprobleme des Individuums in den immer moderner (Verstädterung, Industrialisierung, Herausbildung des Angestelltenwesens, bürokratischer Machtapparat, Machtlosigkeit des Einzelnen, zunehmende Unübersichtlichkeit der Welt, Widersprüchlichkeit gesellschaftlicher Normen, Verlust allgemein verbindlicher religiöser Werte .) werdenden Zeiten war; dass sich bis heute so viele LeserInnen (in aller Welt) von Kafkas Literatur angesprochen fühlen, macht deutlich, dass er nicht nur persönliche, individuelle Probleme in seiner teilweise befremdlich anmutenden Bildersprache gestaltete, sondern Strukturen und Gefühle beschreibt, in denen sich der Mensch des 20. Jahrhunderts wiederzuerkennen vermag. Das Urteil (entstanden 1912/veröffentlicht 1913) Müller, Michael: Franz Kafka. Das Urteil. Stuttgart, Reclam, 1995 ( Erläuterungen und Dokumente, 16 001). S. 34. 1 2 Inhalt: Der junge Kaufmann Georg Bendemann hat soeben einen Brief an seinen Jugendfreund, der im fernen Russland lebt, geschrieben. Wie er so zum Fenster hinausschaut auf den Fluss, überdenkt er den Inhalt des Briefes und seine Beziehung zu diesem Freund, dem er zum ersten Mal eine „eigentliche Mitteilung macht, nämlich die seiner Verlobung mit Frieda Brandenfeld, die aus einer gut situierten Familie stammt. Mit dem Brief in der Tasche sucht er das lange nicht betretene Zimmer seines Vaters auf, der ihm „noch immer ein Riese ist. Er teilt ihm mit, dass er sich entgegen seiner ursprünglichen Absicht entschlossen hat, dem Freund in Petersburg seine Verlobung anzuzeigen. Der Vater verwirrt Georg mit der Frage, ob er diesen Freund auch wirklich habe. Als sich Georg jedoch vor Augen hält, dass sein Vater seit dem Tod der Mutter in einem dunklen Hinterzimmer lebt, wirkt dieser ungepflegt und schwächlich und macht einen ebenso greisenhaften wie kindischen Eindruck. Georg trägt ihn ins Bett; doch plötzlich erhebt sich der Vater, verwandelt sich in eine machtvolle und drohende Gestalt, bezichtigt den Sohn der Lüge und Heuchelei und verurteilt ihn zum Tode durch Ertrinken. Georg kann sich diesem Urteilsspruch offenbar nicht entziehen. Er fühlt sich aus dem Zimmer gejagt, hört noch den Aufprall des niederstürzenden Vaters, eilt aus dem Haus, der Brücke zu, übersteigt das Geländer und ruft „Liebe Eltern, ich habe euch doch immer geliebt, bevor er sich ins Wasser fallen lässt. Interpretation: Die Erzählung lässt sich bei genauerer Betrachtung nicht realistisch deuten. Die Geschichte eines zuerst schwachen, dann plötzlich übermächtigen Vaters, der seinen gesellschaftlich erfolgreichen Sohn zum Tode durch Ertrinken verurteilt, ist nicht realistische Nachahmung einer so vorhandenen außerliterarischen Wirklichkeit. Vielmehr sind die fiktiven Personen als Symbole innerer Tendenzen der Zentralfigur zu verstehen. Diese Erzählung stellt innere Welt dar, ohne dass sie als Vision, Erinnerung, Wahnsinn oder Traum kenntlich gemacht würde. Alles, was sich ereignet, wird in der Erzählung so dargestellt, als wäre es mit den Augen Georgs gesehen, der die Ereignisse wertet und beurteilt. Es gibt keinen auktorialen oder auch nur neutralen Erzähler, der für das Lesepublikum Wahrheit verbürgt (So ist z. B. die Frage, ob es den Freund nun gibt oder nicht, nicht entscheidbar.) Ein Grundmotiv der Erzählung ist der Machtkampf zwischen Vater und Sohn, der sich auf mehreren Handlungsebenen zeigt. Anlass für den Besuch im Zimmer des Vaters sind zwei miteinander verquickte Ereignisse: die Verlobung Georgs und deren Mitteilung an den fernen Freund. Letzterer besitzt bezeichnenderweise keinen Namen, was ihn mehr zu einem Streitobjekt zwischen Vater und Sohn als zu einer Person werden lässt. Nicht umsonst versucht der Vater zuerst die Existenz des Freundes überhaupt anzuzweifeln, als dies nicht gelingt (Sohn beschwört Erinnerung des Vaters an den Freund herauf), wendet er eine andere Strategie an: er behauptet, sich nicht nur an den Freund zu erinnern, sondern ihn besser zu kennen als der Sohn und mit ihm sogar in Briefkontakt zu stehen. Zusätzlich wirft er ihm Verrat am Freund, am Vater und an der Mutter vor, weil er sich zur Heirat entschlossen hat (Vater verächtlich: Weil sie die Röcke gehoben hat). Georg vergisst im Laufe der Auseinandersetzung seine Entschlüsse und Strategien zur Verteidigung (genaues Beobachten, Lachen), er gerät immer mehr in den Bann des Vaters, dem es gelingt, ihm die Schuld an allem zuzuschieben und ihn zu verurteilen. Das jeweilige Kräfteverhältnis der beiden Kontrahenten drückt sich in ihrer räumlichen Position und den relativen Größenverhältnissen aus (Sitzen, im Bett liegen, zudecken, im Bett stehen, Niedernknien des Sohnes vor dem sitzenden Vater, Sohn trägt Vater, Sohn im Winkel des Raumes, vorgeschlagener Zimmertausch, Vater als Riese, .), was ein konsequentes Umsetzen der inneren Handlung in äußerlich sichtbare Bilder (Parallelen zur Filmsprache und zur expressionistischen Lyrik) bedeutet. Wäre es dem Sohn gelungen zu heiraten (wie einst dem Vater) und gleichzeitig seinen fernen Freund, der bezeichnenderweise Junggeselle ist, zu akzeptieren (durch die Mitteilung der Verlobung), so hätte dies seinen geschäftlichen Erfolg im bürgerlichen Leben sozusagen bestätigt, er hätte dem Vater nachfolgen und ihn letztlich ablösen können (vgl. Sohn versucht Vater beizubringen, er solle sich schonen, weniger arbeiten). Dass dies ein Vater seinem Sohn nicht zu gönnen scheint, wird nur verständlich, indem man eine weitere Deutungsmöglichkeit der Geschichte eröffnet. Der am Beginn der Geschichte beschriebene Gegensatz zwischen Georg Bendemann und seinem Freund (an die bürgerliche Wirtschaftswelt erfolgreich angepasst, verlobt, in der Heimat anerkannt und integriert in der Fremde weilend, mit wirtschaftlichen Problemen kämpfend, berührt von den politischen Turbulenzen der Revolution, alleinstehend, heimatlos) könnte Ausdruck eines inneren Konflikts Georg Bendemanns sein. So wie er in der äußeren Handlung zögert, seinem Freund aus Rücksicht auf ihn von der Verlobung zu berichten, bedeutet dies auf der inneren Ebene, dass er selbst an der Richtigkeit seines Tuns zweifelt. Nur die unbewusste Angst vor dem möglichen Verrat (am Freund an sich selbst am Vater/Gewissen), die er selbst spürt, macht ihn so ohnmächtig gegenüber den Vorwürfen des Vaters. Wer/Was wird von Georg aber möglicherweise verraten? Kafka selbst hat den Zwang zum bürgerlichen Erwerbsleben (der sich durch eine Heirat noch verstärkt) immer als Verrat an seiner eigentlichen Bestimmung, der des Schriftstellers und Künstlers empfunden. So symbolisiert der Freund in der Fremde vielleicht die eigene Entfremdung von dieser bürgerlichen Welt, in der ein „Geschichtenerzähler (Charakteristikum des Freundes im Urteil) keinen Platz hat. Dass der Vater dem Sohn am Ende die totale Anpassung an seinen eigenen Lebensstil verweigert und ihn verurteilt (übrigens nachdem ihm der Sohn den Tod gewünscht hat), heißt aber auch, dass einer 3 Lebenswelt, die den Menschen auf einen bürgerlichen Karrieristen reduziert (der sich dadurch zwangsweise von Vater und Freund menschlich entfernt), eine Absage erteilt wird (so könnte der Fall des Vaters am Ende, den der Sohn noch hört, auch als gleichzeitige Selbstverurteilung des Vaters gedeutet werden). So meint Herbert Lehnert „Das Urteil erzählt die Wandlung des Vaters, des Gewissens, von der angepaßten Erfolgswelt zu der unangepaßten des Fremden. Indem der Vater wider Erwarten aufsteht (.), was bei aller Wirkung auch einen spielerisch komödienhaften, ja komischen Aspekt hat, wird Georg der sonnigen Erfolgswelt entzogen. Der Vater nennt ihn ein unschuldiges Kind und zugleich einen teuflischen Menschen. Seine eigentliche Bestimmung ist dies des unangepaßten Geschichtenerzählers, der mit dem Leben spielt und es teuflisch fremd macht. Daraus folgert der Vater das Todesurteil, das Georg mit Eifer annimmt. Die Annahme der unangepaßten Existenz als der, die vom Gewissen (Anm. M. Frick: verkörpert durch den Vater) vorgeschrieben ist, bedeutet den Tod des angepaßten und (nach außen hin, Anm. M. Frick) glücklichen Bendemann, der mit dem Gedanken an seine Liebe zu den Eltern stirbt.2 So wird auch der Sprung Georgs über das Geländer in den Strom (des Lebens?) in einigen Interpretationen (und auch von Kafkas Freund Max Brod) nicht nur negativ gesehen. Vor dem Gesetz (1919 von Kafka als Legende veröffentlicht, später Teil des Romans Der Prozess) In dieser Geschichte findet man teilweise Anklänge an die Thematik des Urteils, jedoch wird durch die Form der Parabel mit ihren Merkmalen wie Typisierung der Figuren (ein Mann vom Lande, ein Türhüter) und starke Vereinfachung des Handlungsablaufs ein größerer Abstraktionsgrad bei gleichzeitig starker bildlicher Ausdruckskraft (das Gesetz!?) erreicht, was eine Vieldeutigkeit des Prosastücks eröffnet, der eine rein biographische Deutung, wie sie in Das Urteil noch in Ansätzen möglich erscheint, nicht gerecht würde. Finden sich im Urteil noch Versatzstücke realistischen Erzählens (Zeitangaben, Beschreibung von konkret vorstellbaren Örtlichkeiten mit ihrer jeweils atmosphärischen Wirkung; Held hat einen Namen bezeichnenderweise Freund und Vater nicht mehr, die Protagonisten haben eine Vergangenheit, eine Geschichte und sind in einen gesellschaftsrelevanten Zusammenhang eingebettet, der sich z. B. in den Berufsbezeichnungen ausdrückt; geographische Angaben Petersburg), verschwinden diese in der Parabel Vor dem Gesetz zugunsten einer symbolund gleichnishaften Darstellungsweise, die die Allgemeingültigkeit der Erfahrung des Mannes vom Lande unterstreicht (beachte auch die Verwendung des Präsens!). Ähnlichkeiten/Parallelen zwischen Vor dem Gesetz und Das Urteil Beide Geschichten versetzen den Leser bereits durch den Titel in die Welt der Gerichtsbarkeit: Die Rolle des Richters, des Hüters des Gesetzes nimmt der Vater bzw. der Türhüter ein; der Sohn bzw. der Mann vom Lande tritt in Form eines Bittstellers auf, der die Erlaubnis für eine Handlung (Mitteilung der Verlobung/Einlass ins Gesetz) erwirken möchte. In beiden Fällen entsteht eine Art Verhörsituation. Es kommt zu einem Machtspiel zwischen zwei männlichen Figuren, wobei die Hüter des Gesetzes (Vater/Türhüter) jeweils stärker sind. Dieses Machtgefälle entsteht durch einen tatsächlichen oder auch nur vorgegebenen Wissensvorsprung des stärkeren Protagonisten, der über die Beschaffenheit des zu verhandelnden Themas (Freund/Gesetz) vordergründig mehr Kenntnis aufzuweisen hat. Weder der Sohn noch der Mann vom Lande setzen sich letztlich über die vorgegebenen Spielregeln bzw. Verbote hinweg, sie zweifeln eher an sich selbst als am Wahrheitsgehalt der getroffenen Aussagen ihres Gegenübers. Ihre strukturelle Unterlegenheit drückt sich auch darin aus, dass sie sich jeweils an den anderen wenden (müssen?), was sich auch durch den Gegensatz von Statik (Vater/Türhüter) und Bewegung (Sohn geht ins väterliche Zimmer, Mann vom Lande kommt zum Gesetz) ausdrückt. Theoretisch könnten sowohl Georg Bendemann als auch der Mann vom Lande die Handlungen, die sie sich vorgenommen haben (Abschicken des Briefes, Betreten des Gesetzes, dessen Eingang immer offen steht), einfach ausführen. In beiden Werken Kafkas wirft der Mächtigere dem Bittsteller am Ende vor, nicht schon längst das getan zu haben, was derjenige selbst begehrt und was er ihm vorher verwehrt hat (Vater: Wie lange hast du gezögert, ehe du reif geworden bist; Türhüter: Hier konnte niemand sonst Einlaß erhalten, denn dieser Eingang war nur für dich Lehnert, Herbert: Geschichte der deutschen Literatur vom Jugendstil bis zum Expressionismus. Stuttgart, Reclam, 1978 ( Universal-Bibliothek, 9499). S. 850. 2 4 bestimmt.) Das heißt auch, dass offenbar kein Verlass auf die Gültigkeit des Gesagten ist (Wahrheitsfindungsproblem). Weder die Hauptfigur noch die LeserInnen wissen aufgrund der Abwesenheit eines kommentierenden Erzählers, was letztlich wahr ist. Die Parabel Vor dem Gesetz erzählt letztlich in sehr kurzer Form das Leben eines Mannes bis zu seinem Tod, sodass der begehrte Einlass ins Gesetz auch die Suche nach Sinn, nach Selbstverwirklichung, nach Glück (Glanz, der aus der Tür des Gesetzes strömt) sein, die dem Individuum, dem Menschen nicht glückt, weil er (zuviel?) Rücksicht auf andere, auf die gesellschaftlichen Spielregeln (Gesetz), auf eigene Ängste nimmt; weil er sich anpasst, anstatt auf seine innere Stimme zu hören. So schreibt Herbert Lehnert über die Parabel: In ihr ist das Paradox gestaltet, daß der Mann vom Lande vor seiner eigenen Tür zum „Gesetz ankommt, die offen ist, aber sich durch die Worte des Türhüters am Eintritt hindern läßt. Der Türhüter dürfte für die Reflexe anderer Menschen in unserem Bewußtsein stehen, wie die Gerichtspersonen im Roman (gemeint ist Der Prozess, Anmerkung v. M. Frick). Zu der geheiligten Ordnung, symbolisiert durch den Glanz, der aus der Tür des Gesetzes bricht, könnte der einzelne nur vorstoßen, wenn er von den Wirkungen anderer Menschen absehen könnte. Das ist aber unmöglich. Das Gesetz, von dem Glanz ausgeht, könnte sehr wohl ein Symbol für das perfekte Kunstwerk sein, die eigene Tür dazu die vollkommene Originalität. 3 Einordnung und Rezeption Kafkas Dem Alter nach gehört Kafka zur Generation der Expressionisten, wobei sein Schreibstil nicht viel mit den typischen Vertretern dieser Richtung zu tun hat. Leichte Anklänge an seine Zeitgenossen werden sichtbar in der Ausformung des Vater-Sohn-Konflikts, der Verwendung von Tiermetaphern (siehe Die Verwandlung sowie Tiersymbolik in der expressionistischen Malerei) im Vorrang der Idee, des Gefühls, der inneren Welt, die im nur scheinbar realistisch Erzählten Ausdruck finden soll (teilweise ohne Rücksicht auf Logik und Wahrscheinlichkeit). Letzteres verleiht Kafkas Erzählungen und Romanen stellenweise surreale bzw. absurde Züge, die literarisch weit ins 20. Jahrhundert vorausweisen. Dennoch knüpft sein Schreibstil und seine Konzentration auf die Gattungen Erzählung und Roman an Traditionen an. Er schätzte u. a. Goethe, Kleist (!), Dickens, Flaubert, Dostojewski, Thomas Mann. Zu seinen Lebzeiten wurde Kafka nur in Bruchstücken bekannt. Seit dem 2. Weltkrieg ist Kafka jedoch zu einem Klassiker der Moderne geworden, Ausgaben seiner Werke erreichen Bestsellerauflagen und sind in viele Sprachen übersetzt. GegenwartsautorInnen bekennen sich zu seiner Wirkung. Die Wirkungsgeschichte Kafkas hängt auch damit zusammen, dass kaum ein anderer Autor so unterschiedlich interpretiert wurde (und werden kann) wie er: biographisch, politisch, sozialgeschichtlich, psychologisch und psychoanalytisch, religiös und existenzphilosophisch. Sein Werk wurde jedoch gerade dadurch zum Musterbeispiel modernen Literaturverständnisses überhaupt, nämlich dass der Sinn eines literarischen Werkes nicht nur und nicht eindeutig vom Text selbst festgelegt wird, sondern sich erst aus der Wechselwirkung zwischen Text und Leser jeweils ergibt. Die bis heute anhaltende Wirkung Kafkas zeigt, dass moderne Leser in seinen Texten eigene Erfahrungen und Vorstellungen wiederzuerkennen glauben: seien es die Unsicherheiten des reflektierenden Ichs, die Zweifel an Erkenntnis und Glauben, die Irritationen durch eine erforschte, aber nicht verstandene Welt, die Ängste gesellschaftlicher und politischer Unfreiheit oder gar die Katastrophenschocks. 3 ebd., S. 859.