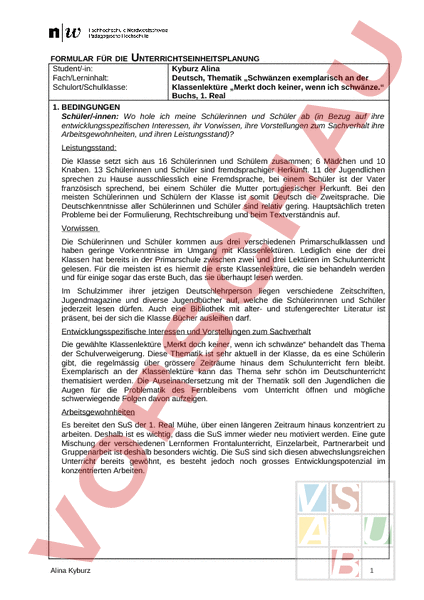Arbeitsblatt: Merkt doch keiner, wenn ich schwänze
Material-Details
UEP über drei Wochen zur Klassenlektüre "Merkt doch keiner wenn ich schwänze"
Deutsch
Leseförderung / Literatur
6. Schuljahr
8 Seiten
Statistik
59990
3222
42
02.05.2010
Autor/in
AplusK (Spitzname)
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
FORMULAR FÜR DIE Student/-in: Fach/Lerninhalt: Schulort/Schulklasse: UNTERRICHTSEINHEITSPLANUNG Kyburz Alina Deutsch, Thematik „Schwänzen exemplarisch an der Klassenlektüre „Merkt doch keiner, wenn ich schwänze. Buchs, 1. Real 1. BEDINGUNGEN Schüler/-innen: Wo hole ich meine Schülerinnen und Schüler ab (in Bezug auf ihre entwicklungsspezifischen Interessen, ihr Vorwissen, ihre Vorstellungen zum Sachverhalt ihre Arbeitsgewohnheiten, und ihren Leistungsstand)? Leistungsstand: Die Klasse setzt sich aus 16 Schülerinnen und Schülern zusammen; 6 Mädchen und 10 Knaben. 13 Schülerinnen und Schüler sind fremdsprachiger Herkunft. 11 der Jugendlichen sprechen zu Hause ausschliesslich eine Fremdsprache, bei einem Schüler ist der Vater französisch sprechend, bei einem Schüler die Mutter portugiesischer Herkunft. Bei den meisten Schülerinnen und Schülern der Klasse ist somit Deutsch die Zweitsprache. Die Deutschkenntnisse aller Schülerinnen und Schüler sind relativ gering. Hauptsächlich treten Probleme bei der Formulierung, Rechtschreibung und beim Textverständnis auf. Vorwissen Die Schülerinnen und Schüler kommen aus drei verschiedenen Primarschulklassen und haben geringe Vorkenntnisse im Umgang mit Klassenlektüren. Lediglich eine der drei Klassen hat bereits in der Primarschule zwischen zwei und drei Lektüren im Schulunterricht gelesen. Für die meisten ist es hiermit die erste Klassenlektüre, die sie behandeln werden und für einige sogar das erste Buch, das sie überhaupt lesen werden. Im Schulzimmer ihrer jetzigen Deutschlehrperson liegen verschiedene Zeitschriften, Jugendmagazine und diverse Jugendbücher auf, welche die Schülerinnnen und Schüler jederzeit lesen dürfen. Auch eine Bibliothek mit alter- und stufengerechter Literatur ist präsent, bei der sich die Klasse Bücher ausleihen darf. Entwicklungsspezifische Interessen und Vorstellungen zum Sachverhalt Die gewählte Klassenlektüre „Merkt doch keiner, wenn ich schwänze behandelt das Thema der Schulverweigerung. Diese Thematik ist sehr aktuell in der Klasse, da es eine Schülerin gibt, die regelmässig über grössere Zeiträume hinaus dem Schulunterricht fern bleibt. Exemplarisch an der Klassenlektüre kann das Thema sehr schön im Deutschunterricht thematisiert werden. Die Auseinandersetzung mit der Thematik soll den Jugendlichen die Augen für die Problematik des Fernbleibens vom Unterricht öffnen und mögliche schwerwiegende Folgen davon aufzeigen. Arbeitsgewohnheiten Es bereitet den SuS der 1. Real Mühe, über einen längeren Zeitraum hinaus konzentriert zu arbeiten. Deshalb ist es wichtig, dass die SuS immer wieder neu motiviert werden. Eine gute Mischung der verschiedenen Lernformen Frontalunterricht, Einzelarbeit, Partnerarbeit und Gruppenarbeit ist deshalb besonders wichtig. Die SuS sind sich diesen abwechslungsreichen Unterricht bereits gewöhnt, es besteht jedoch noch grosses Entwicklungspotenzial im konzentrierten Arbeiten. Alina Kyburz 1 Lehrplan: Welche Vorschriften und Hinweise enthält der Lehrplan (in Bezug auf die Verbindlichkeit des Themas oder Ziels, auf Fach- und Stufenziele)? Welches sind die Leitideen und/oder Grobziele, die von Seiten des Lehrplanes vorgegeben werden? Zuhören und sprechen Persönliche Haltungen und Meinungen erkennen Informationen aus Medien erschliessen und dazu Stellung beziehen Verschiedene Gespräche in Standardsprache führen Sachverhalt, Eindrücke und Meinungen darlegen Arbeitsergebnisse vorstellen Lesen Verschiedene Leseverfahren kennen und anwenden Unverstandenes mit Hilfsmitteln klären Sichtweisen und Haltungen von Personen erkennen Texte mit vielfältigen Mitteln gestalten und umsetzen Selbständige Anweisungen und andere Informationen verstehen und handelnd umsetzen Eigene Texte und Texte von andern austauschen, kommentieren und dabei voneinander lernen Texte schreiben Texte szenisch gestalten Persönliche Formen des freien, ungebundenen Schreibens entwickeln (Lesejournal, Geschichte) Ideen und Gedanken zusammentragen und ordnen Hilfsmittel zur Überarbeitung von eigenen Schreibentwürfen kennen lernen und anwenden Sprachbetrachtung Nomen, Verb und Adjektiv nach formalen Kriterien ordnen Die Fälle anwenden und das Gefühl für die Fälle verfeinern Eigene Texte überarbeiten und dabei Hilfsmittel kennen lernen und anwenden Sicherheit im Schreiben von eigenen kurzen Texten gewinnen Situation: Wie sind die situativen Rahmenbedingungen (Raum, Medienausstattung, Zeitbudget)? Das Klassenzimmer ist mit zwei Polstersesseln ausgestattet, welche den SuS jederzeit zum freien und entspannten Lesen zur Verfügung stehen. Laptops können vorreserviert und in den Unterricht integriert werden, CD-Player und TV sind fest im Zimmer installiert. Es besteht genügend Platz für Gruppenarbeiten und individuelle Projekte. Das Zeitbudget zur Behandlung der Thematik Schwänzen an der Klassenlektüre „Merkt doch keiner, wenn ich schwänze beträgt 18 Stunden. Alina Kyburz 2 2. THEMATIK Fachliche Durchdringung und Analyse des Lerninhalts: Welches sind wichtige Aspekte eines Sach- oder Sinnzusammenhanges? Hat der Lerninhalt verschiedene Sinn- und Bedeutungsschichten? In welchem grösseren Zusammenhang steht dieser Inhalt? Was muss sachlich vorausgegangen sein? Welche Begriffe sind wichtig und notwendig? Hat der Lerninhalt eine Geschichte? Welche Beziehungen bestehen zwischen einzelnen Teilthemen? Welche Literatur, welche empirischen Daten und Quellen stehen zum Thema zur Verfügung? Schulverweigerung ist ein Phänomen mit unterschiedlichen Ausprägungen. Oft beginnt es harmlos mit vorübergehender Schulunlust und gelegentlichem Schwänzen einzelner Schulstunden. Dann kommt es mit zunehmender Schulmüdigkeit zu wiederholtem Schwänzen während ganzer Schultage, was sich bis zur Leistungsverweigerung aus Überzeugung und ständigem Fernbleiben vom Schulunterricht steigern kann. Bei Schülerinnen und Schülern mit gehäuften Schulversäumnissen besteht die Gefahr einer kriminellen Karriere. Es ist nachgewiesen, dass gehäufte Schulversäumnisse ein Risiko für den Schulerfolg sind. SuS, die ihre Identität als Schüler/in verlieren, tragen ein erhöhtes Risiko, ins gesellschaftliche Abseits zu geraten und nicht mehr am Ausbildungs- und Arbeitsleben teilhaben zu können. Es ist daher eine Pflicht der Schule, SuS und deren Familie die Chance zu geben, die Angebote der Schule als etwas zu erkennen, das ihrer eigenen Verwirklichung dient. Die Durchsetzung der Schulpflicht obliegt der Schulpflege. Fällt der Erfolg aus, kümmert sich die Bereichs-Schulleitung um einen eventuellen Obhutentzug. Schulverweigerndes Verhalten hat kein einheitliches Muster. Oft sind es ganz individuelle Motive, warum SuS nicht zur Schule gehen. Je stärker sich das Fehlen in der Schule als Verhalten verfestigt, desto schwieriger ist es, diese aufzugeben. Es sollte deshalb so früh wie möglich gehandelt werden. Wegschauen und den Kontakt verlieren ist eines der zentralen Probleme bei der Schulverweigerung. Wenn keine Reaktion auf das Fehlen im Unterricht folgt, werden SuS ungewollt dazu getrieben, auch weiterhin zu fehlen, da sie sich nicht „gesehen fühlen. Ein Teufelskreis setzt ein. Die Gründe für ein Fernbleiben vom Unterricht können sehr tief liegend sein. Oft werden SuS zu Hause schlechte Beispiele von Eltern und Geschwistern vorgelebt. Womit kann die Aufmerksamkeit eines Schülers/einer Schülerin zurück gewonnen werden? Die besten Möglichkeiten sind, eigene Gefühle wie Ärger von Lehrkräften und Eltern über das Fehlen der SuS und die Hilflosigkeit und Angst vor der Schule. Diese Gefühle sollten durch Ich-Botschaften anstelle von Moralpredigten wirkungsvoll ausgedrückt werden. Zusammenarbeit und Zusammenhalt zwischen Elternhaus, Schule und weiteren Institutionen ist die einzige Möglichkeit, die SuS wieder zum Schulbesuch zu bewegen. Am besten findet man den Zugang zu einem schwänzenden Schüler einer schwänzenden Schülerin, indem man versucht, sich in seine Lage zu versetzen. In der Unterrichtseinheit wird die Thematik Schwänzen exemplarisch an der Klassenlektüre „Merkt doch keiner, wenn ich schwänze erarbeitet. Die Lektüre handelt vom 15jährigen Protagonisten Stefan und dessen Familie. In seiner Familie kommt es oft zu Streitigkeiten, weil das Geld nicht ausreicht. Nachdem nun auch die Mutter ganztags in einem Supermarkt arbeitet, lastet viel Verantwortung auf den Schultern der beiden ältesten Kinder: Sie müssen sich um die zwei jüngsten kümmern und den Haushalt erledigen. Dazu kommt bei Stefan noch, dass er die Schule abrutscht. Er beschliesst eines Tages zu schwänzen und trifft dabei auf ein Mädchen Namens Larissa, das von zu Hause ausgerissen ist. Alina Kyburz 3 3. BEGRÜNDUNGEN Fachwissenschaftliche Bedeutung (Fachrelevanz) exemplarische Bedeutung: Welche Alina Kyburz 4 Bedeutung hat dieser Lerninhalt aus fachlicher Sicht? Ist er zum Beispiel für das grundlegende Verständnis oder für weiterführende Fragen wichtig? Für welche anderen Fach- (teil)gebiete hat er eine Bedeutung? Wie steht es mit der überfachlichen Bedeutung des Inhaltes, werden bestimmte Schlüsselkompetenzen gefördert? Gegenwartsbedeutung: Welche Bedeutung hat der betreffende Inhalt bzw. die an diesem Thema zu gewinnende Erfahrung, Erkenntnis, Fähigkeit oder Fertigkeit bereits im geistigen Leben der Schüler/-innen meiner Klasse, welche Bedeutung sollte er vom pädagogischen Gesichtspunkt aus gesehen darin haben? Zukunftsbedeutung: Worin liegt die Bedeutung des Themas für die Zukunft der Schülerinnen und Schüler? Welche Schlüsselprobleme sollen angesprochen werden? 4. ZIELE, ZUGÄNGE UND ÜBERPRÜFUNG Ziele: Was will ich erreichen? Welche spezifischen Fähigkeiten und Fertigkeiten will ich fördern (verschiedene Lernzielarten und –ebenen berücksichtigen)? Zugänge: Wie kann der Lerninhalt für die Schüler/innen erfahrbar gemacht werden (Texte, Experimente, Personen, Fallbeispiele)? Welche Medien, Tätigkeiten, Experimente etc. eignen sich besonders gut, damit das Thema für die Schüler/innen interessant wird? Welches sind mögliche Anknüpfungspunkte und Problemstellungen? Überprüfung: Welche Ziele sollen überprüft werden? Wie kann das Erreichen dieser Ziele überprüft und beurteilt werden (Leistungsmessung, Ergebniskontrolle)? Alina Kyburz 5 5. INSZENIERUNG Insgesamt beträgt die UEP 18 Lektionen. 5.1 Woche 1 (04.01.10 – 08.01.10) Di (2L) Einführung: SuS tragen an der Wandtafel Positives und Negatives zur Thematik Schwänzen zusammen. Was überwiegt? (10) Lektüre verteilen, SuS haben 5 Minuten Zeit, zu den Charakteren im Buch Informationen zu sammeln. Gefundene Informationen sollen in den Familienstammbaum eingetragen werden. Anschliessend können sie ihre Ergebnisse an die Tafel übertragen. Was wurde herausgefunden? (15) Gemeinsames Lesen an der Lektüre (20) Mi (1L) HA auf Mittwoch: bis S. 25 lesen (Kapitel 1 2) Wisst ihr schon mehr über die Familie? Ergänze den Familienbaum (alle haben bis S. 25 gelesen – das 1. und 2. Kapitel). Mit Banknachbarn vergleichen lassen. Wer hat welche Infos? (10) In Einzelarbeit Arbeitsblatt lösen zu Textverständnis. Haben die SuS grundlegende Informationen aus dem Text herauslesen können? Wenn nicht, müssen sie diese im Text suchen. Gemeinsames Korrigieren (15). 3 weitere Arbeitsblätter zum Textverständnis verschiedener Schwierigkeitsgrade stehen den SuS zur Verfügung. Sie können sich für eines entscheiden, wenn sie es fertig bearbeitet haben sich das Lösungsblatt bei der LP abholen und selbständig korrigieren (20). Fr (2 1 HL) HA auf Freitag: bis S. 34 lesen (Kapitel 3) Halbklasse: Interviews von Schulschwänzern in Deutschland anschauen. SuS erhalten Fragen zugeteilt, deren Antworten sie im Film während dem zuschauen suchen sollen. Anschliessend präsentiert jeder/jede seine Ergebnisse der Klasse und sie werden an der Tafel zu einem Schulschwänzerportrait zusammengetragen. Doppellektion ganze Klasse: Arbeitsblätter lösen zu den Kapiteln 1 3. Verschiedene AB stehen zur Verfügung. SuS können selber auswählen, was sie lösen möchten. Der LP melden (mind. 2 SuS wählen zusammen die das selbe AB) (15) Anschliessend können sie in Partnerarbeit die Lösungen vergleichen und diskutieren. Korrektur der AB im Plenum (15). Unklarheiten klären. Alina Kyburz 6 Diskussion in der Klasse zum Thema Schwänzen: Was sind die Gründe für Stefans Fernbleiben vom Unterricht? Welche Auswege hätte er sonst gehabt? (10) Schreibanlass: Erzähl die Geschichte eines Schulschwänzers (20). Die SuS lesen sich gegenseitig die Geschichten vor. Die Mitschüler/innen geben ein Feedback ab für eine mögliche Verbesserung der Geschichte. Anschliessend können sie die Anregungen einfliessen lassen, verbessern. Sie geben sich eine eigene Bewerung zur Geschichte ab und eine Fremdbeurteilung. Die Geschichten werden der LP abgegeben (25). 5.2 Woche 2 (11.01.10 – 15.01.10) Di (2L) Einführung Redewendungen SuS bekommen ein AB mit Redewendungen im Buch und sollen ihre Bedeutung mit Hilfe des Buches und des Dudens herausfinden. Anschliessende Korrektur im Plenum (45). Gemeinsames Lesen der Lektüre (15). SuS lösen Arbeitsblätter zum Textverständnis des Kapitels 4 und 5 und anschliessende Korrektur (30). Mi (1L) Fr (2 1 HL) HA auf Freitag: lesen bis S. 71 (Kapitel 7) Grammatiklektion: Repetition der Wortarten Nomen, Verb und Adjektiv. SuS müssen Nomen, Verben und Adjektive im Text des Buches bestimmen können (45). Halbklasse: Rollenspiel. Jede Gruppe (3-4 SuS) bekommen eine Szene aus dem Buch zugeteilt mit Seitennummer, schreiben einen Dialog dazu, üben die Szene ein und stellen sie anschliessend der Klasse vor (45). Gesamte Klasse: Zeitungsbericht zum Thema „Schule schwänzen lesen, mit W-Fragen bearbeiten (Lesestrategien) (30). Individuelles Lesen an der Lektüre (15). HA: Lesen bis S. 91 (9. Kapitel) Alina Kyburz 7 5.3 Woche 3 (18.01.10 – 22.01.10) Di (2L) Mi (1L) Fr (2 1 HL) Schreibanlass zum Thema Perspektivenwechsel: Wie erleben die Polizisten die Situation, als sie Stefan und Larissa entdecken? (gemeinsames Schreiben – Schreibförderung Claudia!) (30) Anschliessend vorlesen der Geschichten im Plenum (Kreis) (15). Lektion zum Thema Lesestrategien. SuS haben die Wahl zwischen verschiedenen Arbeitsblättern zu Lesestrategien, welche anhand des Buches aufgearbeitet wurden (45). Während der Lektion immer wieder stoppen, Fragen klären und Stand abklären. Halbklasse: Grammatikeinheit zu den 4 Fällen und Lösen von Arbeitsblättern, basierend auf Text aus dem Buch (45). Gesamte Klasse: Gemeinsames Lesen des Endes des Buches (20). Arbeitsblatt lösen zu Textverständnis über das gesamte Buch. Gemeinsame Korrektur (25). Schreibanlass: SuS schreiben der Autorin einen Brief, wie ihnen die Lektüre gefallen hat. Hat sie das Thema interessiert? Konnten sie sich in die Personen hineinversetzen? Wie hat ihnen das Ende gefallen? Die Briefe sind anonym und werden von der LP eingesammelt. Jeder erhält einen Brief und die Meinungen werden an der WT zusammengetragen. Anschliessend wird die Unterrichtseinheit mit einer Notenvergabe an die Lektüre beendet (45). Alina Kyburz 8