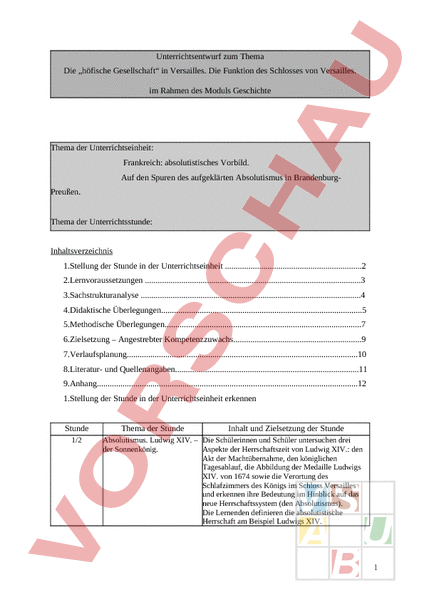Arbeitsblatt: Versailles. Ludwig XIV
Material-Details
Unterrichtsentwurf und Anlagen
Geschichte
Neuzeit
8. Schuljahr
15 Seiten
Statistik
60006
935
14
02.05.2010
Autor/in
Magdalena Myslewska
Land: Deutschland
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Unterrichtsentwurf zum Thema Die „höfische Gesellschaft in Versailles. Die Funktion des Schlosses von Versailles. im Rahmen des Moduls Geschichte Thema der Unterrichtseinheit: Frankreich: absolutistisches Vorbild. Auf den Spuren des aufgeklärten Absolutismus in BrandenburgPreußen. Thema der Unterrichtsstunde: Inhaltsverzeichnis 1.Stellung der Stunde in der Unterrichtseinheit 2 2.Lernvoraussetzungen .3 3.Sachstrukturanalyse .4 4.Didaktische Überlegungen5 5.Methodische Überlegungen7 6.Zielsetzung – Angestrebter Kompetenzzuwachs9 7.Verlaufsplanung10 8.Literatur- und Quellenangaben11 9.Anhang12 1.Stellung der Stunde in der Unterrichtseinheit erkennen Stunde 1/2 Thema der Stunde Inhalt und Zielsetzung der Stunde Absolutismus. Ludwig XIV. – Die Schülerinnen und Schüler untersuchen drei der Sonnenkönig. Aspekte der Herrschaftszeit von Ludwig XIV.: den Akt der Machtübernahme, den königlichen Tagesablauf, die Abbildung der Medaille Ludwigs XIV. von 1674 sowie die Verortung des Schlafzimmers des Königs im Schloss Versailles und erkennen ihre Bedeutung im Hinblick auf das neue Herrschaftssystem (den Absolutismus). Die Lernenden definieren die absolutistische Herrschaft am Beispiel Ludwigs XIV. 1 3/4 5/6 7/8 9 11/12 Der König und sein Hof in Versailles. Gigantomanie im Sumpf. Die Lerngruppe erarbeitet die Baugeschichte und Funktionen des Schlosses in Versailles und erkennt die neue Rolle des Hofes als Zentrum der Machtausübung und Repräsentation. Macht und Herrschaft. Die Lernenden beschreiben die Wirkungen des Auspressen und Strafen. Absolutismus (Kritik an den Ständeprivilegien), indem sie entsprechende Quellen erarbeiten. Merkantilismus und Die Schülerinnen und Schüler benennen den Drang Manufakturen. Der König und der Monarchen nach Anhebung des Steuerertrages sein Geld. als die entscheidende Kraft in den wirtschaftlichen Systemen der absolutistisch geprägten Staaten. Am Beispiel der Manufakturen erläutern sie die praktische Auswirkung der Colbertschen Wirtschaftsvorstellungen. Die Lerngruppe beschreibt die Erneuerungen dieser historischen Erscheinung, z.B.: der staatliche Eingriff in die Wirtschaft, die Veränderungen in der Arbeitswelt. Die Lerngruppe kann die Steigerung der militärischen Macht gegenüber konkurrierenden Monarchen: stehendes Heer als außenpolitische Zielsetzung der absoluten Monarchen beschreiben. Die Schülerinnen und Schüler erläutern den Aufstieg Preußens zu einer der bedeutendsten europäischen Mächte als Konsequenz der strikten Ausrichtung aller materiellen und ideellen Werte Preußens auf das Militärwesen. 2.Lernvoraussetzungen Die Klasse 8 der Georg-August-Zinn-Schule in Kassel setzt sich aus 17 Mädchen und 10 Jungen zusammen. Die Schülerinnen und Schüler sind zwischen 13 und 15 Jahre alt. Diese Schule ist eine Europaschule, die sich zurzeit in der Umwandlungsphase von einer kooperativen in eine integrierte Gesamtschule befindet. Die achten Klassen in der Schule sind der erste Jahrgang, der den Prinzipien der integrierten Gesamtschule folgt. Dementsprechend gehen alle Kinder und Jugendlichen von der fünften bis zur neunten bzw. zehnten 1 Jahrgangsstufe in gemeinsame Klassen. Die Schülerinnen und Schüler aus jeder Klasse werden in den Fächern Deutsch, Mathematik und Fremdsprachen in Grund- und Erweiterungskurse eingeteilt und dementsprechend konsequent gefördert. Die Georg-August-Zinn-Schule liegt im Stadtteil Oberzwehren an der südlichen Peripherie Kassels. Die Wohnbevölkerung im Einzugsbereich der Schule hat sich inzwischen verändert. Aufgrund der Nähe zum VW-Werk in Baunatal zogen Ende der 60er-Jahre zogen zunehmend Familien türkischer Herkunft in den Stadtteil. Mit Ende der 70er-Jahre zogen politische Flüchtlinge zu, insbesondere aus Eritrea und Afghanistan. Zu Beginn der 80er-Jahre kamen deutsche Aussiedlerfamilien – zunächst vor allem aus Polen, dann bis heute aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion – in den Stadtteil hinzu, der einen großen Bestand an geförderten Sozialwohnungen hat. Der Anteil von Kindern mit anderer Staatsangehörigkeit liegt bei ca. 25%, der Anteil der Kinder von deutschen Aussiedlern, die jedoch nicht in Deutschland geboren sind, bis auf 50% stieg. Da sich zusätzlich die Existenzbedingungen der großen Mehrheit dieser Familien infolge der wirtschaftlichen Entwicklung und der geänderten Anforderungen an die Arbeitskräfte auf dem Arbeitsmarkt extrem verschlechtert haben, hat sich dieses Wohnviertel zum sozialen Brennpunkt in der Stadt Kassel entwickelt. Ich habe die Klasse 8 mit dem Beginn des Schuljahres 2009/10 und meiner Hospitationszeit an dieser Schule kennen gelernt. Ich unterrichte in der Klasse seit dem 13.11.09. Bis zu dieser Zeit haben sich die Schülerinnen und Schüler im Rahmen des GL-Unterrichts mit dem politischen System der BRD und mit Themen aus dem Bereich Geographie beschäftigt. Die gesamte Unterrichtseinheit aus dem Bereich Geschichte wurde mir überlassen. Den Unterricht in den Fächern Deutsch und GL erhält die Lerngruppe von ihrem Klassenlehrer und meinem Mentor Herrn Nentwich, der ihr gegenüber sehr konsequent ist, was durch massive Erziehungs- und Disziplinprobleme der Lehrer mit diesen Lernenden in den letzen Schuljahren zu begründen ist. Im Unterricht herrscht meistens Disziplin und lernfördernde Ruhe. Aus diesem Grund fällt es mir schwer, eine Aussage über die Atmosphäre in der Gruppe zu formulieren. Es lässt sich jedoch, was den psychischen und vor allem sprachlichen Entwicklungsstand betrifft, eine deutliche Heterogenität feststellen. Insgesamt ist der relativ große Teil der Gruppe am Unterricht interessiert, was sich an ihren Wortmeldungen erkennen lässt. Zu den leistungsstarken Schülerinnen und Schüler gehören Annalena, Aylin, Karo, Philipp und Franziska. Sie bilden auch die Gruppe, die sich am meisten im Unterricht meldet. Im Gegensatz zu dieser Gruppe ist Chrysa eine der Schülerinnen, die nicht nur mit großen sprachlichen Problemen zu kämpfen hat, sondern auch 1 mit dem Gedanken in ihre Heimat Griechenland zurückzukehren. Dementsprechend sind auch ihre schulischen Leistungen im Vergleich schwach. Der Raum, in dem der Unterricht stattfindet, ist der Klassenraum der Schüler und kein spezieller Geschichtsraum. 3.Sachstrukturanalyse Die Historiker können sich nicht auf eine verbindliche, auf alle Ausprägungen des Absolutismus in Europa zutreffende Definition einigen, weil die Durchsetzung der fürstlichen Souveränität in den einzelnen europäischen Staaten von unterschiedlicher Intensität war und weil politische und sozialstrukturelle Faktoren diese Angelegenheit betreffend divergente Formen des Absolutismus zur Folge hatten. Das französische Modell des Absolutismus wurde zum Vorbild für die meisten Staaten Europas. Das französische absolutistische Herrschaftssystem erreichte sogar die Rangstufe des obligatorischen Musterbildes. Zum Vorbild wurde primär die rationale Begründung der Alleinherrschaft, indem im Vordergrund die Effizienz des Verwaltungsapparates, seine Zweckmäßigkeit, die Beschleunigung der Ausführung von königlichen Verordnungen sowie die bestmögliche Durchsetzung des Staatsinteresses. Was dem französischen Vorbild seine eigene Faszination verlieh, das war die Tatsache, dass und wie sehr die einzelnen Elemente ineinandergriffen, wie sehr ein unbändiger und konsequenter Rationalisierungswille dem großen Ziel der Epoche nahekam, dem Staat den Charakter einer Maschine, eines vollkommenen „Systems zu verleihen[]1 Außerdem war nirgendwo in Europa außer in Frankreich die absolutistische Herrschaft im Hinblick auf eines ihrer wichtigsten Ziele so erfolgreich: der Disziplinierung und Unterordnung der Untertanen in politischer, gesetzmäßiger, religiöser und kultureller Hinsicht. Das Schloss von Versailles wurde nicht nur zum Symbol der absolutistischen Herrschaft Ludwigs XIV., sondern auch zum Symbol für den Absolutismus überhaupt. Die Ausgaben für den Hof und für die Bauarbeiten in Versailles waren immens es gab keinen anderen Herrscher in Europa, der wie Ludwig XIV. bereit war, diese Geldsummen für seine Residenz auszugeben. Es wäre jedoch ein Fehler, das Vorgehen des französischen Königs nur in Kategorien der Verschwendung zu erfassen. Erstens wurde mit der räumlichen Entfernung vom Zentrum der Stadt Paris beabsichtigt, den Konflikten mit einer selbstbewussten Kommune zu entgehen. Auf der anderen Seite konnte die architektonische Bauidee unbeschränkt von den Stadtmauern verwirklicht werden. Auf diese Art und Weise wurden Parks und Gärten geschaffen, in denen sich die höfische Gesellschaft den zahlreichen 1 Durchhardt, H.: Das Zeitalter des Absolutismus, München 1998, S.49. 1 Feierlichkeiten und Spielen hingeben konnte. Drittens gelang es dem Ludwig XIV. durch die Geschlossenheit des Hofes und dem damit verbundenen glanzvollen, luxuriösen Leben auf Versailles, den französischen Adel an sich zu binden, zu entmachten und von der eigene Person abhängig zu machen. „[] dem Brief- und auch dem Schwertadel wird durch eine Statistenrolle immer und immer wieder vor Augen geführt, durch ein peinlich beachtetes Zeremoniell, durch Gnadenerweise oder willkürliche Gunstverweigerung demonstriert, dass er über die Funktion einer Kultdienerschaft nicht hinauskommen sollte. 2 4.Didaktische Überlegungen Die Unterrichtseinheit „Die Herrschaft absoluter Fürsten und Könige in der Kritik ihrer Zeit ist im hessischen Lehrplan im Bildungsgang Realschule für das Fach Geschichte in der Klasse 8 vorgesehen3. Das Fach Gesellschaftslehre mit den Fächern Geschichte, Erdkunde und Sozialkunde wird an der Georg-August-Zinn-Schule ab der fünften Klasse mit vier Stunden in der Woche unterrichtet. In der Klasse 8a werden die Unterrichtseinheiten in den drei Fächern abwechselnd durchgeführt. In dieser Unterrichtseinheit untersuchen die Schülerinnen und Schüler den Absolutismus, bewerten seine Ideologie des Herrschaftsanspruchs und versuchen sich an einer Erklärung der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Auswirkungen seiner uneingeschränkten Herrschaft anhand der Ideen der Aufklärung. Im Hinblick auf die Entwicklung und den Fortschritt der souveränen Kolonien in Nordamerika stellt sich die Verknüpfung dieser Ideen mit wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Faktoren sowie der Kontrast zwischen Verfassungsanspruch und Verfassungswirklichkeit als revolutionsführend dar. Der Absolutismus ist die Staats- und Herrschaftsform, die der modernen Welt zeitlich vorausgeht und in der sich das Fundament unserer modernen Staatsbestandteile wie Verwaltungs- und Bürokratieapparat, stehendes Heer, staatliche Wirtschaftslenkung sowie die Arbeitsteilung als leitender Gedanke der Produktion in den Fabriken herauszubilden begannen. Das absolutistische Herrschaftssystem ausschließlich über diese Merkmale zu definieren, ist jedoch nicht korrekt. Diese Herrschaftsform förderte in einmaliger Weise die Kunst um sich zugleich ihrer zu bedienen. Mit dem Zeitalter des Barocks von etwa 1600 bis 1750 werden heute Attribute wie überladen, absonderlich, verschnörkelt verbunden; er steht für üppige Formen und ausschweifende Gelage. Charakteristisch für das Lebensgefühl im 2 Vgl. Durchhardt, H.: Das Zeitalter des Absolutismus, München 1998, S.53. 3 Vgl. Hessisches Kultusministerium: Lehrplan Geschichte, Bildungsgang Realschule. Jahrgangsstufen 5 bis 10. Wiesbaden, S. 16. 1 Barock ist die Diskrepanz und Zerrissenheit zwischen Lebensfreude und religiöser Bescheidenheit, zwischen Sinnenfreude und Angst vor dem Tod und der „letzten Abrechnung. Die Förderung der Kunst durch die absolutistischen Herrscher fand aus zwei Gründen statt: Einerseits sollte die Kunst ästhetische Bedürfnisse befriedigen, andererseits Macht, Stellung, Allgewalt und ,Herrschaft demonstrieren4. Der Bau eines neuen Schlosses in Versailles und das Leben am Hof waren ein sichtbarer Teil und eine Demonstration der absolutistischen Herrschaftsmacht Ludwigs XIV. Das Baukonzept des Schlosses in Versailles und das Leben am Hofe Ludwigs XIV. bieten die Möglichkeit an, die höchst komplizierten Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse des französischen Absolutismus den Schülerinnen und Schülern näher zu bringen. Dabei kann der Anspruch des Herrschers, glanzvoller Mittelpunkt des Staates und die „Sonne für die Welt zu sein, gezeigt werden. „Der höfische Aufwand diente zunächst und vordergründig der Repräsentation der Macht. Der ungeheure, verschwenderische Pomp, aller prunkvolle Glanz, den das absolutistische Hofleben entfaltete, wurde zum anerkannten Ausdruck der politischen Stellung des betreffenden Herrscherhauses (.). In der bloßen Repräsentation der Macht erschöpfte sich freilich die Funktion des höfischen Aufwandes nicht (.). Was sich darin äußert, ist das Streben nach Machtprestige 5 Die Erarbeitung der Unterschiede zwischen dem höfischen Leben, dessen Mittelpunkt der Tagesablauf des Königs war und der Bedingungen unter denen die Untertanen weit ab vom Hofe Ludwigs XIV. lebten, zeigt die wesentlichen Kennzeichen des Absolutismus. Eine ausgefallene Zeremonie am Hof band die höfische Gesellschaft den Adel an die Person des Königs und übergab ihr eine konkrete Aufgabe z.B. Anwesenheit beim königlichen zum Bett gehen, die sie jedoch daran hinderte, sich intensiv um Politik und Wirtschaft zu kümmern. Durch diese neue Position im Staat war der Adel zwar politisch entmachtet, wurde aber dafür mit Auszeichnungen „belohnt. Die prunkvolle Entwicklung des höfischen Lebens und der Kult um den König wurden mit dem Ziel realisiert, die Gefahren d.h. den Adel zu neutralisieren. Der Adel wurde vom König immer abhängiger, da das Erscheinen am Hof mit neuen Privilegien verbunden war, denen kaum jemand widerstehen konnte. Bei der Auseinandersetzung mit dem Thema Versailles im Unterricht geht es nicht darum, die einzelnen Baudetails des Schlosses oder die Einzelheiten des höfischen Zeremoniells zu thematisieren. Es geht vielmehr um den Symbolcharakter des Bauwerks, um die politischen Absichten, die hinter dem Bau steckten, und um Hinweise auf die Sozialstruktur des absolutistischen Systems, als dessen Quelle der Hof von Versailles gesehen wird. 4 Vgl. Entdecken und Verstehen. Handreichungen für den Unterricht. (Hrsg.) Dr. T. Berger-v.d.Heide; Prof. Dr. H.G. Oomen, S.102-110. 5 Vgl. Kreuedener, J. zit.n. Maier, G Der Absolutismus. Arbeitsblätter, 2007 Leipzig, S.66. 1 5.Methodische Überlegungen Als Einstieg in die Stunde dienen die Fotos von Versailles (u.a. das Königliche Schlafzimmer, die Schlosskapelle, der Spiegelsaal, die Frontseite des Schlosses, der Schlossgarten mit Brunnen). Das Schloss von Versailles und die politischen Absichten Ludwigs XIV., die in der Bauidee des Schlosses verborgen waren, stellen die Problemorientierung der Stunde dar. Die Schülerinnen und Schüler lassen die Fotos auf sich wirken und äußern ihre Eindrücke. Anschließend äußern sie Vermutungen zu der Frage: Warum wird Versailles als Symbol für die Machtentfaltung Ludwigs XIV. gesehen? Die Antworten werden stichwortartig an der Tafel festgehalten, sodass die Lernenden in der Abschlussphase des Unterrichts ihre Antworten auf diese Frage noch einmal reflektieren und ergänzen können. Die Fotos sollen der Lerngruppe verdeutlichen, wie der absolutistische Herrscher gelebt hat und wie wichtig es für ihn war, seine außergewöhnliche Stellung im Staat u.a. durch seine Lebensweise zu hervorzuheben. Die Frage in der Einführungsphase, deren Antworten von der Lehrkraft noch nicht korrigiert bzw. ergänzt werden, wird mit dem Ziel gestellt, die Schülerinnen und Schüler für den Schwerpunkt der Stunde zu sensibilisieren und sie zur Suche nach einer Erklärung zu veranlassen. Im weiteren Verlauf der Stunde werden die Schülerinnen und Schüler in drei Arbeitsgruppen zu je acht Personen eingeteilt. Zwei Gruppen bekommen zwei verschiedene Quellentexte (Die Texte sind im Hinblick auf die massiven Verständnisprobleme von den Buchautoren in vereinfachter Form prässentiert.) mit Arbeitsaufträgen6 7, die dritte Gruppe schaut sich einen Filmausschnitt an und beantwortet Fragen zum Filminhalt (Der Film hat englische Untertitel. Um sicher zu sein, dass die Gruppe den kurzen Dialog versteht, finden die Gruppenmitglieder auf dem Blatt mit Aufgaben die deutsche Übersetzung dieses Dialogs.) Die Arbeitsblätter werden innerhalb jeder Gruppe in einer bestimmten Farbe verteilt. Nach der Bearbeitung der Aufgaben bilden die Lernenden Expertengruppen aus drei Personen, wobei jede dieser Personen zuvor eine andere Aufgabe bearbeiten musste. Da jeder Schüler innerhalb einer Gruppe sein Arbeitsblatt in der gleichen Farbe bekommen hat, muss er bei der Bildung der Expertengruppen darauf achten, dass er den Partner mit einer anderen Arbeitsblattfarbe findet. Die Lernenden tauschen untereinander die Informationen über den Inhalt ihrer Texte aus. Ich habe mich für diese Methode der Erarbeitung entschieden, weil sie der Lerngruppe bereits bekannt ist, im Bezug darauf sollte also die Phase der Bildung von Expertengruppen nicht zu 6 Vgl. Hohmann, F.: Herrschen mit Hof und Etikette. Der Absolutismus, 2008 Bamberg, S. 10. 7 Vgl. Maier, G Der Absolutismus. Arbeitsblätter, 2007 Leipzig, S.34. 1 viel Zeit in Anspruch nehmen. Außerdem können die Lernenden auf diese Art und Weise selbstständig die Lerninhalte erarbeiten und sie als Experten weitergeben. Im Anschluss an diese Phase wird den Schülerinnen und Schülern ein Arbeitsblatt ausgeteilt, sodass sie die gemeinsam erarbeiteten Inhalte schriftlich sichern können. Diese Aufgabe bearbeiten die Schülerinnen und Schüler in der Einzelarbeit. Auf der Rückseite dieses Blattes befindet sich eine Hilfestellung. Somit können die Lernenden differenziert arbeiten und selbstständig feststellen, ob sie diese Hilfe brauchen. Danach wird auf dem OHP eine Folie mit dieser Aufgabe präsentiert und gemeinsam im Plenum ergänzt. Als Hausaufgabe bekommen die Lernenden ein Arbeitsblatt mit einem Grundriss des Schlosses und mit dem Plan der ersten Etage sowie zwei Aufgaben dazu8. Die Hausaufgabe hat zum Ziel die Vertiefung der Erkenntnis aus der Stunde. Die Anordnung der Räume spiegelt den Herrschaftsanspruch und das hierarchische Denken des Königs wider. Je näher eine Person dem Sonnenkönig stand, desto näher befand sich ihr Zimmer dem Appartement des Königs. 6.Zielsetzung Angestrebter Kompetenzzuwachs Die Schülerinnen und Schüler gewinnen einen Einblick in die Aspekte der höfischen Gesellschaft von Versailles und erkennen die Zusammenhänge zwischen dem Bauplan des Schlosses und der politischen Absicht der Neutralisierung des Adels in Frankreich unter Ludwig XIV., indem sie entsprechende historische Quellen in Gruppenarbeit erarbeiten, ihre Ergebnisse in den Expertengruppen präsentieren und schließlich im Plenum schriftlich sichern. 8 Vgl. Bernhardt, A.: Gigantomanie im Sumpf in: Praxis Geschichte, Heft 4, 2007 Braunschweig, S. 16. 1 7.Verlaufsplanung Zeit 8 Min. 7 Min. Phase/Inhalt Einstieg: Bilder: Räumlichkeiten im Schloss von Versailles Arbeitsauftrag: Lasst die Bilder auf euch wirken und beschreibt das Foto, ohne es zu zeigen. Vermutete Schüleräußerungen: überladen, üppig, luxuriös, . Frage: Warum wird Versailles als Symbol für die Machtentfaltung Ludwigs XIV. bezeichnet? Vermutete Schüleräußerungen: Machtdemonstration, Mittelpunkt des Staates, Ansammlung französischer Adliger, . Erarbeitungsphase I: Arbeitsblatt mit Grundrissen des Schlosses Vermutete Schülerergebnisse: Die Anordnung der Räume spiegelt das hierarchische Denken des Königs wider. 20 Min. Erarbeitungsphase II: Quellenarbeit in drei Gruppen und Austausch der Informationen über die Quelleninhalte in Expertengruppen Methode, Sozialform Medien Lehreraktivität/ Bilder Gruppenarbeit Unterrichtsgespräch Die Lehrkraft verteilt die Fotos an die Gruppen. Die Lernenden beschreiben sie. Die Lerngruppe äußert ihre Tafel Vermutungen im Plenum und die Lehrkraft notiert sie an der Tafel. Einzelarbeit/Plenum Arbeitsblatt Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten die Aufgaben, tragen ihre Antworten ein und präsentieren im Plenum die Ergebnisse. Gruppenarbeit Die Quellentexte und der Film sowie die entsprechenden Aufgaben werden in den Gruppen bearbeitet und anschließend in den Expertengruppen vorgestellt. Texte (Quellen), Film, Blätter mit Aufträgen 1 Zeit Phase/Inhalt Methode, Sozialform Medien 7 Min. Ergebnissicherung: Die Lerngruppe bekommt ein Arbeitsblatt und löst die Aufgabe. Schließlich wird diese Aufgabe gemeinsam auf einer OHP-Folie präsentiert und bearbeitet. Einzelarbeit Plenum: Unterrichtsgespräch Arbeitsblatt OHP Die Lernenden lösen die Folie Aufgabe und besprechen ihre Lösungsvorschläge im Plenum. 3 Min. Rückblick: Die Schülerinnen und Schüler ergänzen die Frage aus der Einführungsphase. Unterrichtsgespräch Die Lehrkraft stellt wieder mal die Frage aus der Einführungsphase und lässt die Lernenden ihre Antworten resümieren und ergänzen. 1 Min. Hausaufgabe: Die Lerngruppe bekommt ein Arbeitsblatt mit der Hausaufgabe. Arbeitsblatt 8.Literatur- und Quellenangaben Bernhardt, A.: Gigantomanie im Sumpf in: Praxis Geschichte, Heft 4, 2007 Braunschweig. Berger-v.d.Heide, T. Dr.; Prof. Dr. H.G. Oomen (Hrsg.): Entdecken und Verstehen. Handreichungen für den Unterricht. Durchhardt, H.: Das Zeitalter des Absolutismus, München 1998, S.53. Hessisches Kultusministerium: Lehrplan Geschichte, Bildungsgang Realschule. Jahrgangsstufen 5 bis 10. Wiesbaden. Hohmann, F.: Herrschen mit Hof und Etikette. Der Absolutismus, 2008 Bamberg. Maier, G.: Der Absolutismus. Arbeitsblätter, 2007 Leipzig. 1