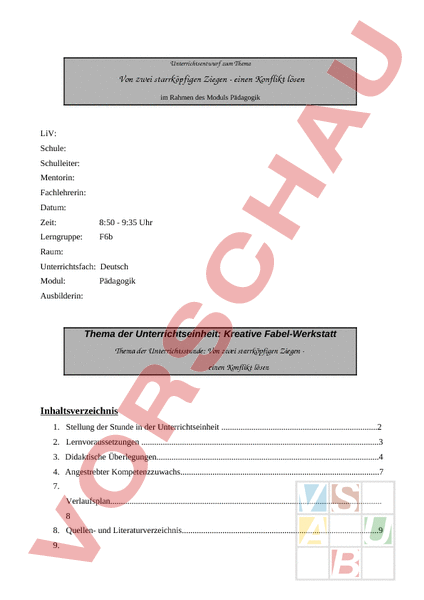Arbeitsblatt: UE Fabel
Material-Details
Unterrichtsentwurf, Fabel "Von zwei starrköpfigen Ziegen"
Deutsch
Anderes Thema
6. Schuljahr
15 Seiten
Statistik
60033
1069
10
13.06.2010
Autor/in
Katarzyna Behrendt
Land: Deutschland
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Unterrichtsentwurf zum Thema Von zwei starrköpfigen Ziegen einen Konflikt lösen im Rahmen des Moduls Pädagogik LiV: Schule: Schulleiter: Mentorin: Fachlehrerin: Datum: Zeit: 8:50 9:35 Uhr Lerngruppe: F6b Raum: Unterrichtsfach: Deutsch Modul: Pädagogik Ausbilderin: Thema der Unterrichtseinheit: Kreative Fabel-Werkstatt Thema der Unterrichtsstunde: Von zwei starrköpfigen Ziegen einen Konflikt lösen Inhaltsverzeichnis 1. Stellung der Stunde in der Unterrichtseinheit .2 2. Lernvoraussetzungen .3 3. Didaktische Überlegungen4 4. Angestrebter Kompetenzzuwachs.7 7. Verlaufsplan. 8 8. Quellen- und Literaturverzeichnis9 9. Anhang10 1.Stellung der Stunde in der Unterrichtseinheit Thema der Unterrichtseinheit: Kreative Fabel- Werkstatt Stunde 1 Thema der Stunde Angestrebter Kompetenzzuwachs Fabeln nacherzählen und Die Schülerinnen und Schüler geben den Inhalt veschiedener untersuchen. Fabeln wieder, vergleichen die Texte und charakterisieren die Merkmale dieser Textsorte. 2 Der Löwe und die Maus- Die Schülerinnen und Schüler lesen die Fabel Der Löwe und zwei verschiedene die Maus sinnverstehend und beschreiben die Eigenschaften Charaktere. der beiden Fabeltiere. Sie erkennen, dass die Tiere menschliche Eigenschaften haben und ordnen diese den anderen Tieren zu. 3 Von zwei starrköpfigen Die Schülerinnen und Schüler stellen mithilfe des szenischen Ziegen – einen Konflikt Verfahrens die Alternativen für die Lösung der in der Fabel lösen. Von zwei starrköpfigen Ziegen von Jean de La Fontain geschilderte Konfliktsituation dar. 4 Der Rabe und der Fuchs- Die Schülerinnen und Schüler stellen die Fabeln Der Rabe Aufbau einer Fabel. und der Fuchs (von Jean de La Fontaine und James Thurber) wieder her, vergleichen sie und beschreiben den Aufbau einer Fabel. 5 6 Der Hahn- eine Fabel in Die Schülerinnen und Schüler untersuchen die Fabel, indem Gedichtsform bringen. sie die Reime erkennen und die Verse wiederherstellen. Die Grille und die Die Schülerinnen und Schüler setzen sich in eines der Ameise- aus der Sicht Fabeltiere hinein und erschließen den Sachverhalt des Textes, eines Fabeltiers erzählen. indem sie die Geschichte aus der jeweiligen Sicht beschreiben. 7 8 Die Stadt- und die Die Schülerinnen und Schüler setzen sich mit dem Inhalt der Landmaus- eine Fabel Fabel spielerisch auseinander, indem sie die Aufführung spielen. vorbereiten, durchführen und vergleichend besprechen. Eine Fabel mit Die Lernenden erstellen ein Cluster zu den ausgewählten Gegensatzpaaren Gegensatzpaaren und gestalten eine moderne Fabel. schreiben. 9-10 Fabelwerkstatt– Die Schülerinnen und Schüler planen und verfassen aufgrund Erstellung eines der Fabelbaukästen eine eigene Fabel und erstellen ein Fabelbuches Fabelbuch. 2. Lernvoraussetzungen Die Klasse F6b besteht aus 24 Schülerinnen und Schülern im Alter von 11 bis 14 Jahre, wovon 10 Mädchen und 14 Jungen sind. Die Lerngruppe ist mir seit Anfang September durch Hospitationen wie auch durch selbst gehaltenen Unterricht bekannt. Meine Eindrücke von der Lerngruppe sind positiv. Die Klasse verhält sich mir gegenüber offen und freundlich. Die Gustav- Heinemann-Schule ist eine kooperative Gesamtschule, die sich als Ziel setzt, die Schülerinnen und Schüler in der Förderstufe (5./6. Klassen) auf die verschiedenen Bildungsgänge vorzubereiten. Dies hat zur Folge, dass das Niveau in den betroffenen Jahrgangsstufen oftmals differiert ist. Dies gilt auch für die Klasse F6b, die insgesamt als sehr heterogen in ihrem Entwicklungsstand und ihrem Leistungsvermögen zu bezeichnen ist, was man an der mündlichen Beteiligung, den Lernergebnissen und dem Arbeitstempo der einzelnen Schülerinnen und Schüler erkennen kann. Die Unterschiede lassen sich insbesondere im sprachlichen Bereich feststellen. 10 Kinder haben einen Migrationshintergrund und in den meisten Fällen wird im Elternhaus in der Muttersprache kommuniziert. Zwei Schülerinnen, Daria und Yuliya, sind erst anderthalb Jahre in Deutschland, wobei Yuliya bemerkbare Fortschritte macht. Daria wirkt wiederum sehr phlegmatisch und zurückhaltend, was sich an ihrer Teilnahmslosigkeit in Bezug auf das Unterrichtsgeschehen äußert. Zwar schlägt sich der Migrationshintergrund bei einigen in einem weniger ausgeprägtem Sprachvermögen nieder, jedoch weist die Lerngruppe außer Daria keinerlei Schwierigkeiten auf, den sprachlichen Anforderungen des Deutschunterrichts gerecht zu werden. Um die bestehenden Defizite im Sprachvermögen auszugleichen bzw. nachzuholen stehen den einzelnen Schülerinnen und Schülern zusätzliche Stunden Förderunterricht zur Verfügung. Ein Schüler (Jonathan) besitzt eine anerkannte LRS. Das Lesen bereitet ihm große Schwierigkeiten, was jedoch in der Klasse bekannt und akzeptiert ist. Das soziale Miteinander kann weitestgehend als gut angesehen werden und die Klasse zeichnet sich im Allgemeinen durch einen freundlichen Umgang miteinander aus. Das Lernverhalten der Schülerinnen und Schüler ist allerdings von der Tagesform und dem Unterrichtsthema abhängig. Insbesondere Feryal fällt durch sein unruhiges Verhalten und vom Thema abweichende Kommentare auf. Er stört leider auch manchmal den Unterricht, indem er mit anderen Schülern spricht. Till gilt in der Klasse als Außenseiter. Er hat wenig Kontakt zu seinen Mitschülerinnen und Mitschülern und der Umgang mit ihm wird weitgehend vermieden. Das Interesse am Fach Deutsch ist geteilt. Etliche Schüler sind passiv und müssen verstärkt zur mündlichen Beteiligung aufgefordert werden. Andere arbeiten motiviert, melden sich gerne zu Wort und wollen unbedingt ihre Ergebnisse präsentieren. Insbesondere Felix ist oft sehr ungeduldig und kann es nicht abwarten zu Wort zu kommen. Gleiches gilt für Feryal und Altan. Obwohl ihre Unterrichtsbeiträge oftmals qualitativ gut sind, muss das Melden immer wieder geübt werden. Dennoch bringen sie den Unterricht voran. Das Klassenklima ist insgesamt als ausgewogen zu bezeichnen, was sicherlich auf das Engagement der Klassenlehrerin zurückgeführt werden darf. Spezielle Lernvoraussetzungen In den vorherigen Stunden hat die Lerngruppe bereits Einblicke in das Thema Fabeln bekommen. Sie haben bereits erarbeitet, welche Merkmale für die zu behandelnde Textsorte typisch sind. Sie verfügen über Kenntnisse darüber, dass die in den Fabeln vorkommenden Tiere menschliche Eigenschaften haben und die zum Schein Schwächeren den Stärkeren oftmals überlegen sind. Während der ersten Unterrichtseinheiten habe ich festgestellt, dass die Vorkenntnisse bezüglich der Fabeln bei den Kindern sehr unterschiedlich waren. Während einige diese Textsorte bisher gar nicht oder nur als reine Tiergeschichten kennen gelernt haben, waren einige wenige ansatzweise mit dem belehrenden Charakter von Fabeln vertraut. Besonders Felix ist hier bisher hervorgetreten und kann den anderen somit potenziell wertvolle Hilfe beim Lernfortschritt in dieser Stunde leisten. Die Schülerinnen und Schüler zeigen sich am aktuellen Thema sehr interessiert, was sich in ihrer aktiven Mitarbeit äußert. Um verschiedenen Lerntypen und Leistungsniveaus gerecht zu werden, bemühte ich mich während meiner bisherigen Lehrproben mit den Schülerinnen und Schülern verschiedene Ansätze auszuprobieren und konnte erfreulicherweise feststellen, dass sich die Gruppe gerne auf verschiedene Unterrichtsmethoden einlässt. Auch kreative Aufgaben, wie z.B. das szenische Spielen, werden von den Lernenden gerne angenommen, allerdings benötigen einige einen zusätzlichen Anschub. Ebenfalls sind den Lernenden Gruppenarbeit und Partnerarbeit bekannt. Sie nehmen diese Arbeitsformen gern an. Hier ist anzumerken, dass man bessere Ergebnisse erzielen kann, wenn die Gruppenkonstellationen von der Lehrperson bestimmt werden. Abschließend bleibt abzuwarten, wie konzentriert die Schülerinnen und Schüler nach den zweiwöchigen Osterferien aktiv am Thema mitarbeiten und der beabsichtigte Lernerfolg erzielt werden kann. 3. Didaktische Überlegungen In der Jahrgangsstufe 6 sieht der hessische Lehrplan des Faches Deutsch den Umgang mit den Texten vor, die eine sozialkritisch-aufklärerische Tendenz haben und das Gerechtigtigkeitsgefühl ansprechen. Des Weiteren wird viel Wert darauf gelegt, dass die Lerninhalte Lust am Spiel mit der Sprache wecken und Anreize sind, über die Sprache nachzudenken. Diese Förderung wurde damit begründet, dass den Lernenden dieser Altersstufe das Unterscheiden zwischen dem Gemeinten und Gesagten, ein Geschehen psychologisch zu interpretieren sowie Handlungen über eine einfache Gut-Böse- Unterscheidung hinaus zu problematisieren viele Schwierigkeiten bereiten.1 In Bezug darauf bietet die Arbeit mit Fabeln eine hervorragende Möglichkeit, das Sprachbewusstsein der Schülerinnen und Schüler zu fördern. Da die Lernenden in diesem Alter häufig Schwierigkeiten haben, ironische Äußerungen von Erwachsenen richtig zu interpretieren, tragen die Fabeln dazu bei, den Umgang mit „uneigentlichem Sprechen zu entwickeln. Andererseits verhelfen sie den Kindern aufgrund ihrer lehrhaften Grundtendenz bei dem Verständnis der zwischenmenschlichen Aktion-Reaktion-Prozesse und damit bei der Entfaltung des gesellschaftskritsichen Bewusstseins. Gelesene oder gehörte Texte zu verstehen und nachzuvollziehen gehört zu den grundlegenden Fähigkeiten, die als Voraussetzung für Leseinteresse, Lesefreude und weitere sinnvolle analytischintellektuelle Aktivitäten anzusehen sind.2 Aus diesem Grund machen der überschaubare Umfang, die innere Geschlossenheit und die verschlüsselte Textaussage Fabeln zu einem besonders geeigneten Unterrichtsgegenstand. Sie regen die Phantasie der Lerndenden an, die eindeutigen Charaktere gestalten die Handlung übersichtlich. Die darin vorkommenden Figuren sind auf ein Minimum eingeschränkt und bedürfen aufgrund dessen, dass ihnen zugeschriebene Eigenschaften (groß-klein, faul-fleißig) nicht nur äußerlich erkennbar sondern auch hinlänglich bekannt sein dürften, kaum einer Erklärung. Die Tiere erleichtern es den Lernenden sich die geschilderte Situation vorzustellen, was ausschlaggebend für das Textverständnis und die Erarbeitung der Moral der Fabel ist. Dabei darf der Sinn der Fabel nicht auf die Abstraktion einer Lehre oder Moral reduziert werden, sondern es muss vielmehr die Herstellung eines aktuellen Bezugs im Vordergrund stehen. Die Lernenden sollen sich selbst in einer Fabel erkennen, Bezüge zur eigenen Lebenssituation sehen und herstellen können. Da die Handlung abstrahiert und von den Schülerinnen und Schülern auf ihre Alltagswelt übertragen werden kann (muss), lassen sie sich im Unterricht gut als Gesprächs-, Diskussions- oder Denkanlass gewinnbringend nutzen. Die von mir ausgewählte Fabel Von zwei starrköpfigen Ziegen von Jean de La Fontaine fordert den Rezipienten auf, sein Handeln gegenüber anderen bezüglich der Goldenen Regel (Bereitschaft zum 1 Vgl. Hessisches Kultusministerium: Lehrplan Deutsch, Bildungsgang Realschule, Jahrgangsstufen 5 bis 10, Wiesbaden 2002, S. 20. 2 Vgl. Spinner, K.H. u.a.: Handlungs- und produktionsorientierter Literaturunterricht, in: Praxis Deutsch 123, S.18. Kompromiss) zu überdenken. Es kann letztlich zum eigenen Schaden führen, wenn man immer nur seine persönlichen Interessen verfolgt. Die Moral der Fabel will den Altruismus gegenüber dem Egoismus fördern und stellt den Kompromiss vor die Selbstbehauptung. Aus diesem Grund eignet sie sich besonders, die Schülerinnen und Schüler dazu zu bringen, über die im Leben unvermeidlichen Konfliktsituationen nachzudenken und das Thema Nachgeben zu problematisieren. Der Text knüpft hervorragend an die Erfahrungswelt der Lernenden an, die häufig in kleine Streitigkeiten mit ihren Mitschülern verwickelt sind und uneinsichtig auf der eigenen Position beharren. Der zu behandelnde Text stellt diese Problematik sehr bildlich und verständlich dar und kann deshalb als Anstoß zu Überlegungen über das eigene Verhalten dienen. Des Weiteren erhalten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, gemeinsam an einer Konfliktlösung zu arbeiten, um sie letztendlich dafür zu sensibilisieren, dass man für jede Streitsituation mit Kompromissbereitschaft einen Ausweg finden kann. Um die Verhaltensweisen und Charaktereigenschaften der Figuren und die Textaussage zu erarbeiten, müssen den Lernenden, wie im Bildungsplan gefordert, unterschiedliche Zugangsweisen geboten metakommunikativ auf werden. Das gemeinsame darstellende Spiel, Darstellung und das „themazentriert Ver(sinn)bildlichung und eines Problemzusammenhangs aus ist, nicht nur auf seine diskursive Erörterung3, bietet hierfür eine Möglichkeit. Das szenische Gestalten eines Textes erfordert eine intensivere Auseinandersetzung mit dessen Inhalt. Erstens müssen die Lernenden im darstellenden Spiel sich in die in der Fabel vorkommenden Figuren hineinfühlen und versuchen ihre Identität einzunehmen. Dies soll einerseits dazu beitragen, dass der Zugang zu dem Text über eigene Sinne und eigenes Tun gewährleistet wird, um die Schülerinnen und Schüler in ihrer Sinnlichkeit, ihren Gefühlen, ihrer Phanastie und ihrem Tätigkeitsdrang anzusprechen.4 Andererseits wird es ihnen dadurch ermöglicht, ohne die spielerische Ebene zu verlassen und ohne die eigene Identität preiszugeben, eigene Reaktionen zu reflektieren und nach eventuellen, konstruktiven Lösungen zu suchen. Des Weiteren findet ein szenisches Spiel in einem sozialen Umfeld statt, in dem der persönliche Ausdruck in einen Gruppenprozess eingebracht wird,5 was auch der persönlichen Entfaltung förderlich ist. Die Kinder in der heutigen Welt sind allzu oft passive Empfänger ihrer mit Reizen überfluteten Umgebung. Sie konsumieren fertige Produkte und ihre Interpretation beschränkt sich lediglich auf die Wiedergabe des Inputs, ohne sich dieses zu verinnerlichen und in eigenen Kreationen zu äußern. Der produktiv- und handlungsorientierte Arbeitsauftrag zu dieser Fabel soll sie dazu anregen, sich 3 Kammler, C. u.a.: Drama-Theater-Szeniszes Spiel, in: Praxis Deutsch. Drama-Theater-Szeniszes Spiel. Sonderheft 2005, S.5. 4 Vgl. Spinner, K.H. u.a.: Handlungs- und produktionsorientierter Literaturunterricht, S.17. 5 Vgl. Spinner, K.H.: Spielszenen im Deutschunterricht (2001), in: Spinner, K.H.: Kreativer Deutschunterricht. Identität-Imagination-Kognition, Seelze- Velber 2006 S. 181. intensiv mit dem Text auseinanderzusetzen und produktiv zu handeln. Die Schülerinnen und Schüler müssen Wörter und Sätze auch wieder in Bilder umsetzen. Sie müssen nicht nur sehen, was der Autor erzählt, sie müssen es auch hören, riechen und schmecken, mit Händen ertasten und mit dem Herzen nachfühlen.„6 Die Lernenden werden angeregt ihre eigene Interpretation des Inhaltes darzulegen und dieses gestaltend zum Ausdruck zu bringen. Dies geht deutlich über eine ledigliche Textrezeption hinaus und soll die Schülerinnen und Schüler befähigen, eigene Standpunkte zu vertreten, was zum Gegenstand des Unterrichts wird. 4. Kompetenzzuwachs Die Schülerinnen und Schüler setzen sich mit einer Konfliktsituation auseinander und entwickeln ihr eigenes Konfliktmanagement, indem sie die Alternativen für die Lösung der in der Fabel Von zwei starrköpfigen Ziegen von Jean de La Fontain geschilderten Streitsituation mithilfe des szenischen Verfahrens darstellen. Sie entwickeln ihr Sozialverhalten, indem sie gemeinsam einen Lösungsweg suchen. Sie entfalten ihre Fähigkeit, Texte zu verstehen, die eine zweite Ebene beinhalten. Sie erschließen den Sachaspekt der Fabel, indem sie die Schlussfolgerungen (die Starrköpfigkeit bringt den beiden Ziegen lediglich Nachteile) ziehen und übertragen den Inhalt und die Lehre der Fabel auf ihre Erfahrungswirklichkeit. 6 Preussler O. Phantasie und Wirklichkeit, zit. nach Spinner K.H.: Literarisches Lernen, in: Praxis Deutsch 200, Seelze 2006, S. 8. 5. Verlaufsplan Zeit Phase Inhalt ca. 5 Min. Einstimmung Die Lehrperson präsentiert den Schülerinnen und Schülern stummer Impuls Folie mit der eine Abbildung. Schüleraktivität Abbildung Die Lernenden äußern sich spontan zu dem Gesehenen (vgl.Anlage 1) Mögliche Schüleräußerungen: OHP, Zwei Ziegen stehen auf einem Steg. Sie sind in einem Wald. evtl. Tafel Unten befindet sich ein Bach. Es gibt nicht genug Platz für die beiden. Vielleicht kämpfen sie gegeneinander. Falls die Äußerungen der Lernenden spärlich bleiben, klappt die Lehrperson die Tafel auf, wo sich zuvor vorbereitete Satzanfänge befinden. Die Lernenden ergänzen mündlich die Satzanfänge. ca. 7 Min. Erarbeitungsphase Die Schülerinnen und Schüler bilden Dreiergruppen und Lesen mit lesen die Fabel Von zwei starrköpfigen Ziegen bis zu der verteilten Rollen Stelle, wo es zu einem verbalen Streit kommt. Gruppenarbeit Die Lehrperson stellt die Frage, wie die Geschichte weitergehen könnte. Die Lernenden stellen Vermutungen an. Mögliche Schüleräußerungen: Sie werden gleich kämpfen. Der Steg zerbricht und die Ziegen fallen ins kalte Wasser. ca. 8 Min. ca. 15 Min. ca. 4 Min. ca. 3 Min. Methode Sozialform Medien Erarbeitungsphase II Die Schülerinnen und Schüler bereiten einen Dialog Gruppenarbeit zwischen den beiden Ziegen und dem Schiedsrichter szenisches mündlich vor und überdenken eine Lösungsmöglichkeit. Darstellen Falls die Lernenden Schwierigkeiten hätten, liegt auf dem Lehrertisch eine Ideenbox bereit. Ergebnissicherung Plenum Die Lernenden präsentieren ihre Konfliktsituation im szenisches szenischen Spiel. Darstellen Vertiefung Die Lehrende liest die Fabel zu Ende und stellt die Fragen: Plenum LehrerWelche Folgen hatte das Verhalten der Ziegen? Warum fällt Schüler- Gespräch es den beiden schwer, eine friedliche Lösung zu finden? Mögliche Schüleräußerungen: Die beiden stürzen ins Wasser statt nachzugeben. Der Streit bringt nur Nachteile mit sich. Die Ziegen wären unversehrt und auch schneller ans Ufer gekommen, wenn eine der beiden nachgegeben hätte. Weil sie starrköpfig und unnachgiebig sind. Sie sind uneinsichtig und egoistisch. Reflexion Die Lehrperson stellt die Frage: Wart ihr schon einmal in Plenum Lehrer- Arbeitsblatt mit der Fabel (vgl.Anlage 2) Arbeitsblatt mit der Fabel (vgl.Anlage 2) Ideenbox (vgl. Anlage 3) Bank aus der Sporthalle, Pfeife, zwei Glöckchen, CD, CD-Player Arbeitsblatt mit der Fabel einer ähnlichen Situation? Die Lernenden erzählen über ihre eigenen Erfahrungen. ca. 3 Min. Schüler- Gespräch Hausaufgabe Die Lerngruppe schreibt eine Parallelgeschichte Arbeitsblatt, Deutschmappe 6. Quellen- und Literaturverzeichnis Beschlüsse der Kultusministerkonferenz: Bildungsstandards im Fach Deutsch für den Realschulabschluss, Beschluss vom 15.10.2004. Busse, A.; Hintz I. (Hrsg.): Wortstark 6. Themen und Werkstätten für den Deutschunterricht, Hannover 2003. Fenske, U.: Rund um Fabeln. Kopiervorlagen für den Deutschunterricht, Berlin 2009. Hessisches Kultusministerium: Lehrplan Deutsch. Bildungsgang Realschule, Jahrgangsstufen 5 bis 10, Wiesbaden 2002. Kammler, C.; Ulf, A.: Drama-Theater-Szeniszes Spiel, in: Praxis Deutsch. Drama-TheaterSzeniszes Spiel. Sonderheft 2005, S. 3-10. Spinner, K.H. u.a.: Basisartikel: Handlungs- und produktionsorientierter Literaturunterricht. in: Praxis Deutsch 123, Seelze 1994, S.17-25. Spinner, K.: Basisartikel: Literarisches Lernen, in: Praxis Deutsch 200, Seelze 2006, S.6-16. Spinner, K.: Kreativer Deutschunterricht, Seelze-Velber 2008. Wilkening, N.: Märchen, Fabeln, Sagen. Kreative Textarbeit mit alten Stoffen, Mülheim an der Ruhr 2006. 7. Anhang Anlage 1 Anlage 2 Jean de La Fontaine Von zwei starrköpfigen Ziegen I.Aufgabe Lest die Fabel Von zwei starrköpfigen Ziegen mit verteilten Rollen vor. Bringt durch Lautstärke, Tonnfall und Sprechtempo die Stimmung zum Ausdruck. Erzähler erste Ziege zweite Ziege Zwei Ziegen kehrten von der Weide nach Hause zurück. Frohgemut ging eine jede ihres Weges, denn beide hatten sich gut gesättigt. Sie begegneten einander beim Bach auf einem schmalen Steg, unter dem eiskaltes Wasser murmelnd dahinströmte. Jetzt standen sie einander gegenüber, so dicht, dass sie ihren Atem spürten. „Ich weiche nicht aus, dachte die erste Ziege bei sich und stampfte zornig mit ihren harten Hufen. Die zweite Ziege war um nichts vernünftiger. „Geh mir aus dem Weg, meckerte sie eigensinnig. „Warum sollte ich dir aus dem Weg gehen? sagte die erste Ziege und sah finster drein, dass man Angst vor ihr bekommen konnte. „Weiche du aus! Die zweite Ziege ließ sich nicht bange machen. „Ich weiche nicht aus! Das könnte ein jeder sagen. „Wirst du aus dem Weg gehen oder nicht? ärgerte sich die erste Ziege. „Nee-ee, nee-ee! meckerte starrköpfig die zweite Ziege. „Wir werden sehen, wer stärker ist, gebärdete sich die erste Ziege drohend, stemmte sich gegen die Balken und stand fest und regungslos da. II.Zusatzaufgabe Überlegt in der Gruppe, wie könnte die Geschichte weiter gehen? III.Aufgabe Spielt die Fabel nach und findet eine Lösung für den Konflikt! Bereitet mündlich einen Dialog zwischen den beiden Ziegen und dem Schiedsrichter vor. Entscheidet, wer die Rollen der beiden Ziegen und des Schiedsrichters übernimmt. Rückseite: Zwei Paar Hörner schlugen heftig aufeinander, stießen blindlings aufeinander ein. Das konnte natürlich nicht gut ausgehen. Starrköpfigkeit und Eigensinn hatten beide geblendet. Da wankten auch schon die bockbeinigen Ziegen, taumelten plötzlich, verloren das Gleichgewicht, und bums, perdauz! Plumpsten sie in das eiskalte Wasser. Dort kühlten sie ihren Zorn, nachdem sie ordentlich gebadet und viel Wasser geschluckt hatten. Aber vom Wasser war noch so viel übriggeblieben, dass sie darin auch ihre Starrköpfigkeit ertränken konnten. Hausaufgabe Sicher hast du auch schon einmal solch starrköpfige Mitmenschen erlebt. Schreibe eine entsprechende Geschichte: Finden die Menschen eine Möglichkeit, sich zu verständigen? Anlage 3 Ideenbox „Geh mir aus dem Weg! „Lass mich sofort durch! Ich habe es eilig! „Ich will nicht! Ich habe hier so viel Recht wie du! „Na und?! Ich bin aber älter als du! „Ich war zuerst auf der Brücke! Geh du zurück! „Das ist mir doch egal! „Ich bin viel stärker als du! „Wir werden ja gleich sehen, wer hier der Stärkere ist! „Du hast mir gar nichts zu sagen! „Mich interessiert nicht, was du sagst! „Ich werde ganz bestimmt nicht nachgeben! „Ich bekomme immer meinen Willen! „Ich werde es dir zeigen! „Wenn du mir nicht aus dem Weg gehst, dann bekommst du meine Hörner zu spüren! „Ich bewege mich keinen Zentimeter zurück! „Mach mir Platz!