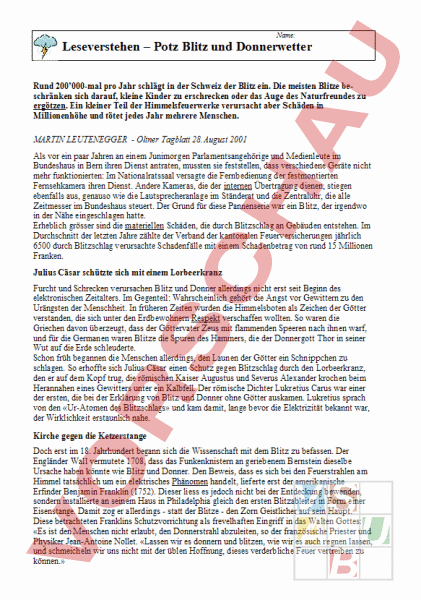Arbeitsblatt: Leseverstehen Blitze
Material-Details
Potz Blitz und Donnerwetter
Zeitungsartikel mit Leseverstehen
Lebenskunde
Berufswahl
5. Schuljahr
3 Seiten
Statistik
6204
1794
105
28.08.2007
Autor/in
Patrick Berger
Seidenhofweg 60
4600 Olten
4600 Olten
062 212 54 64
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Name: Leseverstehen – Potz Blitz und Donnerwetter Rund 200000-mal pro Jahr schlägt in der Schweiz der Blitz ein. Die meisten Blitze beschränken sich darauf, kleine Kinder zu erschrecken oder das Auge des Naturfreundes zu ergötzen. Ein kleiner Teil der Himmelsfeuerwerke verursacht aber Schäden in Millionenhöhe und tötet jedes Jahr mehrere Menschen. MARTIN LEUTENEGGER Oltner Tagblatt 28.August 2001 Als vor ein paar Jahren an einem Junimorgen Parlamentsangehörige und Medienleute im Bundeshaus in Bern ihren Dienst antraten, mussten sie feststellen, dass verschiedene Geräte nicht mehr funktionierten: Im Nationalratssaal versagte die Fernbedienung der festmontierten Fernsehkamera ihren Dienst. Andere Kameras, die der internen Übertragung dienen, stiegen ebenfalls aus, genauso wie die Lautsprecheranlage im Ständerat und die Zentraluhr, die alle Zeitmesser im Bundeshaus steuert. Der Grund für diese Pannenserie war ein Blitz, der irgendwo in der Nähe eingeschlagen hatte. Erheblich grösser sind die materiellen Schäden, die durch Blitzschlag an Gebäuden entstehen. Im Durchschnitt der letzten Jahre zählte der Verband der kantonalen Feuerversicherungen jährlich 6500 durch Blitzschlag verursachte Schadenfälle mit einem Schadenbetrag von rund 15 Millionen Franken. Julius Cäsar schützte sich mit einem Lorbeerkranz Furcht und Schrecken verursachen Blitz und Donner allerdings nicht erst seit Beginn des elektronischen Zeitalters. Im Gegenteil: Wahrscheinlich gehört die Angst vor Gewittern zu den Urängsten der Menschheit. In früheren Zeiten wurden die Himmelsboten als Zeichen der Götter verstanden, die sich unter den Erdbewohnern Respekt verschaffen wollten. So waren die Griechen davon überzeugt, dass der Göttervater Zeus mit flammenden Speeren nach ihnen warf, und für die Germanen waren Blitze die Spuren des Hammers, die der Donnergott Thor in seiner Wut auf die Erde schleuderte. Schon früh begannen die Menschen allerdings, den Launen der Götter ein Schnippchen zu schlagen. So erhoffte sich Julius Cäsar einen Schutz gegen Blitzschlag durch den Lorbeerkranz, den er auf dem Kopf trug, die römischen Kaiser Augustus und Severus Alexander krochen beim Herannahen eines Gewitters unter ein Kalbfell. Der römische Dichter Lukretius Carus war einer der ersten, die bei der Erklärung von Blitz und Donner ohne Götter auskamen. Lukretius sprach von den «Ur-Atomen des Blitzschlags» und kam damit, lange bevor die Elektrizität bekannt war, der Wirklichkeit erstaunlich nahe. Kirche gegen die Ketzerstange Doch erst im 18. Jahrhundert begann sich die Wissenschaft mit dem Blitz zu befassen. Der Engländer Wall vermutete 1708, dass das Funkenknistern an geriebenem Bernstein dieselbe Ursache haben könnte wie Blitz und Donner. Den Beweis, dass es sich bei den Feuerstrahlen am Himmel tatsächlich um ein elektrisches Phänomen handelt, lieferte erst der amerikanische Erfinder Benjamin Franklin (1752). Dieser liess es jedoch nicht bei der Entdeckung bewenden, sondern installierte an seinem Haus in Philadelphia gleich den ersten Blitzableiter in Form einer Eisenstange. Damit zog er allerdings statt der Blitze den Zorn Geistlicher auf sein Haupt. Diese betrachteten Franklins Schutzvorrichtung als frevelhaften Eingriff in das Walten Gottes: «Es ist den Menschen nicht erlaubt, den Donnerstrahl abzuleiten, so der französische Priester und Physiker Jean-Antoine Nollet. «Lassen wir es donnern und blitzen, wie wir es auch regnen lassen, und schmeicheln wir uns nicht mit der üblen Hoffnung, dieses verderbliche Feuer vertreiben zu können.» Doch die «Ketzerstange» setzte sich bald durch, weil so der Wissenschaftsjournalist Erwin Lausch «gerade die hoch über ihre Umgebung hinausragenden Kirchtürme häufig vom Blitz getroffen wurden.» Tausendfache Leistung eines grossen Kraftwerks In den letzten 250 Jahren hat die Blitzforschung grosse Fortschritte gemacht, doch der Respekt vor Blitz und Donner ist geblieben. Sogar unter den Wissenschaftern, denn was sie über den Blitz herausfanden, war schier unglaublich: Blitze führen Ströme von 10000 bis 300000 Ampere mit sich (zum Vergleich der Strom einer Glühlampe: einige Zehntel Ampere). Die Spannung kann 100 Millionen Volt weit übersteigen (gängige Spannung für Haushaltstrom: 110 bis 220 Volt). Ein starker Blitz wird bis zu 30000 Grad heiss, das heisst fünfmal heisser als die Oberfläche der Sonne; während einiger Millisekunden setzt er eine Leistung von 1000 Gigawatt in Wärme um, was der tausendfachen Leistung eines grossen Atomkraftwerks entspricht. Auch das furchtbarste Gewitter beginnt jedoch ganz harmlos mit einer Schönwetterwolke. Steigt diese unter dem Einfluss der Sonneneinstrahlung – und damit der Lufterwärmung -höher, gefrieren die feinen Wassertröpfchen in der Wolke zu Eiskristallen. Auf- und abwärts stürzende Winde innerhalb der Wolke erzeugen gewissermassen durch Reibung positive und negative Ladungen; die positiven Ladungen konzentrieren sich meist im oberen und unteren Teil der Wolke, wogegen die mittleren Schichten negativ aufgeladen sind. Die dadurch entstehende elektrische Spannung löst einen Blitz aus, wobei die meisten Blitze die Wolke nicht verlassen. Nur jeder vierte oder fünfte Blitz erreicht die Erde. Noch immer warten in der Forschung viele Fragen auf eine Erklärung. Gut belegt ist allerdings die Wirkung des Blitzes auf den Menschen. «Wie vom Blitz getroffen» Es gibt Redewendungen, die sich über Jahrzehnte oder Jahrhunderte erhalten, obwohl sie jeder Logik widersprechen. Eine davon ist, jemand habe reagiert «wie vom Blitz getroffen». Wenn ein Mensch das Unglück hat, dass ein Blitz direkt in ihn einschlägt, so Professor Speiser, «dann ist er mit Sicherheit tot». In der Schweiz sterben pro Jahr 5 bis 10 Personen an den direkten oder indirekten Folgen eines Blitzschlags. Sehr viel mehr Menschen werden durch Blitze verletzt, wobei die Verletzungen, je nach Art der Einwirkung, sehr unterschiedlicher Art sein können. Der schlagartig erzeugte Druck, der bei einem Blitzschlag entsteht -und der auch für die akustische Erscheinung des Donners verantwortlich ist wirkt sich in der Nähe des Einschlagpunkts als enorme Schockwelle aus, wie sie auch bei einem Bombenattentat oder einer Sprengstoffexplosion entsteht Menschen, die dieser Welle ausgesetzt sind, können schwere Verletzungen der inneren Organe oder innere Blutungen erleiden. Häufig sterben Menschen in einer solchen Situation wegen einer Lähmung des Atemzentrums oder durch Herzstillstand. An einem internationalen Kongress der «Keraunopathologen» im französischen Chamonix (Keraunos, griech. Blitz) wurde darauf hingewiesen, dass viele Todesfälle durch Blitzschlag verhindert werden könnten, wenn die eintreffenden Helfer die richtigen Massnahmen ergreifen würden: eine Herzmassage oder eine Mund-zu-Nase-Beatmung. Festgestellt werden häufig auch Verbrennungen als Folge der grossen Hitze. Wer etwas weiter vom Einschlag entfernt ist, kann durch die Schockwelle umgeworfen werden, was Sturzverletzungen zur Folge haben kann. Auto und Flugzeug bieten guten Schutz Erheblich bessere Chance hat, wer sich schon beim Herannahen eines Gewitters schützt. Grundsätzlich bevorzugt ein Blitz meist die höchsten Punkte in der Umgebung: Kirchtürme, Schornsteine, Masten oder freistehende Bäume. Lebensgefährlich ist es deshalb, sich vor dem Gewitterregen unter das Blätterdach eines einzelnen Baumes zu stellen. Wer sich im Wald befindet, sollte den Schutz junger Bäume suchen. Bildet der Mensch selber den höchsten Punkt, indem er sich auf freiem Feld oder auf dem Wasser befindet, ist er ebenfalls sehr gefährdet. Wer sein Leben nicht aufs Spiel setzen will, sollte niemals während eines Gewitters baden. Auf freiem Feld besteht der beste Schutz darin, dass eine Bodenvertiefung aufgesucht wird, in der sich der oder die Verirrte zusammenkauert, den Kopf zwischen den Beinen und die Füsse möglichst nahe beieinander. Einen «absoluten Schutz», so Professor Ambros Speiser, «bietet das Auto, das sonst nicht im Ruf steht, ein besonders sicherer Aufenthaltsort zu sein». Ins Innere der Metallkarosserie kann kein elektrisches Feld eindringen; dies bedingt allerdings, dass die Passagiere eines Autos während des Gewitters keine Metallteile berühren. Ohne Feuchtigkeit und Wärme gibts keinen Blitz Tag für Tag gehen etwa 45000 Gewitter mit fünf bis acht Millionen Blitzen auf die Erde nieder. Die Häufigkeit ist dabei deutlich abhängig von der geografischen Breite: Das Maximum liegt mit rund 160 Gewittertagen pro Jahr in tropischen Regionen. In den Alpen werden etwas mehr als 30 Gewittertage verzeichnet, im nördlichen Mitteleuropa weniger als 15 Tage. Im Polargebiet und in der Wüste sind Gewitter so gut wie unbekannt. Der Grund liegt darin, dass es für ein Gewitter immer Wärme und Feuchtigkeit braucht. Wo keine von der Sonne erwärmte feuchte Luft aufsteigt, können sich auch keine Gewitterwolken bilden: In Polargebieten ist es nicht warm und in Wüsten nicht feucht. In tropischen Gebieten hingegen, wo es warm und feucht zugleich ist, blitzt und donnert es durchschnittlich fast jeden zweiten Tag. Auftrag: Löse die folgenden Fragen auf einem Beiblatt. Setze den Titel ‚Leseverstehen-Potz Blitz und Donnerwetter. Nummeriere deine Antworten und schreibe mit Füller. Antworte mit ganzen Sätzen. Fragen: 1. Welche Geräte funktionierten nach einem Blitzeinschlag im Bundeshaus in Bern nicht mehr? 2. Was dachten die alten Griechen über die Blitze? 3. Was dachten die alten Germanen über die Blitze? 4. Womit schützten sich römische Kaiser vor Blitzen? 5. Was wurde als erster Blitzableiter verwendet? 6. Weshalb setzte sich der Blitzableiter durch? 7. Wie entsteht ein Gewitter? 8. Woher kommt der Donner? 9. Wie kann man Leute retten, die vom Blitz getroffen wurden? 10. Wo sollte man sich während eines Gewitters niemals aufhalten? 11. Weshalb gibt es an den Polen und in Wüsten keine Gewitter? Suche zu folgenden Wörtern ein Synonym ( ein gleichbedeutendes Wort). Schau, wenn nötig, im Duden nach. 1. ergötzen 5. Phänomen 2. intern 6. Situation 3. materiell 7. Schornstein 4. Respekt 8. Bodenvertiefung