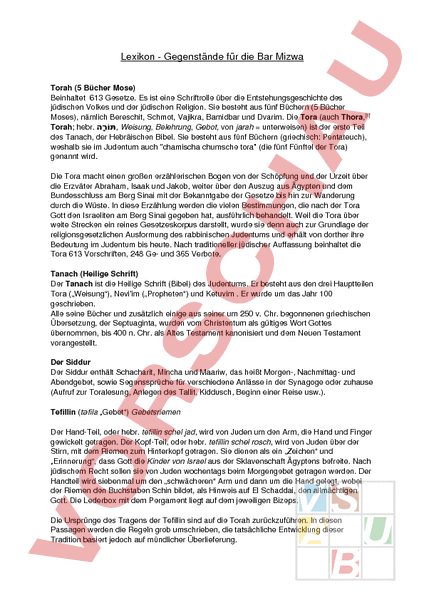Arbeitsblatt: Bar Mizwa
Material-Details
Ein Lexikon mit dem Beschreib aller wichtigen Gegenstände
Lebenskunde
Religionslehre / Bibel
klassenübergreifend
3 Seiten
Statistik
62131
1033
1
06.06.2010
Autor/in
Atzi (Spitzname)
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Lexikon Gegenstände für die Bar Mizwa Torah (5 Bücher Mose) Beinhaltet 613 Gesetze. Es ist eine Schriftrolle über die Entstehungsgeschichte des jüdischen Volkes und der jüdischen Religion. Sie besteht aus fünf Büchern (5 Bücher Moses), nämlich Bereschit, Schmot, Vajikra, Bamidbar und Dvarim. Die Tora (auch Thora,[1] Torah; hebr. , Weisung, Belehrung, Gebot, von jarah unterweisen) ist der erste Teil des Tanach, der Hebräischen Bibel. Sie besteht aus fünf Büchern (griechisch: Pentateuch), weshalb sie im Judentum auch chamischa chumsche tora (die fünf Fünftel der Tora) genannt wird. Die Tora macht einen großen erzählerischen Bogen von der Schöpfung und der Urzeit über die Erzväter Abraham, Isaak und Jakob, weiter über den Auszug aus Ägypten und dem Bundesschluss am Berg Sinai mit der Bekanntgabe der Gesetze bis hin zur Wanderung durch die Wüste. In diese Erzählung werden die vielen Bestimmungen, die nach der Tora Gott den Israeliten am Berg Sinai gegeben hat, ausführlich behandelt. Weil die Tora über weite Strecken ein reines Gesetzeskorpus darstellt, wurde sie denn auch zur Grundlage der religionsgesetzlichen Ausformung des rabbinischen Judentums und erhält von dorther ihre Bedeutung im Judentum bis heute. Nach traditioneller jüdischer Auffassung beinhaltet die Tora 613 Vorschriften, 248 Ge und 365 Verbote. Tanach (Heilige Schrift) Der Tanach ist die Heilige Schrift (Bibel) des Judentums. Er besteht aus den drei Hauptteilen Tora („Weisung), Neviim („Propheten) und Ketuvim Er wurde um das Jahr 100 geschrieben. Alle seine Bücher und zusätzlich einige aus seiner um 250 v. Chr. begonnenen griechischen Übersetzung, der Septuaginta, wurden vom Christentum als gültiges Wort Gottes übernommen, bis 400 n. Chr. als Altes Testament kanonisiert und dem Neuen Testament vorangestellt. Der Siddur Der Siddur enthält Schacharit, Mincha und Maariw, das heißt Morgen, Nachmittag und Abendgebet, sowie Segenssprüche für verschiedene Anlässe in der Synagoge oder zuhause (Aufruf zur Toralesung, Anlegen des Tallit, Kiddusch, Beginn einer Reise usw.). Tefillin (təfila „Gebet) Gebetsriemen Der HandTeil, oder hebr. tefillin schel jad, wird von Juden um den Arm, die Hand und Finger gewickelt getragen. Der KopfTeil, oder hebr. tefillin schel rosch, wird von Juden über der Stirn, mit dem Riemen zum Hinterkopf getragen. Sie dienen als ein „Zeichen und „Erinnerung, dass Gott die Kinder von Israel aus der Sklavenschaft Ägyptens befreite. Nach jüdischem Recht sollen sie von Juden wochentags beim Morgengebet getragen werden. Der Handteil wird siebenmal um den „schwächeren Arm und dann um die Hand gelegt, wobei der Riemen den Buchstaben Schin bildet, als Hinweis auf El Schaddai, den allmächtigen Gott. Die Lederbox mit dem Pergament liegt auf dem jeweiligen Bizeps. Die Ursprünge des Tragens der Tefillin sind auf die Torah zurückzuführen. In diesen Passagen werden die Regeln grob umschrieben, die tatsächliche Entwicklung dieser Tradition basiert jedoch auf mündlicher Überlieferung. Dass die Tefillin für den Kopf auf die Stirn gesetzt werden, um die geistige Verbindung der Seele mit dem Schöpfer zu symbolisieren. Das Umwickeln der jeweils passiven Hand (die Linke bei Rechtshändern) steht für die Seite des Egos und des Egoismus, die durch die Tefillin gefesselt werden sollen, damit die gute, rechte Seite zum Schöpfer aufsteigen kann. Kippa Die Kippa signalisiert Gottesfurcht und Bescheidenheit vor Gott. Im Laufe der Zeit ist die Kippa zu einem Erkennungszeichen des Juden geworden, welche die Erfüllung aller Pflichten auf sich genommen hat. Im alten Israel war die Kopfbedeckung für Männer kein religiöses Erfordernis, nur bei besonderen Anlässen üblich; bei Frauen hingegen der hauptverhüllende Schleier, da entblößtes Haupthaar Prostituierten vorbehalten war. Erst in der Neuzeit (16./17. Jahrhundert) verbreitete sich das Tragen der Kippa beim jüdischen Mann. Der Brauch wird örtlich verschieden gehandhabt. Eine Rolle spielt auch, welcher Strömung des Judentums der Gläubige angehört. Nichtjüdischen Fremden und Gästen wird stets empfohlen, sich einfach dem Brauch der Gemeinde anzupassen, bei der sie zu Gast sind. In jüdischen liberalen Gemeinden tragen Frauen als Zeichen für Unabhängigkeit und Emanzipation teilweise eine Kippa.Form und Farbe der Kippa geben zuweilen Auskunft über den religiösen, politischen und auch parteipolitischen Hintergrund ihres Trägers. Nicht zu verwechseln ist die Kippa mit dem Pileolus, dem Käppchen, das katholische Bischöfe im Alltag, aber auch während der Messzeremonie, tragen. Tallit In der Neuzeit wird der Tallit von erwachsenen Juden (ab 13) nur beim Morgengebet getragen. Dies gilt sowohl für Gebete in der Synagoge als auch für das private Gebet. Nach einigen aschkenasischen Traditionen tragen nur verheiratete Männer und ein Bräutigam einen Tallit. Dieser ist Teil der Gaben, welche die Braut ihrem Bräutigam übergibt. Ein gläubiger Jude wird auch in seinem Tallit bestattet. Eine der Zizijot wird vorher entfernt als Zeichen dafür, dass ein Toter keine Gebote (Mitzwot) mehr zu erfüllen braucht.Im liberalen Judentum tragen auch Frauen, die es wünschen, einen Tallit. Inzwischen gibt es Tallitot in vielen Farben und Designs, oft z. B. mit typischen jüdischen Motiven. Entscheidend für die halachische Tauglichkeit eines Tallit ist nicht das Aussehen, sondern allein die Zizijot. Ein jüdischer Junge trägt zum ersten Mal einen Tallit dreizehnjährig bei seiner Bar Mitzwa. In liberalen Gemeinden trägt auch ein Mädchen einen Tallit bei ihrer Bat Mizwa. Der jüdische Kalender ist ein Lunisolarkalender. Die Monate sind wie bei einfachen Mondkalendern an den Mondphasen ausgerichtet, es existiert jedoch gleichzeitig eine Schaltregel zur Angleichung an das Sonnenjahr. Um einen Ausgleich zu dem um 11 Tage längeren Sonnenjahr zu schaffen (im Unterschied zum Islam, dessen Feste aufgrund des reinen Mondkalenders manchmal in den Sommer und manchmal in den Winter fallen), wird in einem Zyklus von 19 Jahren sieben mal ein Schaltmonat (Adar II.) hinzugefügt: In jedem 3., 6., 8., 11., 14., 17. und 19. Jahr.[1] Der jüdische Kalender zählt die Jahre ab dem Zeitpunkt der biblischen Schöpfung der Welt[2], die Hillel II. nach den biblischen Chroniken auf das Jahr 3761 v.Chr. errechnete. Dadurch befindet sich der jüdische Kalender bereits im sechsten Jahrtausend. Religiöse Führung Jüdische Gemeinden werden geistlich und rechtlich von einem Rabbiner geleitet. Die Gottesdienste werden im Allgemeinen von einem Kantor oder allgemeiner gesagt von einem Vorbeter geleitet; zu ihrer Durchführung wird ein Quorum bzw. (hebräisch) Minjan benötigt. Unterschiede zu anderen Religionen keine Missionierung Andersgläubiger Auch wird darauf verwiesen, dass ein ganzes, gerade gewordenes Volk, Zeuge Gottes am Berg Sinai war (im Christentum: etwa ein Dutzend, im Islam nur Mohammed. Das Judentum wird aus historischen Gründen häufig zu den Weltreligionen gerechnet, wenngleich ihm nur circa 13,5 Millionen Menschen angehören (Vergleich: Christentum circa 2,3 Milliarden, Islam circa 1,4 Milliarden). monotheistische Religion man wird zum Juden geboren Volk ohne Land Schabbat Der Schabbat ist ein Ruhetag. Am Samstag darf man nicht arbeiten, weil Gott in sechs Tagen die Welt erschaffen hat und am siebten Tag (Samstag) hat Gott geruht. Am Freitag Abend fängt der Schabbat mit dem Sonnenuntergang an, dann zünden die Frauen zwei Kerzen an. Vor dem Essen macht man das Kiduschgebet. Mit dem Kiddusch erinnert man sich daran, wie Gott die Welt erschaffen hat und dass man sechs Tage arbeiten soll und am siebten Tag ruhen, wie es Gtt gemacht hat. Danach wäscht man sich die Hände und schneidet zwei Zöpfe an. Dann isst man ein festliches Essen. Die ganze Familie sitzt gemeinsam am Tisch. Während des Schabbats darf man keine elektrischen Dinge betätigen. Gewisse Gegenstände darf man nicht einmal berühren. Solche Gegenstände sind muktze ( Alles was am Schabbat verboten ist.). Am Tag selber (also am Samstag) geht man schon am Morgen in die Synagoge und betet. Auch am Nachmittag findet nochmals ein Gottesdienst statt. Am Samstagabend verabschiedet sich von dem Schabbat, man macht Hawdalah (Es wird eine geflochtene Kerze angezündet) dazu singt man verschiedene eher traurige Lieder, weil man es schade findet, dass Schabbat schon wieder fertig ist.