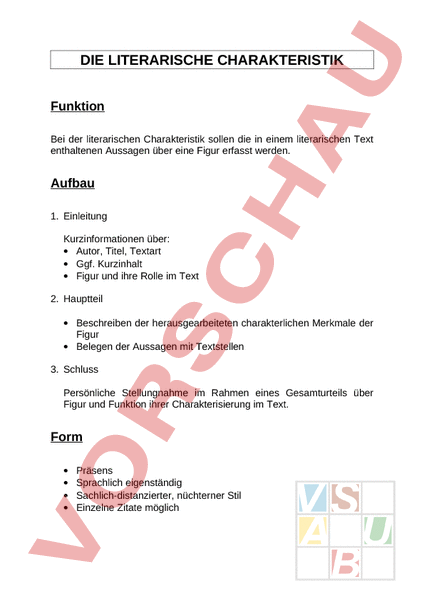Arbeitsblatt: charakteristik
Material-Details
Wie schreibt man eine literarische Charakteristik
Deutsch
Texte schreiben
8. Schuljahr
3 Seiten
Statistik
62923
777
5
19.06.2010
Autor/in
Manuela Röd
Land: andere Länder
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
DIE LITERARISCHE CHARAKTERISTIK Funktion Bei der literarischen Charakteristik sollen die in einem literarischen Text enthaltenen Aussagen über eine Figur erfasst werden. Aufbau 1. Einleitung Kurzinformationen über: • Autor, Titel, Textart • Ggf. Kurzinhalt • Figur und ihre Rolle im Text 2. Hauptteil • Beschreiben der herausgearbeiteten charakterlichen Merkmale der Figur • Belegen der Aussagen mit Textstellen 3. Schluss Persönliche Stellungnahme im Rahmen eines Gesamturteils über Figur und Funktion ihrer Charakterisierung im Text. Form • • • • Präsens Sprachlich eigenständig Sachlich-distanzierter, nüchterner Stil Einzelne Zitate möglich Formen der literarischen Charakteristik 1. Gruppencharakteristik: Es wird eine Gruppe von literarischen Figuren unter dem Aspekt der gemeinsamen charakterlichen Merkmale erfasst. 2. Vergleichende Charakteristik: Es werden verschiedene Einzelfiguren in einem literarischen Text unter dem Aspekt ihrer charakterlichen Merkmale und Eigenarten miteinander verglichen. 3. Typencharakteristik: Es werden bestimmte Figuren oder Figurengruppen als Typen menschlichen Verhaltens betrachtet und im Hinblick auf ihre typischen charakterlichen Merkmale hin analysiert. 4. Einzelcharakteristik: Es werden eine einzelne Figur oder mehrere Einzelfiguren im Hinblick auf ihre charakterlichen Merkmale untersucht. Grundformen der Figurencharakteristik Direktes Charakterisieren Hier wird die Figur vom Erzähler selbst oder anderen Figuren des Textes mit Beschreibungen und Kommentaren charakterisiert. Mittel des direkten Charakterisierens durch den Erzähler: • Beschreibungen: Auf Außensicht basierende Beschreibungen einer Figur; mit oder ohne kommentierende Einmischung. Beispiel: Antonia zog ihre breiten, mit ein wenig zuviel rotem Lippenstift nachgezogenen Lippen in die Höhe, als sie bemerkte wie der hochgewachsene Martin Bach, geradezu betont lässig, auf ihren Tisch zukam. • Beziehungen: Darstellung der Beziehungen einer Figur zu anderen Figuren. Beispiel: Antonias Vater war schon seit zehn Jahren tot. Sie wuchs bei ihrer alleinerziehenden Mutter auf, mit deren wechselnden Lebenspartnern sie nie so warm wurde. • Handlungen: Darstellung von Handlungen einer Figur. Beispiel: Antonia wartete in dem Restaurant auf ihren Freund. Sie bestellte sich einen Kaffee und blickte zur Tür. • Situationen: Einordnung einer Zusammenhang. Figur in einen zeitlichen, räumlichen und kausalen Beispiel: Antonia betrat kurz vor drei Ihr das Restaurant unten am Fluss. Dort wartete sie auf ihren Freund, der sich da mit ihr treffen wollte. Sie bestellte sich einen Kaffee und blickte zur Tür, um ihm schon beim Hereinkommen sein Anliegen von den Augen ablesen zu können. • Redeinhalte: • Gefühlsinhalte: Wiedergabe von Gefühlen, Eindrücken und Wahrnehmungen einer Figur; allerdings keine Wiedergabe von Gedanken. Beispiel: Antonia musste hören, was sie überhaupt nicht erwartet hatte. Er, Martin Bach, wolle überhaupt nichts davon wissen, ihre Beziehung zu beenden. Im Gegenteil, warum ließe sich das Ganze nicht einfach zu einer offenen Dreiecksbeziehung umfunktionieren. Beispiel: Antonia war sauer. Dennoch hörte sie sich bis zu Ende an, was ihr Freund ihr eröffnete. Mittel des direkten Charakterisierens durch die Figuren • Fremdthematisierung: Durch andere Figuren in Form der direkten Rede oder von auf Innensicht beruhender Gedankenwiedergabe einer Figur. Beispiel: Martin Bach ließ es nicht gelten: „Nein, nein, Antonia – du bist nicht spießig. Du bist einfach verklemmt, das ist es! • Selbstthematisierung: Durch die Figur selbst in Form der direkten Rede oder von auf Innensicht beruhender Gedankenwiedergabe einer Figur. Beispiel: Antonia schrie ihn jetzt fast an: „Dann bin ich eben spießig, das ist mir egal, Ich bin eine Frau mit ganz normalen Gefühlen. Da kannst du lange reden. Ein paar Minuten später schon fragte sie sich in Gedanken: „Warum habe ich mich so gehen lassen? Indirektes Charakterisieren Hier charakterisieren sich die Figuren – beabsichtigt oder unbeabsichtigt – durch ihre wörtliche Rede und ihr erzähltes Verhalten. Mittel des indirekten Charakterisierens durch den Erzähler • Kontrast: Durch bestimmte Merkmale von verschiedenen Figuren, die in direktem Gegensatz zueinander stehen. • Korrespondenz: Dadurch, dass bestimmte Merkmale von verschiedenen Figuren gleichartig oder gleichwertig sind. • Namengebung: Durch lautmalende, klassifizierende Begriffe. Beispiel: Der preußisch-pflichtbesessene Amtsvorsteher von Wehrhahn (Gerhart Hauptmanns Komödie „Der Biberpelz) Mittel des indirekten Charakterisierens durch die Figur: • Figuralstil: Durch die Figuren selbst in Form ihrer eigenen charakteristischen Redeweise bei direkter Rede oder auf Innensicht beruhender Gedankenwiedergabe. Beispiel: „Verdammtes Schwein!, rutschte es Antonia heraus, nachdem sie den unglaublichen Vorschlag von Martin gehört hatte. • Beziehungsstil: Durch die Figuren selbst in Form charakteristischer Redeweise anderer Figuren über eine bestimmte Figur in direkter Rede oder auf Innensicht beruhender Gedankenwiedergabe. Man unterscheidet ob dies in Anwesenheit oder Abwesenheit der zu charakterisierenden Figur geschieht. Beispiel: Martin Bach holte tief Luft: „Im Endeffekt willst du das ja doch, nicht wahr. Du kannst nämlich im Endeffekt gar nicht anders. „Im Endeffekt, im Endeffekt . Du kannst mich mal – im Endeffekt. • Thematik: Durch die Figuren selbst, indem sie charakteristischerweise bestimmte Inhalte bei der direkten Rede oder der auf Innensicht beruhenden Gedankenwiedergabe bevorzugen. Beispiel: Martin Bach thematisiert immer die „bürgerliche Verklemmtheit, wenn er seine Sexualität nicht so ausleben kann, wie er es möchte. Arbeitsschritte bei der literarischen Charakteristik W-Fragen zur Stoffsammlung 1. Was erfährt man über die äußere Erscheinung der Figur? • Welches Geschlecht hat sie? • Wie alt ist sie? • Wie seiht sie vom Körperbau her gesehen aus? • Welche Kleidung trägt sie? • Wie reagieren die anderen Figuren auf die äußere Erscheinung der Figur? 2. Was erfährt man über das äußere Verhalten der Figur? • Welchen Kommunikationsstil pflegt die Figur (dominierend, partnerschaftlich .)? • Wie spricht die Figur? • Welche besonderen Redewendungen benutzt sie? • Welche Verhaltensweisen sind besonders ausgeprägt? • Welche Gewohnheiten pflegt die Figur? • Wie reagieren die anderen Figuren auf das äußere Verhalten der Figur? 3. Was erfährt man über die soziale Lage der Figur? • In welchen sozialen Verhältnissen lebt die Figur? • Welcher gesellschaftlichen Schicht gehört die Figur an? • • • • 4. In welchen sozialen Bindungen lebt sie (familiär, Partnerschaft .)? Welchen gesellschaftlichen Einfluss oder Rang besitzt sie? Welche Interessen verfolgt sie? Wie wirkt die soziale Lage der Figur auf die anderen Figuren? Welche psychischen Dispositionen prägen die Figur? • Welche weltanschaulichen Einstellungen sind erkennbar? • Welche Werte und Normen gelten für die Figur? • Wie geht sie mit ihren Gefühlen um? • Welche geistig-intellektuellen Eigenschaften prägen sie? • Welche Wunschvorstellungen und Träumen folgt sie? • Wie geht die Figur mit Konflikten um? Stoffordnung Bei der Stoffordnung werden die im Text gefundenen Aussagen unter geeigneten Oberbegriffen geordnet. Gleichzeitig sollen die Bezüge der Eigenschaften zueinander aufgezeigt werden. Die inhaltlichen Gesichtspunkte, unter denen die bei der Stoffsammlung gefundenen Textstellen geordnet werden müssen, hängen von der geforderten Form der Charakteristik und/oder dem vorgegebenen Aspekt ab, unter dem die Charakterisierung vorgenommen werden soll. Einzelblattmethode: Dabei werden die gewählten Oberbegriffe auf getrennte Seiten geschrieben, auf denen dann die einzelnen Belege aufgeschrieben werden. Mind Mapping: Dabei wird das Thema in die Mitte eines Blattes geschrieben und eingerahmt. Die Hauptgedanken werden in Blockbuchstaben auf fest gezogenen Linien, die mit dem Zentrum verbunden sind, notiert. Weitere Gedanken schreibt man ebenfalls in Blockbuchstaben zum dazu passenden Hauptgedanken. Man verbindet sie später durch „normal gezeichnete Linien mit diesem.