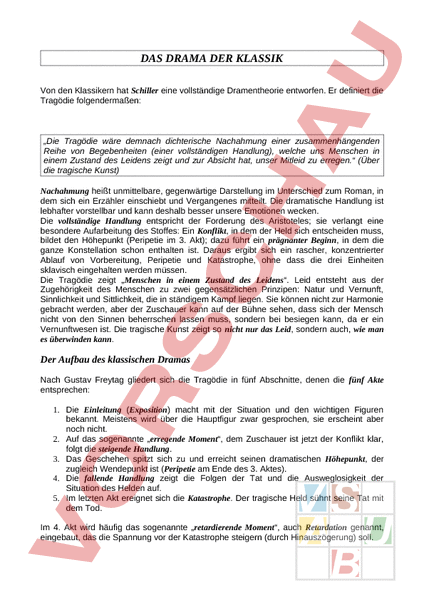Arbeitsblatt: Klassisches Drama
Material-Details
Theorie zum klassischen Drama
Deutsch
Leseförderung / Literatur
8. Schuljahr
2 Seiten
Statistik
62925
893
5
19.06.2010
Autor/in
Manuela Röd
Land: andere Länder
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
DAS DRAMA DER KLASSIK Von den Klassikern hat Schiller eine vollständige Dramentheorie entworfen. Er definiert die Tragödie folgendermaßen: „Die Tragödie wäre demnach dichterische Nachahmung einer zusammenhängenden Reihe von Begebenheiten (einer vollständigen Handlung), welche uns Menschen in einem Zustand des Leidens zeigt und zur Absicht hat, unser Mitleid zu erregen. (Über die tragische Kunst) Nachahmung heißt unmittelbare, gegenwärtige Darstellung im Unterschied zum Roman, in dem sich ein Erzähler einschiebt und Vergangenes mitteilt. Die dramatische Handlung ist lebhafter vorstellbar und kann deshalb besser unsere Emotionen wecken. Die vollständige Handlung entspricht der Forderung des Aristoteles; sie verlangt eine besondere Aufarbeitung des Stoffes: Ein Konflikt, in dem der Held sich entscheiden muss, bildet den Höhepunkt (Peripetie im 3. Akt); dazu führt ein prägnanter Beginn, in dem die ganze Konstellation schon enthalten ist. Daraus ergibt sich ein rascher, konzentrierter Ablauf von Vorbereitung, Peripetie und Katastrophe, ohne dass die drei Einheiten sklavisch eingehalten werden müssen. Die Tragödie zeigt „Menschen in einem Zustand des Leidens. Leid entsteht aus der Zugehörigkeit des Menschen zu zwei gegensätzlichen Prinzipen: Natur und Vernunft, Sinnlichkeit und Sittlichkeit, die in ständigem Kampf liegen. Sie können nicht zur Harmonie gebracht werden, aber der Zuschauer kann auf der Bühne sehen, dass sich der Mensch nicht von den Sinnen beherrschen lassen muss, sondern bei besiegen kann, da er ein Vernunftwesen ist. Die tragische Kunst zeigt so nicht nur das Leid, sondern auch, wie man es überwinden kann. Der Aufbau des klassischen Dramas Nach Gustav Freytag gliedert sich die Tragödie in fünf Abschnitte, denen die fünf Akte entsprechen: 1. Die Einleitung (Exposition) macht mit der Situation und den wichtigen Figuren bekannt. Meistens wird über die Hauptfigur zwar gesprochen, sie erscheint aber noch nicht. 2. Auf das sogenannte „erregende Moment, dem Zuschauer ist jetzt der Konflikt klar, folgt die steigende Handlung. 3. Das Geschehen spitzt sich zu und erreicht seinen dramatischen Höhepunkt, der zugleich Wendepunkt ist (Peripetie am Ende des 3. Aktes). 4. Die fallende Handlung zeigt die Folgen der Tat und die Ausweglosigkeit der Situation des Helden auf. 5. Im letzten Akt ereignet sich die Katastrophe. Der tragische Held sühnt seine Tat mit dem Tod. Im 4. Akt wird häufig das sogenannte „retardierende Moment, auch Retardation genannt, eingebaut, das die Spannung vor der Katastrophe steigern (durch Hinauszögerung) soll.