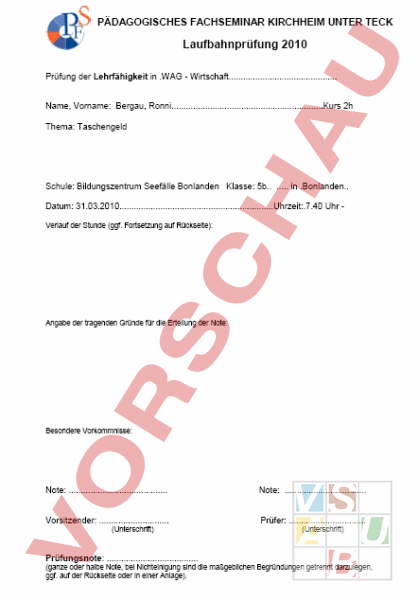Arbeitsblatt: Taschengeld
Material-Details
Unterrichtsentwurf Taschengeld
Lebenskunde
Anderes Thema
5. Schuljahr
10 Seiten
Statistik
63311
1019
3
28.06.2010
Autor/in
Ronnie Bergau
Land: Deutschland
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
PÄDAGOGISCHES FACHSEMINAR KIRCHHEIM UNTER TECK Laufbahnprüfung 2010 Prüfung der Lehrfähigkeit in .WAG Wirtschaft. Name, Vorname: Bergau, Ronni.Kurs 2h Thema: Taschengeld Schule: Bildungszentrum Seefälle Bonlanden Klasse: 5b . in .Bonlanden Datum: 31.03.2010Uhrzeit:.7.40 Uhr Verlauf der Stunde (ggf. Fortsetzung auf Rückseite): Angabe der tragenden Gründe für die Erteilung der Note: Besondere Vorkommnisse: Note: . Note: Vorsitzender: . Prüfer: (Unterschrift) (Unterschrift) Prüfungsnote: (ganze oder halbe Note, bei Nichteinigung sind die maßgeblichen Begründungen getrennt darzulegen, ggf. auf der Rückseite oder in einer Anlage). Taschengeld Sabine, 8 Jahre Peter, 13 Jahre Gabi, 16 Jahre Carla, 12 Jahre Die Jugendlichen Die Geschwister Peter und Sabine besuchen am Wochenende ihre Freunde Gabi und Carla. Im Zimmer von Carla gibt es folgendes Gespräch: Peter Die hättest du wohl auch gern, aber dir fehlt das Geld. Hey! Du hast ja die neue CD von Lena MeyerLandrut Sabine Sabine Ich bekomme 40 € im Monat Wie viel bekommst du? Die habe ich mir von meinem Taschengeld gekauft. Gabi Gabi Ja ich habe früher auch nicht so viel bekommen. Meine Eltern geben mir jedes Jahr 50 Cent mehr Taschengeld. Jetzt bekomme ich in der Woche schon 4 €. Sabine So viel Geld! Ich bekomme jede Woche 2 €, aber ich lasse mir die CDs von Oma schenken. Carla Gabi Trotzdem finde ich das ungerecht! 40 € hört sich viel an, aber es reicht mir kaum. Mir schenkt Oma bestimmt nichts mehr, wenn sie hört, dass Papa mir in Zukunft 20 € im Monat gibt. Sabine Peter Was glaubt Ihr? Ist es ungerecht, dass Gabi im Monat 40 € Taschengeld bekommt, während Sabine lediglich 2 € Taschengeld in der Woche erhält? Taschengeld Gabi: Gabi bekommt ihr Taschengeld monatlich und zwar 40 €. Davon hat sie schon zum Teil ihren Führerschein bezahlt und besitzt seit den Sommerferien einen Roller mit dem sie jeden Tag in die Stadt zur Schule fährt. Sie gibt monatlich für Benzin 10 € und für Versicherung und Steuer 5 € aus. Den Rest bezahlt Oma gern, weil sie zu ihr jetzt öfter zu Besuch kommt. Oma gibt ihr monatlich noch 10 €, davon muss sie aber die Hälfte sparen, damit sie sich mal etwas Größeres leisten kann. Ihr Monatsabo für das Fitnessstudio kostet sie 10 €. In der Mittagspause isst sie in der Schulkantine für monatlich 10 €. Für ihre Schulsachen, Feste und Drogerieeinkäufe ist sie selbst zuständig. Trage die Beträge die Gabi bekommt und ausgibt in die Tabelle ein: Taschengeld Peter: Peter bekommt seit er letzte Woche mit seinem Vater gesprochen hat monatlich 20 €. Jeden Monat geht er regelmäßig mit seinen Freunden ins Erlebnisbad, der Eintritt kostet dort 6 €. Manchmal fährt er auch mit dem Bus, das kostet 1 €, meistens jedoch mit dem Fahrrad, denn dann kauft er sich dort lieber etwasLeckeres für das gleiche Geld. In der Mittagspause radelt er aber nicht nach Hause sondern kauft sich lieber selbst etwas zu Essen, das kostet ihn jeden Monat 10 €. Zum Glück gibts da noch Oma, die ihm jeden Monat 5 € gibt, davon muss er aber die Hälfte sparen, damit er sich einmal etwas Größeres kaufen kann. Für Geburtstagsgeschenke für seine Freunde und andere Feste ist er nun selbst zuständig. Er hat sich überlegt, dass er dafür jeden Monat 5 € zurücklegt. Trage die Beträge die Peter bekommt und ausgibt in die Tabelle ein: Taschengeld Sabine: Sabine bekommt jede Woche montags 2 € Taschengeld von ihrer Mutter. Jeden Montag geht siegleich zum Supermarkt und kauft sich die neueste Ausgabe der Wochenzeitschrift Mädchen für 1 €. An diesem Tag besucht sie auch immer ihre Oma von der sie regelmäßig 1 € bekommt, allerdings muss sie ihr versprechen immer die Hälfte davon zu sparen, damit sie sich später etwas Größeres leisten kann. Während der Woche kauft sie sich von dem restlichen Geld verschiedene Kleinigkeiten zu Essen und zu Trinken. Donnerstags hat sie nachmittags Schule. Die Mutter gibt ihr dann immer ein Vesper und Obst mit und Sabine kauft immer in der Mittagspause von ihrem Taschengeld etwas zu Trinken für 0,50 €. Trage die Beträge die Sabine bekommt und ausgibt in die Tabelle ein: Ausführlicher Unterrichtsentwurf Thema: Taschengeld NAME: Ronni Bergau FACH: KOMPETENZBEREICH: WAG Wirtschaft Marktgeschehen 1. Inhaltsverzeichnis 1. INHALTSVERZEICHNIS 2 1. SITUATIONSANALYSE FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT. 1.1. Die Schule Fehler! Textmarke nicht definiert. 1.2. Der Unterrichtsraum . Fehler! Textmarke nicht definiert. 1.3. Der Informatikraum: Fehler! Textmarke nicht definiert. 1.4. Das Bild der Klasse. Fehler! Textmarke nicht definiert. 1.4.1. Allgemein .Fehler! Textmarke nicht definiert. 1.4.2. Fokussiert auf einzelne Schüler .Fehler! Textmarke nicht definiert. 1.5. 2. Stand des Unterrichts Fehler! Textmarke nicht definiert. SACHANALYSE 4 2.1. Den Umgang mit Geld lernen Kinder auf zwei Ebenen: . 4 2.2. Gründe, den Kindern Taschengeld zu geben, sind: 4 2.3. Wofür ist das Taschengeld?. 4 2.3.1. Taschengeld ist Geld zur freien Verfügung: 4 2.3.2. Das Taschengeld soll sein für: . 4 2.3.3. Beachten sollte man folgende Regeln: 5 2.3.4. Wieviel Taschengeld?. 5 3. DIDAKTISCHE ANALYSE5 3.1. Bildungsplanbezug. 5 3.2. Begründung der Themenauswahl der Stunde 6 3.3. Kompetenzbereich . 6 3.3.1. Fachkompetenz 7 3.3.2. Personelle Kompetenz . 7 3.3.3. Methodenkompetenz 7 3.3.4. Soziale Kompetenz . 7 3.4. 4. Abgrenzung des Themas 8 DIDAKTISCHE BEGRÜNDUNG .8 4.1. Gegenwartsbedeutung. 8 4.2. Zukunftsbedeutung 9 4.3. Exemplarische Bedeutung. 9 5. ZIEL DER STUNDE .9 2 5.1. Allgemeine Zielsetzung 9 5.2. Teilziele . 9 5.2.1. Kognitive Lernziele 9 5.2.2. Emotional-affektive Lernziele . 9 5.2.3. Psychomotorische Lernziele 10 5.2.4. Soziale Lernziele. 10 6. METHODISCHE ENTSCHEIDUNGEN 10 6.1. Allgemeine methodische Konzeption 10 6.1.1. Vorüberlegungen für den Einstieg: . 11 6.1.2. Begrüßung und Themenvorstellung: 12 6.1.3. Begegnungsphase: Einsteig /Problemerfassung /Sinneswahrnehmung. 12 6.1.4. Überleitung: 12 6.1.5. Auseinandersetzungsphase Erarbeitung 12 6.1.6. Auswertung: 13 6.1.7. Lernzielkontrolle 13 6.1.8. Transfer/ Puffer 14 6.1.9. Stundenende: 14 7. UNTERRICHTSVERLAUF 15 METHODEN /. 15 MEDIEN 15 8. MATERIAL UND MEDIEN 17 9. LITERATURVERZEICHNIS: 18 10. ERKLÄRUNGFEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT. Anlagen: Folien Taschengeld (8 Seiten) Text Taschengeld (4 Seiten Arbeitsblatt Gründe für mehr Taschengeld Beispielsrechnung Carla (2 Seiten) Schüleraufgaben (9 Seiten) Zusatzaufgaben (6 Seiten) Arbeitsblatt Lernzielkontrolle 3 1. Sachanalyse 1.1. Den Umgang mit Geld lernen Kinder auf zwei Ebenen: 1. Sie identifizieren sich mit der Art, wie in der Familie mit Geld umgegangen wird. 2. Sie erleben, wie ihr persönlicher Geldbedarf, also ihr Taschengeld und sonstige Zuwendungen geregelt werden. Erst ab dem Alter von 6 Jahren bekommen Kinder allmählich klare Vorstellungen vom Geld. Eine regelmäßige Geldsumme, über die sie verfügen können, hilft ihnen den Wert des Geldes kennenzulernen und seine Bedeutung als Tauschmittel zu begreifen. 1.2. Gründe, den Kindern Taschengeld zu geben, sind: lernen, was Geld „wert ist lernen das Geld einzuteilen lernen zu entscheiden: das will ich jetzt, das später, darauf verzichte ich sie fühlen sich ernst genommen sie lernen Geld zu verwalten und damit verantwortlich umzugehen 1.3. Wofür ist das Taschengeld? 1.3.1. Taschengeld ist Geld zur freien Verfügung: Eltern sollten auch scheinbar planlose Ausgaben ihrer Kinder akzeptieren. Kinder und Jugendliche können nur nachhaltig lernen, indem sie eigene Erfahrungen machen dürfen. Wenig Freude am eigenen Geld kommt auf, wenn Vorschriften erfolgen oder ständig Kontrolle ausgeübt wird. 1.3.2. Das Taschengeld soll sein für: Individuelle, besondere Wünsche, z.B. CDs, CD-ROMs, Zeitschriften, Bücher, Videos und diverse Spielsachen; Außergewöhnliche Sport-, Spiel- und Freizeitaktivitäten; Zusätzliche Süßigkeiten und Schleckereien. Verfehlt wäre es das Taschengeld für notwendige Anschaffungen wie Schulsachen, Kleidung, oder Fahrgeld heranzuziehen. Es sollte ebenfalls nicht mit geschenktem und selbst verdientem Geld oder 4 Extrageld für besondere Leistungen verrechnet werden, da sonst die Basis verloren geht, auf der Kinder und Jugendliche verlässlich planen können. 1.3.3. Beachten sollte man folgende Regeln: Regelmäßige Auszahlung, sonst können die Kinder nicht planen. Bei jüngeren Kindern wöchentlich, bei älteren Kindern monatlich auszahlen. Freie Verfügbarkeit ihres Geldes Die Konsequenzen müssen getragen werden: „Mama ich hab mein ganzes Geld für Eis ausgegeben. Aber ich will doch noch . Taschengeld nicht zur Strafe kürzen. Sollte dem Alter entsprechen, also mit der zunehmenden Bereitschaft zur Eigenverantwortung einhergehen. Soll den Familienverhältnissen entsprechen. 1.3.4. Wieviel Taschengeld? Sinnvoll kann es nur sein, unverbindliche Orientierungswerte für die Höhe des Betrages zu nennen, die von einem mittleren Standard ausgehen. In erster Linie soll sich das Taschengeld verhältnismäßig an die wirtschaftliche Situation der Familie anpassen. Eine schlechte finanzielle Lage kann die Begründung dafür liefern, dass die Zahlung unter den Orientierungswerten bleiben muss. Vergleichswerte bringen natürlich auch die Beträge an den Tag, die bei Freunden und Bekannten üblich sind. Ansonsten gib es Tabellen der Jugendämter und Empfehlungen der Banken, nach denen sich Eltern richten können. (Taschengeld.net (Deggendorf) 2. Didaktische Analyse 2.1. Bildungsplanbezug Das Stundenthema ist dem Fächerverbund: Wirtschaft Arbeit Gesundheit zugeordnet. Die Ziele des Fächerverbundes sind wie folgt formuliert: Die sich immer schneller verändernde Wirtschafts-, Arbeits- und Lebenswelt ist von hoher Komplexität geprägt und stellt Heranwachsende vor vielfältige Herausforderungen. Dies birgt Risiken, bietet aber auch Chancen. Um sich in dieser Situation zu Recht zu finden, sind offene und flexible Betrachtungs-, Bewertungs- und Handlungsweisen erforderlich. Der Fächerverbund Wirtschaft – Arbeit – Gesundheit greift Aufgaben- und Problemstellungen aus dem , privaten . Lebensbereich auf. Durch eine wirtschaftliche.Bildung erwerben die Schülerinnen und Schüler die notwendigen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Alltagsbewältigung und zur verantwortungsbewussten Lebensgestaltung. Die Bereitschaft, die Herausforderungen in diesen genannten 5 Lebensbereichen zu bewältigen und die Fähigkeit, alltägliche Problemstellungen und Konfliktsituationen zu lösen, tragen wesentlich zum Erwerb von Handlungsfähigkeit . bei. . Ausgehend von den Anforderungen der gegenwärtigen und zukünftigen Lebenswirklichkeit Heranwachsender erfolgt der unterrichtliche Zugang bei entsprechend komplexen Problemstellungen mehrperspektivisch. Um tragfähige Orientierungen zu bieten ist es notwendig, dass sich fachspezifische Zugangsweisen ergänzen, sich gegenseitig stützen und zu ganzheitlichen Betrachtungsweisen führen. Dabei müssen Aspekte der Gesundheitserziehung, Familienerziehung, Verbrauchererziehung, Medienerziehung und Berufsorientierung in angemessener Weise berücksichtigt werden. (Ministerium für Kultus)) 2.2. Begründung der Themenauswahl der Stunde Bereits in einer vorhergehenden Stunde wurde mit den Schülern über das Thema Geld gesprochen. Sie lernten, wie das Geld als Währung den Tausch von Waren und Dienstleistungen ablöste. In dieser Stunde soll nun die Frage der gerechten Taschengeldhöhe, also deren Bedingungen im Mittelpunkt stehen. Diese Frage scheint mir für diese Altersstufe deshalb wichtig, weil die Schüler in der nun als Jugendliche beginnenden Auseinandersetzung mit familiären und gesellschaftlichen Normen und Werten zunehmend eigene Lebensentwürfe, Urteile und Überzeugungen anstreben und dabei auch zu wertorientiertem, verantwortungsbewusstem und reflektiertem Verhalten angeregt werden sollen. Deshalb sollen sie sich mit überzogenen Ansprüchen auseinandersetzen, über verantwortungsbewusstes Verhalten und Meinungen reflektieren können und Kriterien für eine Bewertung von Zusammenhängen aufstellen. Dabei scheint es mir sinnvoll die Schüler provokativ zunächst vor die Frage „gerechte Taschengeldhöhe? zu stellen und sie zu Stellungnahmen zu ermuntern. Mit ausgewählten, repräsentativen Fallbeispielen überprüfen die Schüler die Vermutungen und strukturieren die Fakten um sie anschließend zu vergleichen. Dies soll eine erweiterte Betrachtung und das Erkennen von Zusammenhängen ermöglichen. Damit die Schüler zu einer abschließenden Bewertung bzw. Beantwortung der Ausgangsfrage kommen können, ist es sinnvoll die gewonnen Erkenntnisse zu sichern und dadurch zu verinnerlichen. 2.3. Kompetenzbereich Der Kompetenzbereich entsprechend dem Bildungsplan ist „Marktgeschehen Der Bildungsplan sagt hierzu folgendes: „Diese dienen zur Orientierung in der unmittelbaren Lebenswelt und sind Grundlage, um individuelle, berufs- und gemeinschaftsbezogene Entscheidungen treffen zu können und an Werten orientiert sinnvoll zu handeln. (Ministerium für Kultus) 6 2.3.1. Fachkompetenz Konkret werden dem Stundenthema folgende Kompetenzen aus dem Bildungsplan zugeordnet: Die Schülerinnen und Schüler können: Produkte und technische Neuerungen im Hinblick auf eigene Kaufentscheidungen begründet bewerten verbraucherbewusst einkaufen 2.3.2. Personelle Kompetenz Die Schüler • schätzen sich selbst wert. • nehmen ihre eigene Gefühle und Bedürfnisse, Grenzen, Potenziale, Stärken und Schwächen wahr. • können sich selbst motivieren, freiwilliges Engagement zeigen und aktiv mitgestalten. • können gewohntes Denken und Verhalten hinterfragen. 2.3.3. Methodenkompetenz Die Schüler: • sind aufgeschlossen gegenüber neuen Methoden, Fakten, können sich konzentrieren und können neu erworbenes Wissen in Handeln und Kommunikation widerspiegeln. • wiederholen keine Fehler, auch nicht die der Mitschüler. • berücksichtigen bei Planung /Durchführung von Aufgaben den Zeitrahmen, • können beteiligte Personen einschätzen, und vorhandene Hilfsmittel realistisch bewerten. • können Probleme erfassen und Ursachen methodisch analysieren, sowie praktikable Lösungsvorschläge entwickeln. • können Medien sachdienlich nutzen. 2.3.4. Soziale Kompetenz Die Schüler: • können sich in andere Menschen und neue Situationen hineinversetzen, Bedürfnisse anderer wahrnehmen und angemessen reagieren, • haben Respekt vor anderen Personen und zeigen Verständnis für andere Einstellungen. • können verständlich reden, sich ausdrücken, aktiv zuhören, Rückmeldungen geben und Fragen stellen. 7 • können gemeinsam mit anderen Aufgaben erfüllen, auf andere eingehen, sich selbst zurücknehmen, eigene Fähigkeiten konstruktiv einbringen. • eigene Vorurteile erkennen und abbauen, und Verschiedenartigkeit akzeptieren. 2.4. Abgrenzung des Themas In dieser Stunde geht es um das Thema Taschengeld, bzw. die gerechte Höhe. Es geht in dieser Stunde allenfalls noch Argumentationshilfen für Gespräche, z. B. mit den Eltern zu finden. In dieser Stunde geht es nicht um die Rechts- und Geschäftsfähigkeit von Schülerinnen und Schülern. Es geht hier auch nicht darum, unter welchen Bedingungen die Schüler eigene Verträge und Rechtsgeschäfte (z. B. beim Einkaufen) abschließen können und dürfen. Auch das Thema „Schulden oder der Umgang mit dem Taschengeld können nicht Gegenstand dieser Stunde sein. Die heutige Stunde ist aber sehr wohl als Grundlage für die oben genannten Themen zu verstehen, auf welche in folgenden Unterrichtseinheiten zurückgegriffen werden kann. Mögliche Argumentationshilfen im Gespräch mit den Eltern können in dieser Stunde lediglich exemplarisch angesprochen werden. Übungen hierfür könnten in den kommenden Schuljahren im Rahmen des Deutschunterrichts erfolgen. Die Schüler haben mit dem Programm Microsoft Excel zwar erste Erfahrungen gesammelt, sind im Umgang damit jedoch noch sehr unsicher. Die Berechnung der Aufgaben könnte sich deshalb für einige Schüler als schwierig erweisen. Deshalb geht der Lehrer von unterschiedlichen Bearbeitungsgeschwindigkeiten aus. Für die schnelleren Gruppen wird es eine Zusatzaufgabe geben. Hierzu können die Schüler dann auf den erst kürzlich erworbenen Kenntnissen im Umgang mit Microsoft Excel zurückgreifen. Die Berechnungen werden der Klassenstufe entsprechen einfach gehalten. Weitergehende Berechnungen könnten im Matheunterricht wieder aufgegriffen werden. 3. Didaktische Begründung 3.1. Gegenwartsbedeutung Die Schüler setzen sich mit einem Thema auseinander, zu dem sie lebensnah einen aktuellen Bezug im familiären Hintergrund haben. Sie lernen ihren Bezug von Taschengeld realistisch in der Höhe und Angemessenheit zu beurteilen. Darüber hinaus erfahren sie Argumentationshilfen im Gespräch mit ihren Eltern. 8 3.2. Zukunftsbedeutung Ähnlich wie es Gründe gibt, warum die Höhe des Taschengeldes unterschiedlich ist, gibt es während der beruflichen Ausbildung und später im Berufsleben unterschiedliche Eingruppierungen, Löhne und Gehälter. Auch diese erscheinen vielen als ungerecht. Am Thema Taschengeld lernen die Schüler Beurteilungskriterien, welche sie auf das berufliche Leben nach der Schule übertragen können. Die Argumentationshilfen im Gespräch mit den Eltern bieten die Grundlage für spätere Verhandlungen um Gehaltsvorstellungen mit möglichen Arbeitgebern. 3.3. Exemplarische Bedeutung Am Thema Taschengeld wird veranschaulicht, dass für einen direkten Vergleich entsprechende Bezugsgrößen notwendig sind. Exemplarisch wird dargestellt, dass für Verhandlungen Argumente überlegt und überdacht werden müssen, um sie erfolgreich führen zu können. 4. Ziel der Stunde 4.1. Allgemeine Zielsetzung • Die Schüler können Gründe, die zu unterschiedlicher Taschengeldhöhe führen können, erkennen • Die Schüler können Zusammenhänge erkennen und bewerten. • Die Schüler können sich ein Urteil bilden und begründen. 4.2. Teilziele 4.2.1. Kognitive Lernziele Beziehen sich auf die intellektuellen Fähigkeiten des Wahrnehmens und Denkens • Die Schüler können die Zusammenhänge erkennen, warum Jugendliche unterschiedliche Taschengeldbeträge bekommen und diese bewerten. • Die Schüler können sich ein Urteil bilden, ob eine Taschengeldhöhe angemessen ist und können dieses Urteil begründen. • Die Schüler verstehen den Fall auf dem Arbeitsblatt und übertragen die Angaben richtig in die Exceldatei. • Die Schüler lesen das gelenkte Rollenspiel. • Die Schüler verstehen den Inhalt des Rollenspiels. 4.2.2. Emotional-affektive Lernziele Beziehen sich auf Interessenlagen, Bereitschaft und Wertvorstellungen • Den Schülern ist bewusst, dass verschiedene Jugendliche verschiedene Mengen an Taschengeld bekommen. 9 • Die Schüler äußern Vermutungen über unterschiedliche Taschengeldbeträge. • Die Schüler lernen, nicht aufgrund von Gefühlen und ersten Eindrücken zu urteilen, sondern nach gründlicher Fallanalyse, indem sie eine Berechnung anstellen, wie viel die Schüler vom Taschengeld übrig behalten. • Die Schüler wissen, dass es verschiedene Gründe der Taschengeldhöhe gibt. • Die Schüler beurteilen anhand ihres Falles über Faktoren, welche die Taschengeldbeträge beeinflussen. • Die Schüler beteiligen sich aktiv an der Auswertung ihrer Fälle. 4.2.3. Psychomotorische Lernziele Beziehen sich auf manipulative und handlungsbezogene Fertigkeiten • Die Schüler geben die Dateien richtig in die Exceldatei ein. • Die Schüler führen die notwendigen Berechnungen aus. • Die Schüler drucken ihre Ergebnisse aus. 4.2.4. Soziale Lernziele Beziehen sich auf den Umgang u. die Zusammenarbeit der Schülern untereinander und mit dem Lehrer • Die Schüler äußern ihre Meinung. • Die Schüler vertreten ihre Meinung. • Die Schüler sind tolerant gegenüber der Meinung ihrer Mitschüler. • Die Schüler halten sich an die Gesprächsregeln: „Wenn ich etwas zu sagen habe oder wenn ich eine Frage habe, melde ich mich. „Wenn jemand etwas sagen möchte, höre ich zu. „Ich akzeptiere die Meinung der Anderen. „Ich lache niemanden wegen seiner Meinung aus. • • • • „Ich benutze keine Schimpfwörter oder Kraftausdrücke. Die Schüler bearbeiten in Partnerarbeit die Aufgaben am PC. Die Schüler tragen in der Klassengemeinschaft die Ergebnisse zusammen. Die Schüler haben ein angemessenes Schüler-Lehrerverhalten. Die Schüler haben einen wertschätzenden Umgang miteinander. • Die Schüler können ihre Befindlichkeiten steuern. 5. Methodische Entscheidungen 5.1. Allgemeine methodische Konzeption Für die Erarbeitung des Themas sind folgende Herangehensweisen denkbar: Die Schüler befragen im Vorfeld Klassenkameraden, Freunde, Eltern und Verwandte und bringen die Ergebnisse in den Unterricht mit. Diese 10 Ergebnisse könnten dann die Grundlage dieser Stunde bilden. Diese Herangehensweise würde jedoch im Vorfeld viel Zeit in Anspruch nehmen, weshalb diese Herangehensweise für diese Stunde nicht in möglich ist. Die Schüler könnten im Internet selbstständig oder gelenkt über vorherbestimmte Seiten selbst nach Kriterien für die „gerechte Höhe von Taschengeldbeträgen recherchieren. Da die Schüler im Umgang mit dem PC noch zu unerfahren sind und die Aufgabe für Schüler in dieser Altersstufe zu komplex wäre, würde dieses Vorgehen zu lange dauern und den Rahmen dieser Stunde bei weitem sprengen. Die Schüler arbeiten an vorgefertigten Fallbeispielen. Mit dieser Herangehensweise kann das Niveau der Fälle auf das Alter und den Leistungsstand der Schüler angepasst werden. Die Dauer der Erarbeitung kann in gewissen Grenzen gelenkt werden. Der Lehrer hat sich aus praktikablen Gründen für die dritte Variante entschieden. 5.1.1. Vorüberlegungen für den Einstieg: Für den Einstieg sind mehrere Möglichkeiten denkbar. Der Lehrer zeigt ein Video mit einem Interview, bei dem Schüler über die Höhe ihres Taschengeldes und ihre Ausgaben befragt werden. Der Lehrer befragt die Schüler über die Höhe ihres Taschengeldes und über ihre Vorstellungen der gerechten Höhe des Taschengeldes. Die Schüler werden mittels eines gelenkten Rollenspiels mit unterschiedlicher Taschengeldhöhe konfrontiert, in dem die Ausgangsfrage der „gerechten Taschengeldhöhe aufgeworfen wird und erste Hinweise zu den Bedingungen unterschiedlicher Taschengeldhöhe gegeben werden. Das Video würde einen hohen Motivationsfaktor für die Schüler haben. Jedoch wäre die Schülerbeteiligung in diesem Fall sehr gering. Die Schüler nach der Höhe ihres Taschengeldes zu befragen, kann bisweilen sehr kritisch sein, weil nicht bekannt ist, wie viel Geld die einzelnen Schüler bekommen, bzw. ob überhaupt alle Schüler von ihren Eltern Taschengeld erhalten. Dies könnte zu emotional belasteten Situationen schon zu Unterrichtsbeginn führen, was zu vermeiden gilt. Der Lehrer hat sich deshalb für folgenden Einstieg entschieden: 11 5.1.2. Begrüßung und Themenvorstellung: Nach unseren bisherigen Erfahrungen mit dieser Klasse geht der Lehrer davon aus, dass die Schüler 2-3 Minuten zu spät in die Stunde kommen werden. (Die ist so, weil die Schüler in der Regel erst in ihr Klassenzimmer gehen um ihre Schultasche und ihre Jacken abzulegen.) Wenn die Schüler das Klassenzimmer betreten, wird der Lehrer den Schülern ein Namensschild austeilen. Die Schüler werden sich wie gewohnt auf die Stühle setzen. Die Schüler sitzen am Gruppentisch im Zentrum des Raumes beieinander. Der Lehrer teilt den Schülern mit, dass es in dieser Stunde um das Thema Taschengeld geht. 5.1.3. Begegnungsphase: Einsteig /Problemerfassung /Sinneswahrnehmung Vier Schüler bekommen eine Rolle zugeteilt. In dieser Rolle geht es um die Jugendlichen „Peter, „Sabine, „Carla und „Gabi, welche sich über ihr Taschengeld unterhalten. Die Endaussage des Textes ist, dass Sabine es ungerecht findet, dass Gabi 40 € Taschengeld im Monat erhält, während Sabine sich mit lediglich 2 € wöchentlich begnügen muss. Die Schüler können den Text über eine PowerPoint-Präsentation am Beamer lesen, so dass alle anderen Schüler den Text gleich mitverfolgen können. 5.1.4. Überleitung: Die Schüler stellen Vermutungen an, warum Kinder und Jugendliche Taschengeld in unterschiedlicher Höhe bekommen. Die Schüleräußerungen werden in einem vorbereiteten Dokument festgehalten. 5.1.5. Auseinandersetzungsphase Erarbeitung Die Schüler erfahren, dass sie gleich einen Fall untersuchen sollen, bei dem sie prüfen wie viel Geld die Kinder und Jugendlichen unterschiedlichen Alters bekommen, welche regelmäßigen Ausgaben sie haben und was am Ende noch von dem Geld übrig bleibt. Der Lehrer macht zur Übung mit den Schülern eine Aufgabe gemeinsam durch, damit die Schüler wissen, was sie in der Tabelle übernehmen müssen und wie sie die Berechnung durchführen müssen. Die Schüler werden in Gruppen zu je 2 Schülern (im Einzelfall auch mal 3) eingeteilt. Für jede Gruppe ist bereits ein PC vorbereitet und eingeschaltet. Die Schüler müssen nur noch den Bildschirm einschalten. 12 Besonders schnelle Gruppen können noch ausrechnen, ob die Jugendlichen besser gestellt sind, wenn sie sich ihr Taschengeld wöchentlich oder monatlich auszahlen lassen (Puffer). Die einzelnen Ergebnisse drucken die Schüler jeweils aus, zeigen den Ausdruck dem Lehrer und fahren dann ihren PC herunter. Damit die Auswertung im Anschluss der Erarbeitungsphase nicht zu viel Zeit in Anspruch nimmt, hat der Lehrer neben der Vorführaufgabe nur noch 3 Aufgaben vorbereitet, sodass immer jeweils drei Gruppen dieselbe Aufgabe zu lösen haben. Dies wird den Schülern in dieser Phase jedoch noch nicht mitgeteilt. Im Vorfeld der Stunde stand auch die Überlegung im Raum, ob die Erarbeitungsphase auch ohne PC an 5 Gruppentischen mit jeweils 4 Schülern erfolgen könnte. Davon wurde abgesehen, weil die Klasse 5b wie eingangs erwähnt sehr unruhig ist und weil die Arbeit am PC eine zusätzliche Motivation sein könnte am Thema mitzuarbeiten. Darüber hinaus können die Schüler ihre kürzlich erworbenen Kompetenzen mit diesem Medium festigen. 5.1.6. Auswertung: Die Schüler kommen wieder zurück an den Gruppentisch. Gemeinsam werden die Ergebnisse gesammelt und auf die Tabelle am Beamer übertragen. Die Ergebnisse werden miteinander verglichen. Die Schüler erkennen die Zusammenhänge und finden erste Antworten. Gemeinsam wird geklärt, warum die Jugendlichen unterschiedliche Taschengeldbeträge bekommen. Mit den Schülern werden „gute Argumente gesammelt, mit denen man beispielsweise die Eltern überzeugen könnte, warum sie ein höheres Taschengeld bekommen sollten. Die Feststellungen werden mit den ersten Vermutungen der Schüler verglichen und gegenübergestellt. Diese Aussage wird auf dem Arbeitsblatt notiert. Dieses Arbeitsblatt wird als Ergebnisssicherung für jeden Schüler ausgedruckt. 5.1.7. Lernzielkontrolle Die Schüler bekommen ein Arbeitsblatt mit Meinungen, welches sie in Einzelarbeit durch Unter- und Durchstreichen bewerten. 13 Das Arbeitsblatt wird im Anschluss in der Gruppe besprochen. Bei knapper Zeit wird dieses Arbeitsblatt in der nächsten Stunde zur Wiederholung eingesetzt. 5.1.8. Transfer/ Puffer Der Transfer dieser Stunde kann in folgende Richtungen erfolgen: 1. Taschengeldparagraf 2. Konsumverhalten von Jugendlichen: früher/ heute/ morgen 3. Empfehlungen der Jugendämter und Banken bezüglich der Taschengeldhöhe 4. Beurteilungskompetenz 5. Lohnfindung. Wenn die Zeit noch ausreicht, wird das Rollenspiel zu Beginn der Stunde wieder aufgegriffen. Situation: Sabine tritt unter Zuhilfenahme „guter Argumente in Taschengeldverhandlungen mit ihren Eltern (freies Rollenspiel). 5.1.9. Stundenende: Der Lehrer verabschiedet einen Teil der Klasse, denn die andere Hälfte der Klasse hat weiterhin Unterricht in Wirtschaftskunde in diesem Raum. 14 NAME: Ronni Bergau ZEIT (PHASEN) 7.40 Uhr Begrüßung 7.43 Uhr 7.45 Uhr Begegnungsphase Einsteig Problemerfassung 7:49 Uhr Überleitung 7.53 Uhr Auseinandersetzungs phase Erarbeitung Puffer 8.05 Uhr 8.10 Uhr Umsetzungsphase Ergebnissicherung THEMA: Taschengeld METHODEN MEDIEN 6. UNTERRICHTSVERLAUF L: begrüßt die Schüler und teilt die Namensschilder aus KLASSE: 5 BEMERKUNGEN ORGANISATION Namensschilder L: informiert die Schüler über das Stundenthema L. verteilt Rollen für das gelenkte Rollenspiel. 3 S. spielen gelenktes Rollenspiel, während die anderen SuS das Rollenspiel zusätzlich auf einer PowerPoint-Präsentation verfolgen können. SuS stellen Vermutungen an, warum Jugendliche Taschengeld in unterschiedlicher Höhe bekommen. Schüleräußerungen werden auf Datei fixiert. Die Fallbeispiele werden genauer untersucht. L. führt es an einem Beispiel vor. L. teilt Gruppen ein, indem er immer jeweils zwei Schülern einen Umschlag mit einem weiteren Fallbeispiel überreicht. SuS bearbeiten die Aufgabe selbstständig an den vorbereiteten PCs. SuS drucken ihre Lösungen aus, zeigen sie dem L. und fahren den PC herunter. Rollenspiel Konfrontation Ausgangsfrage formulieren Blätter für das Rollenspiel; PowerPoint-Präsentation; (LehrerPC/Beamer) Gespräch Problem erkennen Datei; (LehrerPC/Beamer) Thementeilige Partnerarbeit Erkennen Einnahmen und Ausgaben; Entdecken von Zusammenhängen Umschläge mit Arbeitsaufträgen; 10 SchülerPC; besonders schnelle Gruppen rechnen aus, ob es günstiger für die Jugendlichen wäre, wenn sie das Taschengeld wöchentlich oder monatlich bekommen würden. Die Schüler kommen wieder zurück an den Gruppentisch. Gemeinsam werden die Ergebnisse frontal Vergleichen und gesammelt und auf die Tabelle am Beamer übertragen. erkennen, Die Ergebnisse werden miteinander verglichen. Zusammenhänge finden, ersten Antworten Gemeinsam wird geklärt, warum die Jugendlichen unterschiedliche Taschengeldbeträge frontal bekommen. Die Feststellungen werden mit den ersten Vermutungen der Schüler verglichen Unterrichtsgespräch Gründe für Taschengeld und gegenübergestellt. und Taschengeldhöhe Diese Aussage wird auf der Datei (über Beamer) notiert. Dieses Blatt wird (später) für jeden Schüler als Ergebnissicherung ausgedruckt und im Ordner finden; Zusammenhänge abgeheftet. erkennen; Merksatz aufstellen 15 Drucker/ Papier LehrerPC/ Beamer Tabelle/ Arbeitsblatt LehrerPC/ Beamer Drucker 8.20 Uhr Lernzielkontrolle 8.23 Uhr Puffer Transfer 8:25 teilt Arbeitsblatt mit Meinungen aus. SuS bearbeiten das Arbeitsblatt selbständig: streichen falsche Aussagen durch und unterstreichen richtige Aussagen. L. druckt Arbeitsblätter der vorangegangenen Phasen für jeden Schüler aus. SuS und gehen das Arbeitsblatt gemeinsam durch. Schüler nehmen die Rollen von Sabine und ihren Eltern ein und treten in Taschengeldverhandlungen. Dabei benutzen sie die erarbeiteten Argumente. Ende der Unterrichtsstunde, die Schüler werden verabschiedet. 16 Einzelarbeit Erkenntnisse und Einstellungen überprüfen Arbeitsblätter Feies Rollenspiel Präsentation LehrerPC/ Beamer 7. Material und Medien Namensschild Magnete Powerpointpräsentation zum Rollenspiel Rollenspiel Vergleich Vermutung-Ergebnisse Arbeitsaufträge Arbeitsaufträge Arbeitsaufträge Arbeitsaufträge Arbeitsaufträge PC Arbeitsaufträge PC Arbeitsaufträge PC Gesamtübersicht Zusatzaufgabe Zusatzaufgabe Zusatzaufgabe Arbeitsblatt Überprüfung Nummernschilder PC Umschläge für Aufgaben Edding Compuer Nummern Datei Blätter Datei Carla (Datei) Peter (Blatt/Umschlag) Sabine (Blatt/Umschlag) Gabi (Blatt/Umschlag) Peter (Datei) Gabi (Datei) Sabine (Datei) Datei Peter Sabine Gabi Blatt 10 10 10 17 8. Literaturverzeichnis: Deggendorf, S. (kein Datum). deggendorf.de. Abgerufen am 27. März 2010 von Flöck-Schmiedel. (kein Datum). Das Taschengeld. Wirtschaften im privaten Haushalt HWRS Bildungszentrum Seefaelle in Filderstadt-Bonlanden. (kein Datum). Abgerufen am 15. 02 2010 von Ministerium für Kultus, J. u.-W. Bildungsplan 2004. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg. Ripplinger, J. Lernziel Sozialkompetenz. In J. Ripplinger, Wie Schulen soziales Lernen systematisch fördern können (S. 1-10). Stuttgart: mehrwert ggmbh. Taschengeld.net (kein Datum). Abgerufen am 27. März 2010 von (2005). Verbraucher und Markt/ Jugendliche als Konsumenten. In Trio 2 Erdkunde/ Wirtschaftskunde/ Gemeinschaftskunde (S. 8). Braunschweig: Bildungshaus Schulbuchverlage. 18 Name: Schule: BZ Seefälle, Bonlanden Klasse: 5b Datum:31.03.2010 Fach: WAG Wirtschaft Die Geschwister Peter und Sabine besuchen am Wochenende ihre Freunde Gabi und Carla. Im Zimmer von Carla gibt es folgendes Gespräch: Gabi Peter: Hey! Du hast ja die neue CD von Lena Meyer-Landrut Sabine: Die hättest du wohl auch gern, aber dir fehlt das Geld. Gabi: Die habe ich mir von meinem Taschengeld gekauft. Sabine: Wie viel bekommst du? Gabi: Ich bekomme 40 € im Monat Sabine: So viel Geld! Ich bekomme jede Woche 2 €, aber ich lasse mir die CDs von Oma schenken. Carla: Ja, ich habe früher auch nicht so viel bekommen. Meine Eltern geben mir jedes Jahr 50 Cent mehr Taschengeld. Jetzt bekomme ich in der Woche schon 4 €. Peter: Mir schenkt Oma bestimmt nichts mehr, wenn sie hört, dass Papa mir in Zukunft 20 € im Monat gibt. Gabi: 40 € hört sich viel an, aber es reicht mir kaum. Sabine: Trotzdem finde ich das ungerecht 1 Ronni Bergau Name: Schule: BZ Seefälle, Bonlanden Klasse: 5b Datum:31.03.2010 Fach: WAG Wirtschaft Was kann die Höhe des Taschengelds beeinflussen? Zutreffendes unterstreichen! Unzutreffendes streichen! Das Alter Der Sparwille Die festen Ausgaben Das Vermögen der Familie Das Gespräch mit den Eltern Die Verantwortungsbereitschaft Das Geschlecht Die Belohnung Das Verhalten Die Geschenke Die Wünsche Die Strafe 1 Ronni Bergau Name: Schule: BZ Seefälle, Bonlanden Taschengeld Carla: Carla bekommt ihr Taschengeld wöchentlich und zwar 4 €. Carla spielt Klarinette im Jugendorchester. In der Orchesterprobe kauft sie sich immer etwas für 1 € zum Trinken. Carla hat zu Weihnachten einen Computer geschenkt bekommen. Die Spiele hierfür muss sie sich selbst kaufen. Hierfür spart sie jede Woche 2 €. Von Oma bekommt sie jede Woche 2 €. Sie musste aber versprechen, davon wöchentliche 1 € zu sparen. Einmal in der Woche kauft sie sich in der Schule am Automaten eine Milch für 0,60 €. Trage die Beträge die Carla bekommt und ausgibt in die Tabelle ein: Thema: Taschengeld Fach: WAG Wirtschaft Datum: 31. 03.2010 Carla Alter 12 Jahre Einnahmen Taschengeld Zuwendung Oma wöchentlich Einnahmen gesamt Feste Ausgaben Ausgaben gesamt Sparen Sparen gesamt Rest Name: Schule: BZ Seefälle, Bonlanden Klasse: 5b Datum:31.03.2010 Fach: WAG Wirtschaft Die Geschwister Peter und Sabine besuchen am Wochenende ihre Freunde Gabi und Carla. Im Zimmer von Carla gibt es folgendes Gespräch: Carla Peter: Hey! Du hast ja die neue CD von Lena Meyer-Landrut Sabine: Die hättest du wohl auch gern, aber dir fehlt das Geld. Gabi: Die habe ich mir von meinem Taschengeld gekauft. Sabine: Wie viel bekommst du? Gabi: Ich bekomme 40 € im Monat Sabine: So viel Geld! Ich bekomme jede Woche 2 €, aber ich lasse mir die CDs von Oma schenken. Carla: Ja, ich habe früher auch nicht so viel bekommen. Meine Eltern geben mir jedes Jahr 50 Cent mehr Taschengeld. Jetzt bekomme ich in der Woche schon 4 €. Peter: Mir schenkt Oma bestimmt nichts mehr, wenn sie hört, dass Papa mir in Zukunft 20 € im Monat gibt. Gabi: 40 € hört sich viel an, aber es reicht mir kaum. Sabine: Trotzdem finde ich das ungerecht 1 Ronni Bergau Name: Schule: BZ Seefälle, Bonlanden Klasse: 5b Datum:31.03.2010 Fach: WAG Wirtschaft Die Geschwister Peter und Sabine besuchen am Wochenende ihre Freunde Gabi und Carla. Im Zimmer von Carla gibt es folgendes Gespräch: Peter Peter: Hey! Du hast ja die neue CD von Lena Meyer-Landrut Sabine: Die hättest du wohl auch gern, aber dir fehlt das Geld. Gabi: Die habe ich mir von meinem Taschengeld gekauft. Sabine: Wie viel bekommst du? Gabi: Ich bekomme 40 € im Monat Sabine: So viel Geld! Ich bekomme jede Woche 2 €, aber ich lasse mir die CDs von Oma schenken. Carla: Ja, ich habe früher auch nicht so viel bekommen. Meine Eltern geben mir jedes Jahr 50 Cent mehr Taschengeld. Jetzt bekomme ich in der Woche schon 4 €. Peter: Mir schenkt Oma bestimmt nichts mehr, wenn sie hört, dass Papa mir in Zukunft 20 € im Monat gibt. Gabi: 40 € hört sich viel an, aber es reicht mir kaum. Sabine: Trotzdem finde ich das ungerecht 1 Ronni Bergau Name: Schule: BZ Seefälle, Bonlanden Klasse: 5b Datum:31.03.2010 Fach: WAG Wirtschaft Die Geschwister Peter und Sabine besuchen am Wochenende ihre Freunde Gabi und Carla. Im Zimmer von Carla gibt es folgendes Gespräch: Sabine Peter: Hey! Du hast ja die neue CD von Lena Meyer-Landrut Sabine: Die hättest du wohl auch gern, aber dir fehlt das Geld. Gabi: Die habe ich mir von meinem Taschengeld gekauft. Sabine: Wie viel bekommst du? Gabi: Ich bekomme 40 € im Monat Sabine: So viel Geld! Ich bekomme jede Woche 2 €, aber ich lasse mir die CDs von Oma schenken. Carla: Ja, ich habe früher auch nicht so viel bekommen. Meine Eltern geben mir jedes Jahr 50 Cent mehr Taschengeld. Jetzt bekomme ich in der Woche schon 4 €. Peter: Mir schenkt Oma bestimmt nichts mehr, wenn sie hört, dass Papa mir in Zukunft 20 € im Monat gibt. Gabi: 40 € hört sich viel an, aber es reicht mir kaum. Sabine: Trotzdem finde ich das ungerecht 1 Ronni Bergau Name: Schule: BZ Seefälle, Bonlanden Taschengeld Carla: Carla bekommt ihr Taschengeld wöchentlich und zwar 4 €. Carla spielt Klarinette im Jugendorchester. In der Orchesterprobe kauft sie sich immer etwas für 1 € zum Trinken. Carla hat zu Weihnachten einen Computer geschenkt bekommen. Die Spiele hierfür muss sie sich selbst kaufen. Hierfür spart sie jede Woche 2 €. Von Oma bekommt sie jede Woche 2 €. Sie musste aber versprechen, davon wöchentliche 1 € zu sparen. Einmal in der Woche kauft sie sich in der Schule am Automaten eine Milch für 0,60 €. Trage die Beträge die Carla bekommt und ausgibt in die Tabelle ein: Thema: Taschengeld Fach: WAG Wirtschaft Datum: 31. 03.2010 Carla Alter 12 Jahre Einnahmen Taschengeld Zuwendung Oma wöchentlich 4.00 € 2.00 € Einnahmen gesamt 6.00 € Feste Ausgaben Trinken Schulmilch 1.00 € 0.60 € Ausgaben gesamt 1.60 € Sparen Spiele Oma 2.00 € 1.00 € Sparen gesamt 3.00 € Rest 1.40 € Name: Schule: BZ Seefälle, Bonlanden Thema: Taschengeld Fach: WAG Wirtschaft Datum: 31. 03.2010 Taschengeld Gabi: Gabi bekommt ihr Taschengeld monatlich und zwar 40 €. Davon hat sie schon zum Teil ihren Führerschein bezahlt und besitzt seit den Sommerferien einen Roller mit dem sie jeden Tag in die Stadt zur Schule fährt. Sie gibt monatlich für Benzin 10 € und für Versicherung und Steuer 5 € aus. Den Rest bezahlt Oma gern, weil sie zu ihr jetzt öfter zu Besuch kommt. Oma gibt ihr monatlich noch 10 €, davon muss sie aber die Hälfte sparen, damit sie sich mal etwas Größeres leisten kann. Ihr Monatsabo für das Fitnessstudio kostet sie 10 €. In der Mittagspause isst sie in der Schulkantine für monatlich 10 €. Für ihre Schulsachen, Feste und Drogerieeinkäufe ist sie selbst zuständig. Trage die Beträge die Gabi bekommt und ausgibt in die Tabelle ein: Gabi Alter 16 Jahre Einnahmen monatlich Taschengeld Zuwendung Oma Einnahmen gesamt Feste Ausgaben Ausgaben gesamt Sparen Sparen gesamt Rest Name: Schule: BZ Seefälle, Bonlanden Thema: Taschengeld Fach: WAG Wirtschaft Datum: 31. 03.2010 Taschengeld Gabi: Gabi bekommt ihr Taschengeld monatlich und zwar 40 €. Davon hat sie schon zum Teil ihren Führerschein bezahlt und besitzt seit den Sommerferien einen Roller mit dem sie jeden Tag in die Stadt zur Schule fährt. Sie gibt monatlich für Benzin 10 € und für Versicherung und Steuer 5 € aus. Den Rest bezahlt Oma gern, weil sie zu ihr jetzt öfter zu Besuch kommt. Oma gibt ihr monatlich noch 10 €, davon muss sie aber die Hälfte sparen, damit sie sich mal etwas Größeres leisten kann. Ihr Monatsabo für das Fitnessstudio kostet sie 10 €. In der Mittagspause isst sie in der Schulkantine für monatlich 10 €. Für ihre Schulsachen, Feste und Drogerieeinkäufe ist sie selbst zuständig. Trage die Beträge die Gabi bekommt und ausgibt in die Tabelle ein: Gabi Alter 16 Jahre Einnahmen monatlich Taschengeld Zuwendung Oma 40.00 € 10.00 € Einnahmen gesamt 50.00 € Feste Ausgaben Benzin Versicherung und Steuer Fitnessstudio Schulkantine 10.00 € 5.00 € 10.00 € 10.00 € Ausgaben gesamt 35.00 € Sparen für etwas Größeres 5.00 € Sparen gesamt 5.00 € Rest 10.00 € Name: Schule: BZ Seefälle, Bonlanden Thema: Taschengeld Fach: WAG Wirtschaft Datum: 31. 03.2010 Taschengeld Peter: Peter bekommt seit er letzte Woche mit seinem Vater gesprochen hat monatlich 20 €. Jeden Monat geht er regelmäßig mit seinen Freunden ins Erlebnisbad, der Eintritt kostet dort 6 €. Manchmal fährt er auch mit dem Bus, das kostet 1 €, meistens jedoch mit dem Fahrrad, denn dann kauft er sich dort lieber etwasLeckeres für das gleiche Geld. In der Mittagspause radelt er aber nicht nach Hause sondern kauft sich lieber selbst etwas zu Essen, das kostet ihn jeden Monat 10 €. Zum Glück gibts da noch Oma, die ihm jeden Monat 5 € gibt, davon muss er aber die Hälfte sparen, damit er sich einmal etwas Größeres kaufen kann. Für Geburtstagsgeschenke für seine Freunde und andere Feste ist er nun selbst zuständig. Er hat sich überlegt, dass er dafür jeden Monat 5 € zurücklegt. Trage die Beträge die Peter bekommt und ausgibt in die Tabelle ein: Peter Alter 13 Jahre Einnahmen monatlich Taschengeld Zuwendung Oma Einnahmen gesamt Feste Ausgaben Ausgaben gesamt Sparen Sparen gesamt Rest Name: Schule: BZ Seefälle, Bonlanden Thema: Taschengeld Fach: WAG Wirtschaft Datum: 31. 03.2010 Taschengeld Peter: Peter bekommt seit er letzte Woche mit seinem Vater gesprochen hat monatlich 20 €. Jeden Monat geht er regelmäßig mit seinen Freunden ins Erlebnisbad, der Eintritt kostet dort 6 €. Manchmal fährt er auch mit dem Bus, das kostet 1 €, meistens jedoch mit dem Fahrrad, denn dann kauft er sich dort lieber etwasLeckeres für das gleiche Geld. In der Mittagspause radelt er aber nicht nach Hause sondern kauft sich lieber selbst etwas zu Essen, das kostet ihn jeden Monat 10 €. Zum Glück gibts da noch Oma, die ihm jeden Monat 5 € gibt, davon muss er aber die Hälfte sparen, damit er sich einmal etwas Größeres kaufen kann. Für Geburtstagsgeschenke für seine Freunde und andere Feste ist er nun selbst zuständig. Er hat sich überlegt, dass er dafür jeden Monat 5 € zurücklegt. Trage die Beträge die Peter bekommt und ausgibt in die Tabelle ein: Peter Alter 13 Jahre Einnahmen monatlich Taschengeld Zuwendung Oma 20.00 € 5.00 € Einnahmen gesamt 25.00 € Feste Ausgaben Erlebnisbas Bus Essen Essen 6.00 € 1.00 € 10.00 € Ausgaben gesamt 17.00 € Sparen etwas Größeres Freunde 2.50 € 5.00 € Sparen gesamt 7.50 € Rest 0.50 € Name: Schule: BZ Seefälle, Bonlanden Thema: Taschengeld Fach: WAG Wirtschaft Datum: 31. 03.2010 Taschengeld Sabine: Sabine bekommt jede Woche montags 2 € Taschengeld von ihrer Mutter. Jeden Montag geht siegleich zum Supermarkt und kauft sich die neueste Ausgabe der Wochenzeitschrift Mädchen für 1 €. An diesem Tag besucht sie auch immer ihre Oma von der sie regelmäßig 1 € bekommt, allerdings muss sie ihr versprechen immer die Hälfte davon zu sparen, damit sie sich später etwas Größeres leisten kann. Während der Woche kauft sie sich von dem restlichen Geld verschiedene Kleinigkeiten zu Essen und zu Trinken. Donnerstags hat sie nachmittags Schule. Die Mutter gibt ihr dann immer ein Vesper und Obst mit und Sabine kauft immer in der Mittagspause von ihrem Taschengeld etwas zu Trinken für 0,50 €. Trage die Beträge die Sabine bekommt und ausgibt in die Tabelle ein: Sabine Alter 8 Jahre Einnahmen wöchentlich Taschengeld Zuwendung Oma Einnahmen gesamt Feste Ausgaben Ausgaben gesamt Sparen Sparen gesamt Rest Name: Schule: BZ Seefälle, Bonlanden Thema: Taschengeld Fach: WAG Wirtschaft Datum: 31. 03.2010 Taschengeld Sabine: Sabine bekommt jede Woche montags 2 € Taschengeld von ihrer Mutter. Jeden Montag geht siegleich zum Supermarkt und kauft sich die neueste Ausgabe der Wochenzeitschrift Mädchen für 1 €. An diesem Tag besucht sie auch immer ihre Oma von der sie regelmäßig 1 € bekommt, allerdings muss sie ihr versprechen immer die Hälfte davon zu sparen, damit sie sich später etwas Größeres leisten kann. Während der Woche kauft sie sich von dem restlichen Geld verschiedene Kleinigkeiten zu Essen und zu Trinken. Donnerstags hat sie nachmittags Schule. Die Mutter gibt ihr dann immer ein Vesper und Obst mit und Sabine kauft immer in der Mittagspause von ihrem Taschengeld etwas zu Trinken für 0,50 €. Trage die Beträge die Sabine bekommt und ausgibt in die Tabelle ein: Sabine Alter 8 Jahre Einnahmen wöchentlich Taschengeld Zuwendung Oma 2.00 € 1.00 € Einnahmen gesamt 3.00 € Feste Ausgaben Zeitschrift Mittagspause 1.00 € 0.50 € Ausgaben gesamt 1.50 € Sparen etwas Größeres 0.50 € Sparen gesamt 0.50 € Rest 1.00 € Thema: Taschengeld Fach: WAG Wirtschaft Datum: 31. 03.2010 12 Jahre wöchentlich Alter Einnahmen Rest Sparen gesamt Sparen Ausgaben gesamt Feste Ausgaben Einnahmen gesamt Taschengeld Zuwendung Oma Carla Name wöchentlich 8 Jahre Sabine monatlich 13 Jahre Peter monatlich 16 Jahre Gabi Übersicht der regelmäßigen Einnahmen und Ausgaben von Carla, Sabine, Peter und Gabi Name: Schule: BZ Seefälle, Bonlanden Thema: Taschengeld Fach: WAG Wirtschaft Datum: 31. 03.2010 3.00 € 4.00 € 2.00 € 6.00 € Taschengeld Zuwendung Oma Einnahmen gesamt 0.50 € 1.00 € 3.00 € 1.40 € Sparen gesamt Rest 1.50 € 1.60 € 0.50 € 1.00 € 0.50 € 1.00 € 0.60 € wöchentlich 2.00 € 1.00 € Sparen Ausgaben gesamt Feste Ausgaben 2.00 € 1.00 € wöchentlich Einnahmen 8 Jahre 12 Jahre Alter Sabine Carla Name 0.50 € 7.50 € 2.50 € 5.00 € 17.00 € 6.00 € 1.00 € 10.00 € 25.00 € 20.00 € 5.00 € monatlich 13 Jahre Peter 10.00 € 5.00 € 5.00 € 35.00 € 10.00 € 5.00 € 10.00 € 10.00 € 50.00 € 40.00 € 10.00 € monatlich 16 Jahre Gabi Übersicht der regelmäßigen Einnahmen und Ausgaben von Carla, Sabine, Peter und Gabi Name: Schule: BZ Seefälle, Bonlanden Name: Schule: BZ Seefälle, Bonlanden Klasse: 5b Datum:31.03.2010 Fach: WAG Wirtschaft Was kann die Höhe des Taschengelds beeinflussen? Vermutungen Ergebnisse 1 Ronni Bergau Name: Schule: BZ Seefälle, Bonlanden Klasse: 5b Datum:31.03.2010 Fach: WAG Wirtschaft Zusatzaufgabe Gabi: 1. Würde es sich für Gabi mehr lohnen, wenn sie anstatt 40 € im Monat 10 € in der Woche bekommen würde? Hinweis: Das Jahr hat 12 Monate, Das Jahr hat 52 Wochen. 2. Wie viel Euro kann Gabi im Jahr sparen? Taschengeld im Monat: 40 € Rechnung: Taschengeld im Jahr: Taschengeld in der Woche: 10 € Rechnung: Taschengeld im Jahr: Antwort zur 1. Aufgabe: Gabi spart im Monat: Rechnung: Gabi spart im Jahr: 1 Ronni Bergau Name: Schule: BZ Seefälle, Bonlanden Klasse: 5b Datum:31.03.2010 Fach: WAG Wirtschaft Zusatzaufgabe Gabi: 1. Würde es sich für Gabi mehr lohnen, wenn sie anstatt 40 € im Monat 10 € in der Woche bekommen würde? Hinweis: Das Jahr hat 12 Monate, Das Jahr hat 52 Wochen. Taschengeld im Monat: 40 € Rechnung: 40 € 12 Monate Taschengeld im Jahr: 480 € Taschengeld in der Woche: 10 € Rechnung: 10 € 52 Wochen Taschengeld im Jahr: 520 € Antwort: Ja es würde sich lohnen, denn sie würde 40 € mehr erhalten. 1 Ronni Bergau Name: Schule: BZ Seefälle, Bonlanden Klasse: 5b Datum:31.03.2010 Fach: WAG Wirtschaft Zusatzaufgabe Peter: 1. Würde es sich für Peter mehr lohnen, wenn er anstatt 20 € im Monat 5 € in der Woche bekommen würde? Hinweis: Das Jahr hat 12 Monate, Das Jahr hat 52 Wochen. 2. Wie viel Euro kann Peter im Jahr sparen? Taschengeld im Monat: 20 € Rechnung: Taschengeld im Jahr: Taschengeld in der Woche: 5€ Rechnung: Taschengeld im Jahr: Antwort zur 1. Aufgabe: Peter spart im Monat: Rechnung: Peter spart im Jahr: 1 Ronni Bergau Name: Schule: BZ Seefälle, Bonlanden Klasse: 5b Datum:31.03.2010 Fach: WAG Wirtschaft Zusatzaufgabe Peter: 1. Würde es sich für Peter mehr lohnen, wenn er anstatt 20 € im Monat 5 € in der Woche bekommen würde? Hinweis: Das Jahr hat 12 Monate, Das Jahr hat 52 Wochen. Taschengeld im Monat: 20 € Rechnung: 20€ 12Monate Taschengeld im Jahr: 240 € Taschengeld in der Woche: 5€ Rechnung: 5€ 52 Wochen Taschengeld im Jahr: 260 € Antwort: Ja es würde sich für Peter lohnen, denn er würde im Jahr 20 € mehr bekommen. 1 Ronni Bergau Name: Schule: BZ Seefälle, Bonlanden Klasse: 5b Datum:31.03.2010 Fach: WAG Wirtschaft Zusatzaufgabe Sabine: 1. Würde es sich für Sabine mehr lohnen, wenn sie anstatt 2 € in der Woche 8 € im Monat bekommen würde? Hinweis: Das Jahr hat 12 Monate, Das Jahr hat 52 Wochen. Taschengeld in der Woche: 2€ Rechnung: 2€ 52 Wochen Taschengeld im Jahr: 104 € Taschengeld im Monat: 8€ Rechnung: 8 € 12 Monate Taschengeld im Jahr: 96 € Antwort: Nein es würde sich für Sabine nicht lohnen, weil sie im Jahr 8 € weniger bekommen würde. 1 Ronni Bergau Name: Schule: BZ Seefälle, Bonlanden Klasse: 5b Datum:31.03.2010 Fach: WAG Wirtschaft Zusatzaufgabe Sabine: 1. Würde es sich für Sabine mehr lohnen, wenn sie anstatt 2 € in der Woche 8 € im Monat bekommen würde? Hinweis: Das Jahr hat 12 Monate, Das Jahr hat 52 Wochen. 2. Wie viel Euro kann Sabine im Jahr sparen? Taschengeld in der Woche: 2€ Rechnung: Taschengeld im Jahr: Taschengeld im Monat: 8€ Rechnung: Taschengeld im Jahr: Antwort zur 1. Aufgabe: Sabine spart in der Woche: Rechnung: Sabine spart im Jahr: 1 Ronni Bergau