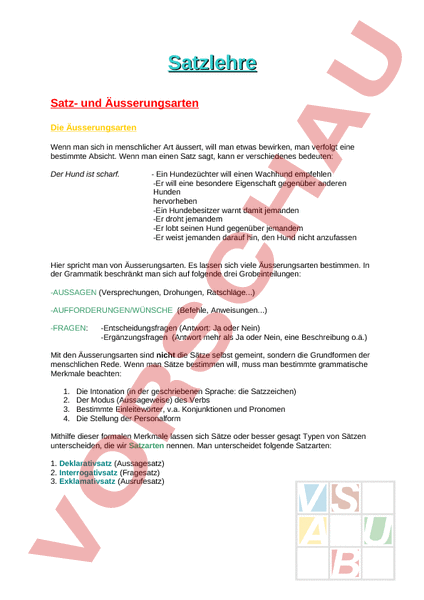Arbeitsblatt: Übersicht Sätze
Material-Details
10 Seiten als Übersicht zum Thema Sätze
Deutsch
Grammatik
7. Schuljahr
10 Seiten
Statistik
65441
969
10
13.08.2010
Autor/in
Magnos Huwyler
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Satzlehre Satz- und Äusserungsarten Die Äusserungsarten Wenn man sich in menschlicher Art äussert, will man etwas bewirken, man verfolgt eine bestimmte Absicht. Wenn man einen Satz sagt, kann er verschiedenes bedeuten: Der Hund ist scharf. Ein Hundezüchter will einen Wachhund empfehlen -Er will eine besondere Eigenschaft gegenüber anderen Hunden hervorheben -Ein Hundebesitzer warnt damit jemanden -Er droht jemandem -Er lobt seinen Hund gegenüber jemandem -Er weist jemanden darauf hin, den Hund nicht anzufassen Hier spricht man von Äusserungsarten. Es lassen sich viele Äusserungsarten bestimmen. In der Grammatik beschränkt man sich auf folgende drei Grobeinteilungen: -AUSSAGEN (Versprechungen, Drohungen, Ratschläge.) -AUFFORDERUNGEN/WÜNSCHE (Befehle, Anweisungen.) -FRAGEN: -Entscheidungsfragen (Antwort: Ja oder Nein) -Ergänzungsfragen (Antwort mehr als Ja oder Nein, eine Beschreibung o.ä.) Mit den Äusserungsarten sind nicht die Sätze selbst gemeint, sondern die Grundformen der menschlichen Rede. Wenn man Sätze bestimmen will, muss man bestimmte grammatische Merkmale beachten: 1. 2. 3. 4. Die Intonation (in der geschriebenen Sprache: die Satzzeichen) Der Modus (Aussageweise) des Verbs Bestimmte Einleitewörter, v.a. Konjunktionen und Pronomen Die Stellung der Personalform Mithilfe dieser formalen Merkmale lassen sich Sätze oder besser gesagt Typen von Sätzen unterscheiden, die wir Satzarten nennen. Man unterscheidet folgende Satzarten: 1. Deklarativsatz (Aussagesatz) 2. Interrogativsatz (Fragesatz) 3. Exklamativsatz (Ausrufesatz) Deklarativsätze Unter Deklarativ- oder Aussagesätzen versteht man Sätze, die mit neutraler, gegen Ende leicht sinkender Intonation gesprochen werden. Als Satzzeichen haben sie immer einen Punkt. Bei Deklarativsätzen handelt es sich um die neutralste Satzart. Interrogativsätze Diese Sätze werden mit am Ende leicht steigender Intonation gesprochen. Als Satzzeichen findet man hier immer ein Fragezeichen. Hier unterscheidet man zwischen zwei Fragen: Die Entscheidungsfrage und Die Ergänzungsfrage Die Entscheidungsfrage wird immer mit Ja oder Nein beantwortet und die Personalform steht meistens am Anfang des Satzes. Bsp.: Ist dir das peinlich? Siehst du dieses Haus dort? Die Ergänzungsfrage verlangt als Antwort mehr als nur ein Ja oder ein Nein, meistens ganze Sätze. Sie wird immer von einem interrogativen Adverb oder einem Interrogativpronomen eingeleitet. Bsp.: Mit welchem Zug kommt ihr? Wen bringst du mit? Wann kommst du? Es gibt aber auch noch weitere Formen von Interrogativsätzen: Ob sie wohl mit der Bahn kommen? Wen Jan wohl dieses Mal einlädt? Exklamativsätze Als Exklamativsätze bezeichnet man Sätze, die mit Nachdruck gesprochen werden, man erkennt sie am Ausrufezeichen. Bsp.: Wären wir doch schon zu Hause! Das ist ein Überfall! Eine besondere Form der Exklamativsätze ist der Imperativsatz, hier steht die Personalform im Imperativ: Hör doch endlich auf! Gib mir mal das Salz! Treten Sie ein! Einfache und zusammengesetzte Sätze Neben einfachen Sätzen gibt es – manchmal mehrmals zusammengesetzte – Sätze. Ein Bsp. für einen einfachen Satz: Ich mag Schokolade. Ein Bsp. für einen zusammenges. Satz: Ich mag Schokolade, weil sie süss ist. Ein Bsp. für einen mehrfach zusammenges. Satz: Obwohl alle Wissenschaftler ein ungutes Gefühl hatten, ist es keinem eingefallen, das unerwartete Ergebnis mit der Sorgfalt, die geboten war, zu überprüfen. Um besser über solche Unterschiede sprechen zu können, müssen einige Begriffe genannt werden: o o o einfacher und zusammengesetzter Satz Teilsatz Hauptsatz und Nebensatz Satzgefüge und Satzverbindung (Satzreihe) zusammengezogener Satz (und zusammengezogener Teilsatz) satzwertiger Ausdruck Der einfache Satz Ist klar, oder? Hat nur eine Personalform (evtl. mit Infinitiv) und kein Komma. Der zusammengesetzte Satz Diese Sätze haben immer mindestens ein Komma. Jede Einheit weist eine eigene Personalform auf. Man kann hier meist durch geringfügige Veränderungen, zum Teil nur durch Veränderung des Satzzeichens, aus einem Satz mehrere machen: Früher hatten wir oft Ärger mit dem Computer, er war dauernd kaputt. Früher hatten wir oft Ärger mit dem Computer. Er war dauernd kaputt. Wir haben es also mit Sätzen zu tun, die ihrerseits wieder aus Sätzen bestehen. Man spricht hier von zusammengesetzten Sätzen, die aus mehreren Teilsätzen bestehen Teilsätze treten in 2 unterschiedlichen Formen auf: als Hauptsatz oder als Nebensatz Den einfachen Satz könnte man auch so definieren: Er besteht aus einem einzigen Teilsatz. Haupt- und Nebensatz Ein Nebensatz ist einem anderen Teilsatz untergeordnet, er hängt grammatikalisch von ihm ab. Ein Teilsatz im Satzgefüge, von dem ein anderer grammatikalisch abhängig ist, bezeichnet man als übergeordnet. Dieser Teilsatz kann aber selbst auch wieder von einem anderen Teilsatz abhängig sein, also selbst ein Teilsatz sein. Bsp.: (a)Ich bin sicher, (b)dass er weiss, (c)was er hier für Vorteile hat. Der Teilsatz (b) ist hier (c) übergeordnet, aber zugleich ein Nebensatz zu (a), d.h. (a) untergeordnet. Der folgende Satz besteht aus einem Hauptsatz und 2 gleichrangigen Nebensätzen: (a)Ich möchte wissen, (b)bis wann der Computer repariert ist und (c)mit was für Kosten ich rechnen muss. In diesem Fall sind (b) und (c) die gleichrangigen Nebensätze, die von (a) abhängig sind. Die Satzglieder – Erkennung und Bestimmung In den folgenden Sätzen gehen wir von solchen mit Verbzweitstellung (Kernsätze) aus. Vor der Personalform kann immer nur ein Satzglied stehen (Konjunktionen nicht mitgerechnet). Um Satzglieder zu erkennen, gibt es verschiedene Methoden. Die einfachste und sicherste ist die Verschiebeprobe, man stellt den Satz um und alles, was sich auseinander nehmen lässt, so dass der Satz doch noch Sinn macht sind einzelne Satzglieder. Das Verb zählt nicht als Satzglied!!! Satzglieder sind also nur diejenigen Wörter oder Wortgruppen, die sich geschlossen verschieben lassen. Bsp.: Elke entdeckte ein Hufeisen auf dem Boden. Auf dem Boden entdeckte Elke ein Hufeisen. Also: Elke, ein Hufeisen und auf dem Boden sind die einzelnen Satzglieder. Wenn man die Verschiebeprobe anwendet, muss der Satz dasselbe bedeuten wie am Anfang und er muss grammatikalisch immer noch korrekt sein. Wie bestimmt man Satzglieder? Satzglieder können formal, funktional und inhaltlich bestimmt werden, wobei gesagt werden muss, dass sich die formale und die inhaltliche Bestimmungsweise sehr gleichen. Es sind eigentlich dieselben, nur dass die Inhaltliche die Formale noch genauer macht. Formale Bestimmung: Wenn man ein Satzglied formal bestimmt, unterscheidet man gewisse grammatikalische Merkmale. Satzglieder haben immer einen Kern. Die grammatikalischen Merkmale dieses Kerns prägen das Satzglied als Ganzes. Ganz wichtig ist die Wortart des Kerns. Man kann nämlich folgende Gruppen unterscheiden: -Nominalgruppen -Adjektiv- und Partizipgruppen -Adverbgruppen -Präpositionalgruppen -Konjunktionalgruppen (nur mit den Konj. als uns wie) Bei den Nominalgruppen wird ausserdem noch nach Kasus unterschieden: Nom.gr. im Nom. Nom.gr. im Gen. Nom.gr. im Dativ Nom.gr. im Akk. Wenn ein Satzglied nur aus einem oder zwei Wörtern (z.B. Artikel und Nomen) besteht, ist die Bestimmung relativ einfach. Schwierig wird es erst, wenn ein Satzglied aus mehreren Wörtern besteht. Bsp.: Das Spiel brachte ein für alle über die Massen enttäuschendes Ergebnis. Die einzelnen Satzglieder sind also: Das Spiel und ein für alle über die Massen enttäuschendes Ergebnis. Als was wird jetzt ein für alle. Ergebnis bestimmt? Das Spiel ist eine Nominalgruppe im Nominativ. Wenn man aber also mehrere Wörter hat, muss man schauen, was man alles weglassen kann, ohne dass der Satz nachher etwas völlig anderes bedeutet. Hier: ein über die Massen enttäuschendes Ergebnis ein enttäuschendes Ergebnis ein Ergebnis Übriggeblieben ist also eine Nominalgruppe im Akkusativ (Frage: Das Spiel brachte wen/was? Oder: Wer brachte wen/was?) ABER: es können nicht immer einfach Wörter weggelassen werden. Folgende zum Beispiel nicht: -Artikel und andere Begleiter -vorangestellte Genitive -die abhängigen Wortgruppen bei Präpositionen sowie bei den Satzteilkonjunktionen als und wie. Funktionale Bestimmung: Wenn man Satzglieder funktional bestimm, schafft das eine erste Ordnung. Sie bleibt aber oft „unbefriedigend. So enthält beispielsweise der folgende Satz 3 Nominalgruppen im Nominativ: Dieses Spiel war ein Riesenerfolg, Freunde! Diese Gruppen leisten aber offensichtlich etwas Verschiedenes. Man unterscheidet sie deshalb nach ihrer Funktion. Man kann grundsätzlich 3 Funktionen unterscheiden: 1. Ergänzungen: Subjekt und Objekt 2. Prädikative 3. Adverbialien Ergänzungen: Der Gast gibt dem Kellner ein Trinkgeld. T. Der Gast gibt dem K. des Restaurants ein Der Gast: Subjekt Dem Kellner: Dativobjekt Ein Trinkgeld: Akkusativobjekt Der Gast: Subjekt Dem K. des R.: Dativobjekt Ein Trinkgeld: Akkusativobjekt Im 2. Bsp. bezieht sich „des Restaurants nicht auf das Verb, sondern auf den Kellner. Deswegen ist es ein Genitivattribut. Wir bedürfen deiner Hilfe nicht. Wir: Subjekt Deiner Hilfe: Genitivobjekt Prädikative oder Gleichsetzungsnominativ/-akkusativ: Walter ist ein guter Handwerker. Walter: Subjekt Ein guter Handwerker: Gleichsetzungsnominativ/prädikativer Nominativ Sie nennt ihn einen Schelm. Sie: Subjekt Ihn: Akkusativobjekt Einen Schelm: Gleichsetzungsakkusativ/prädikativer Akkusativ Adverbialien (Sg.: das Adverbiale): Bezieht sich aufs Verb: -bestimmt es genauer -ganzer Satz: Kommentar Bsp.: Eines Tages werden wir und treffen. Eines Tages: Adverbiale der Zeit (wann?) Wir: Subjekt Dort steht eine Tanne. Dort: Adverbiale des Ortes (wo?) Eine Tanne: Subjekt Eilenden Schrittes geht sie über den Platz. Adverbiale der Art und Weise (wie?) Offensichtlich hast du nicht gelernt. Adverbiale (Kommentar) Inhaltliche Bestimmung: Nominalgruppen können im Kern nicht nur ein Nomen, sondern auch einen Nominalisierung oder einen Stellvertreter, ein Pronomen, haben: Daniela hasst langes Warten. Langes Warten nominalisierter Infinitiv Hier ein Demonstrativpronomen als Kern: Daniela hasst das. Weiteres zu den Nominalgruppen siehe im Duden S.343-360 Adjektiv- und Partizipgruppen liegen relativ nahe beieinander, deshalb legt man oft nicht so viel Wert auf eine genaue Unterscheidung. Kern einer Adverbgruppe ist – logisch ein Adverb. Meistens bestehen Adverbgruppen nur aus dem Kern: Sie sind hier. Er ist doch gekommen. Links befindet sich ein grosser Anbau. Er hat krankheitshalber gefehlt. Vielleicht geht das so. Beispiel für eine etwas umfangreichere Adverbgruppe: Der Drachen flog ganz weit oben. Bei einer Präpositionalgruppe ist – auch logisch eine Präposition der Kern. Von einer Präpositionalgruppe hängt immer eine Wortgruppe ab, bei welcher es sich um eine besondere Art von Gliedteil handelt, die aber NIE im Nominativ steht. Weiteres siehe Duden S. 363! Die Präpositionalgruppen lassen sich in folgende Untergruppen aufteilen: -Präpositionalobjekt -prädikative PG -adverbiale PG Die Präposition von Präpositionalobjekten ist nicht frei wählbar. Sie ist vom Verb oder vom Adjektiv bestimmt, von dem das Präpositionalobjekt abhängt, z.B.: sich nicht kümmern um. Satzglieder, die formal als PG und funktional als Prädikativ zu bestimmen sind, bezeichnet man als prädikative PG. Sie beziehen sich je nachdem auf das Subjekt oder das Akkusativobjekt. Bsp.: Sie wurde zu einer gesuchten Fachfrau. Hier steht die prädikative PG einem prädikativen Nominativ nahe. Gleicher Satz mit präd.Nom.: Sie wurde eine gesuchte Fachfrau. Weitere Beispiele: Sie wurde zur Vorsitzenden gewählt. Die Agentin verwandelte sich in eine unauffällige Touristin. Der Arzt erklärte den Patienten für gesund. Adverbiale PG hängen normalerweise loser mit den übrigen Elementen des Satzes zusammen. Das zeigt sich darin, dass die Präp. Bei adverbialen Pgs frei wählbar ist: stehen. Auf der Brücke standen Fischer. Unter der Brücke standen Fischer. Neben der Brücke standen Fischer. Vor der Brücke standen Fischer. Konjunktionalgruppen sind nur solche, wenn sie mit den Konjunktionen als oder wie gebildet werden. Wichtige Begriffe: Satzverbindung: Satzgefüge: Eingeschobene Hauptsätze: Stirnsatz: Kernsatz: Spannsatz: Äusserungsart: Intonation: Modus: Imperativ) Einleitewort: oder Interrogativpronomen: Imperativsatz: Personalform: Infinite Verbform: Satzgefüge: Nebensatz mehrere Hauptsätze HauptsatzNebensatz Parenthese Verb an 1. Stelle (davor kann nur noch eine Konjunktion) Verb an 2. Stelle, davor können Satzglieder, Nebensätze, Konjunktionen stehen (siehe Heft). Personalform an letzter Stelle. Danach können noch ein Infinitiv und ein Modalverb auftreten. Wenn man mit einem einzigen Satz Mehreres aussagen kann Betonung Die Aussageweise des Verbs (Indikativ, Konjunktiv II, Wörter, die einen Satz einleiten, meist sind es Konjunktionen Pronomen Fragepronomen Befehlssatz Finite Verbform (Konjugierte Verbform) Grundform eines Verbs Ein zusammengesetzter Satz enthält mindestens einen (sie haben immer auch noch einen Hauptsatz bei sich, es gibt keine Satzverbindung/Satzreihe: Satzwertiger Ausdruck: Satzgefüge, die nur aus einem Nebensatz bestehen) Ein zusammengesetzter Satz enthält „ oder mehr Hauptsätze Eine sprachliche Einheit, die funktional einem ausgebauten Satz nahe kommt, formal aber in irgendeiner Weise von diesem abweicht. Teilsatzwertiger Ausdruck: Absoluter Nominativ: Sie enthalten nur eine infinite Verbform statt einer Personalform. Bsp.: Bitte abends Fenster schliessen! Nicht hinauslehnen Bsp.: Gut möglich, dass das Auto repariert werden kann. Hauptbestandteil dieser Fügung ist eine Nominalgr. im Nom. Sie wird meist an einen anderen Satz angehängt, in ihn eingefügt Absoluter Akkusativ: habend, Prädikat: Einteiliges Prädikat: Verbzusätze: oder kann auch vorangestellt sein. Bsp.: Sie stimmten ab, ein faires Verhalten. Eine nachahmenswerte Idee: Diese Ladenkette verteilt. (weitere Beispiele siehe Duden S.313/314 oben) Er lässt sich auf eine Partizipgruppe mit einem Partizip wie haltend, tragend zurückführen. Bsp.: Den Stock in der Hand (haltend), kam er auf mich zu. Verbform in einem Satz Der Kamin qualmt. (Ein Wort, dazu gehören aber auch Der Rauch steigt auf. Hier ist steigen das Verb und auf der Verbzusatz.) Mehrteiliges Prädikat: mindestens und Partizipgruppen: Mehrteilige Präd. haben ausser einer Personalform immer eine infinite Verbform: einen Infinitiv oder ein PartizipII Bsp.: Sie wird schon kommen. Satzwertige InfinitvHier bildet ein Infinitiv oder ein Partizip (eins oder zwei) den Kern. Bsp.: Um diesen Fall zu lösen, bediente sich der Detektiv eines Tricks. (satzwertige Infinitve sind am zu zu erkennen.) Nachdenkend über die Menschen, kam er zu einer Theorie. Von allen Seiten bestürmt, gab er schliesslich seinen Widerstand auf. Satzklammer: Wenn in einem Satz eine Personalform und weitere verbale Teile zusammen vorkommen, bilden sie eine Art Klammer, eine Satzklammer. Bsp.: - Satzglied Personalform Satzglied(er) übrige Verbform Satzklammer – PF – Satzglied(er) – üV Satzklammer Ausklammerung: Von einer Ausklammerung spricht man, wenn Teile des Satzes nach dem 2. Teil der Satzklammer stehen. In folgendem Beispiel ist die Ausklammerung mit gekennzeichnet: – Satzglied – PF – Satzglied(er) – üV – Satzklammer Gleichsetzungsnominativ: Gleichsetzungsakkusativ: Anredenominativ: Wenn man ein Gleichheitszeichen zwischen zwei NG im Nom. machen kann. Wenn man ein Gleichheitszeichen zwischen zwei NG im Akk. machen kann. Bsp.: Hannah, du hast gewonnen!