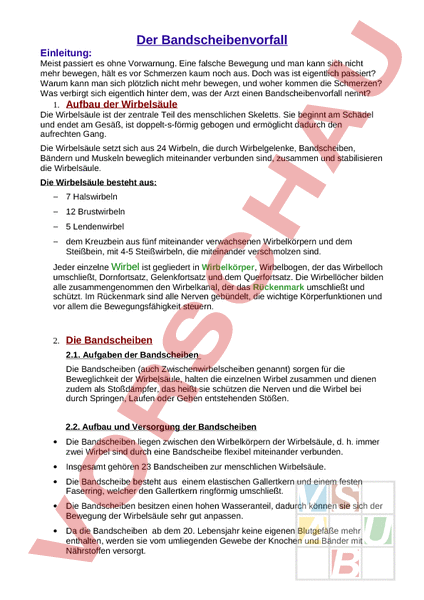Arbeitsblatt: Der Bandscheibenvorfall
Material-Details
Biologie Gesundheit krank Bandscheibe Vorfall Therapie Wirbelsäule Gelenke Nerven, Schmerzen Gymnastik Operation Rückenmark Versorgung Wirbelkörper Brust Lendenwirbel Hals
Biologie
Anatomie / Physiologie
9. Schuljahr
2 Seiten
Statistik
68635
1691
10
01.10.2010
Autor/in
Silvia Sauter
Land: Deutschland
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Der Bandscheibenvorfall Einleitung: Meist passiert es ohne Vorwarnung. Eine falsche Bewegung und man kann sich nicht mehr bewegen, hält es vor Schmerzen kaum noch aus. Doch was ist eigentlich passiert? Warum kann man sich plötzlich nicht mehr bewegen, und woher kommen die Schmerzen? Was verbirgt sich eigentlich hinter dem, was der Arzt einen Bandscheibenvorfall nennt? 1. Aufbau der Wirbelsäule Die Wirbelsäule ist der zentrale Teil des menschlichen Skeletts. Sie beginnt am Schädel und endet am Gesäß, ist doppelt-s-förmig gebogen und ermöglicht dadurch den aufrechten Gang. Die Wirbelsäule setzt sich aus 24 Wirbeln, die durch Wirbelgelenke, Bandscheiben, Bändern und Muskeln beweglich miteinander verbunden sind, zusammen und stabilisieren die Wirbelsäule. Die Wirbelsäule besteht aus: 7 Halswirbeln 12 Brustwirbeln 5 Lendenwirbel dem Kreuzbein aus fünf miteinander verwachsenen Wirbelkörpern und dem Steißbein, mit 4-5 Steißwirbeln, die miteinander verschmolzen sind. Jeder einzelne Wirbel ist gegliedert in Wirbelkörper, Wirbelbogen, der das Wirbelloch umschließt, Dornfortsatz, Gelenkfortsatz und dem Querfortsatz. Die Wirbellöcher bilden alle zusammengenommen den Wirbelkanal, der das Rückenmark umschließt und schützt. Im Rückenmark sind alle Nerven gebündelt, die wichtige Körperfunktionen und vor allem die Bewegungsfähigkeit steuern. 2. Die Bandscheiben 2.1. Aufgaben der Bandscheiben Die Bandscheiben (auch Zwischenwirbelscheiben genannt) sorgen für die Beweglichkeit der Wirbelsäule, halten die einzelnen Wirbel zusammen und dienen zudem als Stoßdämpfer, das heißt sie schützen die Nerven und die Wirbel bei durch Springen, Laufen oder Gehen entstehenden Stößen. 2.2. Aufbau und Versorgung der Bandscheiben • Die Bandscheiben liegen zwischen den Wirbelkörpern der Wirbelsäule, d. h. immer zwei Wirbel sind durch eine Bandscheibe flexibel miteinander verbunden. • Insgesamt gehören 23 Bandscheiben zur menschlichen Wirbelsäule. • Die Bandscheibe besteht aus einem elastischen Gallertkern und einem festen Faserring, welcher den Gallertkern ringförmig umschließt. • Die Bandscheiben besitzen einen hohen Wasseranteil, dadurch können sie sich der Bewegung der Wirbelsäule sehr gut anpassen. • Da die Bandscheiben ab dem 20. Lebensjahr keine eigenen Blutgefäße mehr enthalten, werden sie vom umliegenden Gewebe der Knochen und Bänder mit Nährstoffen versorgt. • Die Nährstoffversorgung (Stoffwechsel) der Bandscheiben kommt durch den Druck der Be- und Entlastung auf die Bandscheiben zustande wie z. B. durch Gehen. • Durch die Belastungen, der die Bandscheiben im Laufe eines Tages ausgesetzt sind, werden sie zusammengedrückt und verlieren Flüssigkeit. So ist es zu erklären, dass ein Mensch am Abend ein oder zwei Zentimeter kleiner ist als am Morgen. Denn über Nacht haben die Bandscheiben die Möglichkeit, sich durch die Einlagerung verschiedener Stoffe, darunter auch viel Wasser, wieder zu erholen. 3. Der Bandscheibenvorfall Durch ständige einseitige Belastungen, falsches Sitzen und Bewegungsmangel können Haltungsschäden (wie Wirbelsäulenverkrümmungen) entstehen,die zu ungleichmäßigen Belastungen der Bandscheiben und Wirbelbänder führen. Durch diese Falschbelastungen oder auch durch altersbedingten Verschleiß kann es zum Bandscheibenvorfall kommen. Zum Bandscheibenvorfall kommt es dann, wenn der Gallertkern aus dem Faserring der Bandscheibe austritt. Der ausgetretene Gallertkern übt verstärkten Druck auf die Nerven des Rückenmarks aus und verursacht starke Schmerzen. Einzelne Nerven können auch vollständig eingeklemmt sein. Am häufigsten ereignen sich Bandscheibenvorfälle zwischen dem vierten und fünften Lendenwirbel sowie zwischen dem fünften Lendenwirbel und dem Kreuzbein. 4. Diagnose Wichtig für die Diagnose sind Leitsymptome wie Schmerzen (die bis in die Zehen oder in die Finger ziehen können), Gefühlsstörungen (wie Taubheitsgefühle oder Kribbeln im Bein),Muskelschwächen und Lähmungserscheinungen. Bei Verdacht auf Bandscheibenvorfall werden bildgebende Verfahren (Röntgen, Computertomographie (CT), Magnetresonanztomografie (MRT) eingesetzt, um eine genaue Diagnose erstellen zu können, besonders vor Operationen. 5. Therapiemaßnahmen 1. Konservative Therapieansätze Zu Beginn des Bandscheibenvorfalls werden Schmerzmittel eingesetzt, um die Bewegungsfähigkeit des Patienten wiederherzustellen. Mit Medikamenten und Physiotherapie (wie Krankengymnastik, Massagen .) wird dann der Bandscheibenvorfall behandelt. An diese Therapie schließen sich Maßnahmen an, deren Ziel es ist, die Rücken- und Bauchmuskulatur zu kräftigen und den Ursachen (wie Fehlhaltung und Überbelastung) entgegenzuwirken (z. B. Rückenschulkurse) 2. Operative Maßnahmen Kommt es infolge des Bandscheibenvorfalls zu Lähmungserscheinungen oder Blasenoder Darmfunktionsstörungen, werden operative Maßnahmen in Betracht gezogen. Quellenangaben: www.curado.de; www.wikipedia.de; Biologiebuch