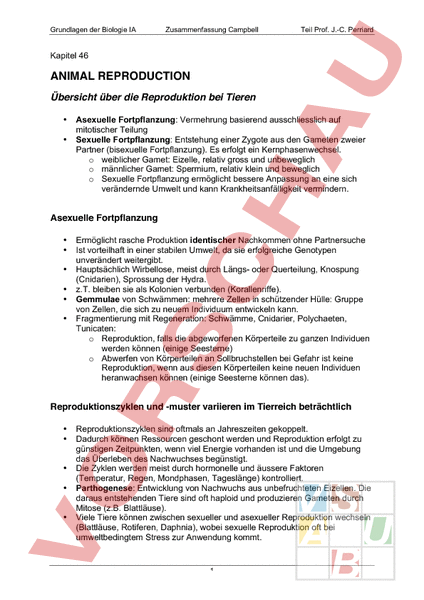Arbeitsblatt: Einblick in folgende Themen - mit vielen Bildern unterstützt
Material-Details
Reproduktionssysteme,
Embryonalentwicklung,
Nervensystem,
sensorische und motorische Systeme,
Sinneswahrnehmung und Verarbeitung
Biologie
Gemischte Themen
12. Schuljahr
87 Seiten
Statistik
68884
825
2
06.10.2010
Autor/in
Lea Pessina
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Grundlagen der Biologie IA Zusammenfassung Campbell Teil Prof. J.-C. Perriard Kapitel 46 ANIMAL REPRODUCTION Übersicht über die Reproduktion bei Tieren • • Asexuelle Fortpflanzung: Vermehrung basierend ausschliesslich auf mitotischer Teilung Sexuelle Fortpflanzung: Entstehung einer Zygote aus den Gameten zweier Partner (bisexuelle Fortpflanzung). Es erfolgt ein Kernphasenwechsel. weiblicher Gamet: Eizelle, relativ gross und unbeweglich männlicher Gamet: Spermium, relativ klein und beweglich Sexuelle Fortpflanzung ermöglicht bessere Anpassung an eine sich verändernde Umwelt und kann Krankheitsanfälligkeit vermindern. Asexuelle Fortpflanzung • • • • • • Ermöglicht rasche Produktion identischer Nachkommen ohne Partnersuche Ist vorteilhaft in einer stabilen Umwelt, da sie erfolgreiche Genotypen unverändert weitergibt. Hauptsächlich Wirbellose, meist durch Längs- oder Querteilung, Knospung (Cnidarien), Sprossung der Hydra. z.T. bleiben sie als Kolonien verbunden (Korallenriffe). Gemmulae von Schwämmen: mehrere Zellen in schützender Hülle: Gruppe von Zellen, die sich zu neuem Individuum entwickeln kann. Fragmentierung mit Regeneration: Schwämme, Cnidarier, Polychaeten, Tunicaten: Reproduktion, falls die abgeworfenen Körperteile zu ganzen Individuen werden können (einige Seesterne) Abwerfen von Körperteilen an Sollbruchstellen bei Gefahr ist keine Reproduktion, wenn aus diesen Körperteilen keine neuen Individuen heranwachsen können (einige Seesterne können das). Reproduktionszyklen und -muster variieren im Tierreich beträchtlich • • • • • Reproduktionszyklen sind oftmals an Jahreszeiten gekoppelt. Dadurch können Ressourcen geschont werden und Reproduktion erfolgt zu günstigen Zeitpunkten, wenn viel Energie vorhanden ist und die Umgebung das Überleben des Nachwuchses begünstigt. Die Zyklen werden meist durch hormonelle und äussere Faktoren (Temperatur, Regen, Mondphasen, Tageslänge) kontrolliert. Parthogenese: Entwicklung von Nachwuchs aus unbefruchteten Eizellen. Die daraus entstehenden Tiere sind oft haploid und produzieren Gameten durch Mitose (z.B. Blattläuse). Viele Tiere können zwischen sexueller und asexueller Reproduktion wechseln (Blattläuse, Rotiferen, Daphnia), wobei sexuelle Reproduktion oft bei umweltbedingtem Stress zur Anwendung kommt. 1 Grundlagen der Biologie IA • • • Zusammenfassung Campbell Teil Prof. J.-C. Perriard Bienen: Drohnen werden parthogenetisch erzeugt, Arbeiterinnen aus befruchteten Eizellen. Einige Fische, Amphibien und Echsen vermehren sich über Parthogenese, wobei dort die Chromosomen nach der Meiose wieder verdoppelt werden, um „Zyogten zu formen. Einige Eidechsen reproduzieren nur durch Parthogenese, wobei es keine Männchen gibt, sondern die Weibchen männliches Verhalten imitieren und damit den Eisprung auslösen. Abbildung 1 – Reproduktionszyklus einer sich parthogenetisch fortpflanzenden Eidechsenart, in der die Weibchen sich je nach Hormonkonzentration wie Männchen verhalten. • • • Hermaphroditismus (Zwittrigkeit): Jedes Individuum hat sowohl männliche als auch weibliche Geschlechtsorgane, die meisten müssen jedoch sich trotzdem mit einem anderen Individdum paaren. Resultiert in doppelt so vielen Nachkommen, als wenn nur ein Individuum Nachwuchs zur Welt bringen könnte, und jeder angetroffene Artgenosse ist Sexualpartner (Plattwürmer). Simultanzwitter: Gleichzeitig Männchen und Weibchen (Regenwürmer, Landschnecken). Konsekutivzwitter wechseln im Verlaufe ihres Lebens das Geschlecht. Protogyn: Zuerst Weiblich Protandrisch: Zuerst Männlich Bei diesen hängt das Geschlecht manchmal von Alter und Grösse ab. Wrassen: In Harems. Stirbt das Männchen, wird das grösste Weibchen zum Männchen. Wahrscheinlich optimieren diese Tiere ihre Reproduktion, indem sie, während sie klein sind, und als Männchen keine Chance zur Reproduktion hätten, als Weibchen agieren. 2 Grundlagen der Biologie IA Zusammenfassung Campbell Teil Prof. J.-C. Perriard Es gibt auch das Umgekehrte. Dann erhöht Grösse die Fitness des Weibchens mehr als die des Männchens (z.B. durch Produktion von mehr Eizellen bei Austern). Mechanismen der sexuellen Reproduktion • • • • • Äussere Befruchtung und innere Befruchtung (im Genitaltrakt des Weibchens) werden unterschieden. Äussere Befruchtung kann fast nur in feuchten Habitaten geschehen, da sonst die Eizellen austrocknen. Balzverhalten (z.B. Frösche) verbessert die Chancen, dass sich die Gameten treffen und erlaubt eine gewisse Partnerselektion. Pheromone sind chemische Signale, die durch einen Organismus freigesetzt werden und andere Individuen derselben Spezies im Verhalten beeinflussen. Sie sind in winzigen Mengen wirksam und dienen oft zur Anlockung von Geschlechtspartnern. Bei innerer Befruchtung (Kopulation – Besamung – Befruchtung) sind weniger Gameten notwendig und der Embryo ist besser geschützt (im Mutterleib, im Beutel oder durch Eierschale). Oft ist auch die Brutpflege ausführlicher. Innere Befruchtung benötigt kooperatives Verhalten, welches zur Kopulation führt, sowie anatomische Apparaturen wie Kopulationsorgane und Organe zum Transport der Spermien zum reifen Ei. Abbildung 2 – Fortpflanzungsorgane eines hermaphroditen Platyhelminten (Flachwurm). 3 Grundlagen der Biologie IA Zusammenfassung Campbell Teil Prof. J.-C. Perriard Reproduktionssysteme • • • • Gonaden: Organe, die Gameten bilden. Auch sehr einfache Organismen wie Plattwürmer können sehr komplexe Befruchtungsorgane haben: Spermien aus den Hoden wandern durch ein Paar von Kanälen (vasa efferentia) in einen einzelnen Kanal (vas deferens) und werden im seminal vesicle aufbewahrt. Bei der Kopulation werden die Spermien durch die Genitalpore ins weibliche System ejakuliert und bewegen sich durch den Uterus ins seminal receptacle. Eizellen aus den Ovarien wandern ins Oviduct, wo sie befruchtet werden und durch yolk glands mit einer harten Schale überzogen werden. Vom Oviduct aus wandern die Eier in den Uterus, von wo sie durch die Genitalpore freigesetzt werden. Sind Zwitter; Entwicklung der Larven im Leib des Elters. Polychaeten haben sehr einfache Geschlechtsorgane ohne Gonaden. Gameten entstehen aus Zellen der Coelomwand, und in einigen Fällen zerpsprengen die wachsenden Eier einfach das Muttertier. Insekten sind getrenntgeschlechtlich. Männchen: Spermien werden in paarigen Hoden gebildet und durch gewundenen Gang in eine Samenblase geführt, wo sie gespeichert werden. Bei der Kopulation werden sie in den Geschlechtstrakt des Weibchens entlassen. Weibchen: Paarige Ovarien bilden Eizellen, die durch Gänge in die Vagina geführt werden, wo sie befruchtet werden. Oft haben die Weibchen Spermateca (receptaculum seminaris) in denen Spermien gelagert werden können. Bei Bienen entstehen Männchen aus unbefruchteten Eiern. Abbildung 3 – Reproduktionssysteme der Insekten. Einige Insekten besitzen claspers, die das Weibchen während der Kopulation festhalten. 4 Grundlagen der Biologie IA • • • Zusammenfassung Campbell Teil Prof. J.-C. Perriard Ausser Säugetieren haben alle Vertebraten eine Kloake, in die sowohl das Verdauungs-, das Exkretions- und das Reproduktionssystem münden. Bei Säugetieren haben Männchen noch eine gemeinsame Öffnug für Exkretions- und Reproduktionssystem, bei Weibchen sind sie alle getrennt. Bei einigen niederen Säugetieren kommt es vor, dass noch Eier gelegt werden (Platypus) oder die zweite Hälfte der fötalen Reifung im Beutel geschieht (Känguru). Geschlechtsbestimmung • • Das Y-Chromosom des Mannes beim Menschen ist genetischer Schrott, das einzig wichtige ist das sry-Gen. Es kommt eine Vielzahl von anderen Systemen als dem XY-System vor. Abbildung 4 – Alternative Wege der Geschlechtsbestimmung. • • • Insekten: XX Weibchen, X0 Männchen Vögel: ZW Weibchen, ZZ Männchen Bienen und Ameisen: Haploide Individuen werden zu Männchen. Sie haben keine Väter. 5 Grundlagen der Biologie IA • • • Zusammenfassung Campbell Teil Prof. J.-C. Perriard Drosophila: XX und XXY sind weibchen, X0 ein infertiles Männchen, XY ein fertiles Männchen. Mensch: X0 Turner-Syndrom, XXY Klinefelter-Syndrom Frösche besitzen eine zwittrige Gonadenanlage. Je nach An- oder Abwesenheit von sry wandern Urkeimzellen ein. Es bilden sich Männchen oder Weibchen. Reproduktion der Säugetiere Anatomie des Mannes Abbildung 5 – Reproduktionsorgane des Mannes. • • • • • • Innere Genitalorgane: Gonaden (Gameten und Hormonproduktion), accessory Glands (Flüssigkeiten für Spermienbewegung) und Kanäle, die nach aussen münden. Äussere Genitalorgane: Skrotum, Penis. Hoden: Viele gewundene Gänge (seminiferous tubules), in denen Spermien entstehen, umgeben von Bindegewebe. Leydig-Zellen produzieren Androgene (Testosteron). Da das Körperinnere für die Spermienproduktion zu warm ist, sind die Hoden im Hodensack ausserhalb des Körpers lokalisiert (2C kühler). Einige Nagetiere können die Hoden in den Körper zurückziehen. Wenn die Körpertemperatur einer Art niedrig genug ist, können die Hoden auch immer im Inneren lokalisiert sein. Wenn sie den Hoden verlassen, gelangen die Spermien in die Epididymis (Nebenhoden). Während der 20 Tage im Nebenhoden werden die Spermien beweglich und fruchtbar. Bei der Ejakulation werden die Spermien durch den Samenleiter (vas deferens) getrieben. Dieser mündet zusammen mit dem seminal vesicle in einem kurzen ejaculatory duct, welcher wiederum in die Urethrea mündet. 6 Grundlagen der Biologie IA • • • • • Zusammenfassung Campbell Teil Prof. J.-C. Perriard Von akzessorischen Drüsen (seminal vesicle, Prostata, bulbourethral gland) abgegebene Sekrete machen die Spermien beweglich. Die ejakultierte Flüssigkeit (ca. 60% aus seminal vesicle) heisst Sperma. Sekret der Samenbläschen ist leicht basisch, enthält Fructose, coagulierendes Enzym, Ascorbinsäure und Prostaglandine. Die Prostata ist die grösste der drei akzessorischen Drüsen. Ihr Sekret enthält anticoagulierende Enzyme und Citrat. Prostatakrebs ist häufig. Die bulbourethralen Drüsen sind klein, paarig, liegen etwas unterhalb der Prostata und sondern unmittelbar vor der Ejakulation basische Flüssigkeit ab, die Harn neutralisiert. Abbildung 6 – Reproduktionsorgane des Mannes. • • • • Prostaglandine fördern Kontraktion des Uterusmuskels der Frau, was die Spermien nach oben transportiert. Der Penis besteht aus einem schwammigen Schwellkörper, der sich mit arteriellem Blut füllt. Erektion ist wichtig für das Einführe in die Vagina. Einige Säugetiere besitzen ein Baculum (Penisknochen), der die Versteifung des Penis unterstützt. Die Eichel (glans penis) hat sehr dünne Haut und ist sehr empfindlich. Bedeckt durch Vorhaut: Prepuce/Präputium. 7 Grundlagen der Biologie IA Zusammenfassung Campbell Teil Prof. J.-C. Perriard Anatomie der Frau • • • • • • • • • • • • • Äussere Genitalien: Klitoris und 2 Paar Schamlippen. Ovarien in der Bauchhöhle durch Mesenterium neben Uterus fixiert. Jedes Ovar enthält zahlreiche Follikel (Eizellen Follikelzellen). Normalerweise reift von Pubertät bis Menopause alle 28 Tage ein Follikel heran. Follikelzellen prodzuieren Östrogene. Bei der Ovulation wird die Eizelle durch erhöhten Druck aus dem Follikel gespickt. Der Follikelrest wird zum Corpus luteum, der Östrogen und Progesteron produziert. Die Eizelle wird in der Nähe des Oviductes in die Bauchhöhle entlassen. Durch Cilien im Epithelium, das den Oviduct auskleidet, wird die Eizelle in einem Flüssigkeitsstrom vorwärtsgetrieben. Uterus: Das Endometrium (innere Auskleidung) ist stark durchblutet. Der Cervix mündet in die Vagina. Die Vaginalöffnung ist vom Hymen bedeckt, das irgendwann zerreisst. Das Vestibulum (Ort, wo Vaginalöffnung und Harnleiter münden) ist von labia minora und labia majora flankiert und geschützt. Am vorderen Rand sitzt die Klitoris. Bartholin-Drüse sondert Schleim ab, was den Geschlechtsverkehr erleichtert. Milchdrüsen sind in beiden Geschlechter vorhanden, funktionieren aber nur bei Frauen. Bestehen aus kleinen Säcken von epithelialem Gewebe. Abbildung 7 – Reproduktionsorgane der Frau. 8 Grundlagen der Biologie IA Zusammenfassung Campbell Teil Prof. J.-C. Perriard Abbildung 8 – Uterus und damit verbundene Reproduktionsorgane der Frau. Sexueller Reaktionszyklus • • • • Hat ein darunterliegendes physiologisches Schema. Vasokongestion: Bestimmte Gewebe füllen sich mit Blut. Myotonie: Muskeltonus erhöht sich, z.T. rhythmische Kontraktionen. 4 Phasen: Erregung Vorbereitung auf Coitus, Erektion Plateau Vasokongestion der äusseren Vagina, Expansion des inneren Teils, Entstehung einer kleinen Vertiefung am Ende der Vagina Orgasmus rhythmische unwillentliche Kontraktion der Geschlechtsteile; Mann: Emission und Ejakulation von Sperma; Frau: Kontraktion von Uterus und Vagina Rückbildung alles geht auf normale Grösse zurück Spermatogenese, Oogenese • • • • • • Spermatogenese ist ein permanenter Prozess, findet in den seminiferous tubules im Hoden statt. Eine grosse Anzahl Zellen wird verbraucht. Spermatoginien (stammen von eingewanderten Urkeimzellen ab) befinden sich in der Peripherie der Kanälchen. Das sich entwickelnde Spermium bewegt sich nach innen, während Meiose und Differenzierung stattfinden. Aufbau: Akrosom hilft beim Eindringen in die Eizelle, Mitochondrien produzieren Energie zur Bewegung der Flagelle. Oogenese produziert reife, undbefruchtete Eizellen. Nur ein kleiner Teil der theoretisch vorhandenen Eizellen wird verbraucht. Während der Embryonalentwicklung durchlaufen Oogonien Mitosen und beginnen mit der Meiose. Diese wird in der Prophase unterbrochen (primäre Oocyten). 9 Grundlagen der Biologie IA Zusammenfassung Campbell Teil Prof. J.-C. Perriard Abbildung 9 – Spermatogenese. Die Abbildung verbindet die Meiosestadien mit den mikroskopischen Strukturen in den Hoden. Primordiale Stammzellen differenzieren in Spermatogonien, aus denen Spermien entstehen. Der ganze Prozess dauert etwa 70 Tage. • • • In der Pubertät stimuliert FSH periodisch die Vollendung der Meiose und den Beginn der Meiose II in einem Follikel, die Meiose wird wieder unterbrochen (sekundäre Oocyte). Beim Eisprung freigesetzte Oocyte wird die Meiose nicht gleich fortgesetzt. Erst das Eindringen des Spermiums löst die Vollendung der Meiose aus. Oogenese ist dann komplett. 3 Unterschiede zu Spermatogenese: Cytokinese ist ungleich, fast alles Cytoplasma wird in einer Zelle lokalisiert, Polkörperchen degenerieren. 10 Grundlagen der Biologie IA Zusammenfassung Campbell Teil Prof. J.-C. Perriard Abbildung 10 – Struktur eines menschlichen Spermiums. Die Geissel hat den typischen 92-Aufbau der Eukaryotengeissel. Bei der Geburt einer Frau enthält die Ovarie bereits alle primären Oocyten, die sie je haben wird. Oogenese hat „Pausen. Abbildung 11 – Oogenese. Im realen Eierstock bleibt das Follikel stets am selben Platz stehen, wenn es, stimuliert durch FSH, den Zyklus durchläuft 11 Grundlagen der Biologie IA Zusammenfassung Campbell Teil Prof. J.-C. Perriard Abbildung 12 – Oogenese. Wichtig ist, dass die Cytokinese jeweils zwei verschieden grosse Zellen hervorbringt, von denen nur eine ausreift, während die andere verkümmert. Hormonelle Regulation beim Mann • • • Androgene (wichtigstes: Testosteron) werden v.a. durch interstitielle Zellen (Leydig-Zellen) in den Hoden gebildet. Führen zu primären und sekundären Geschechtsmerkmalen. Primär: Vasa deferentia, andere Kanäle, Penis, Skrotum, Spermienproduktion Sekundär: Stimme, Haar, Muskelwachstum, Verhalten (Aggressivität, Vogelgesang, Froschquaken) Kontrolle wird von Hormonen von Hypothalamus und Adenohypophyse ausgeübt. LH und FSH werden durch GnRH (Gonadotropin releasing hormone) aus dem Hyothalamus reguliert. Die Konzentration dieser Hormone im Blut wird durch Androgene reguliert, und GnRH zusätzlich auch durch FSH und LH. 12 Grundlagen der Biologie IA • • Zusammenfassung Campbell Teil Prof. J.-C. Perriard LH bewirkt über die Stimulation der Leydig-Zellen, die Androgene produzieren, die Stimulation der Spermienproduktion. FSH wirkt direkt auf die seminiferous tubules, was die Spermienproduktion ebenfalls erhöht (Wirkung bei der Frau ist offensichtlich ganz anders). Abbildung 13 – Hormonelle Kontrolle der Hoden. LH und FSH werden durch GnRH aus dem Hyothalamus reguliert. Androgenproduktion in Leydig-Zellen. Hormonelle Regulation bei der Frau • • Ziemlich komplex, cyclisch Säugetiere: Menstruationszyklen (Primaten, Mensch) Endometrium wird abgeschieden und ausgestossen, falls keine Schwangerschaft eintritt Östrische Zyklen (Rest): Endometrium wird von der Gebärmutter reabsorbiert keine Blutung stärkere Verhaltensänderungen Saisonale Einflüsse grösser Kopulationsfähig durch Veränderungen der Vagina nur in der Periode um die Ovulation herum (Östrus, Hitze) 13 Grundlagen der Biologie IA • • Zusammenfassung Campbell Teil Prof. J.-C. Perriard Der Menstruationszyklus beginnt nach der Verdickung der Gebärmutterschleimhaut (Endometrium) Tag 1 ist der erste Tag der Menstruation (menstrual flow phase) hält einige Tage an. Abbildung 14 – Der reproduktive Zyklus der Frau. Die Luteale Phase dauert normalerweise ca. 15 Tage. • • • • • Danach Regeneration der Uterusschleimhaut: Proliferationsphase. Während der Sekretorischen Phase erfolgt die Entwicklung von Drüsen, die glykogenreiche Flüssigkeit abgeben, Verdickung des Endometriums und Blutgefässbildung. Danach beginnt der Zyklus von neuem. Parallel dazu läuft der ovarian cycle. Er beginnt mit der Follikelphase, wobei mehrere Follikel zu reifen beginnen. 14 Grundlagen der Biologie IA • • • • • • • • • Zusammenfassung Campbell Teil Prof. J.-C. Perriard Nur einer davon reift vollständig aus, die Oocyte beginnt zu wachsen und die Follikelwand verdickt sich, es bildet sich eine interne flüssigkeitsgefüllte Höhle. Bei der Ovulation (Ende der Follikelphase) platzt der Follikel und gibt die Eizelle frei. Sie ist von der Corona umhüllt, die das Spermium durchringen muss (Selektion). Der Rest des Follikels wandelt sich zum Corpus luteum um, dessen endokrine Zellen während der lutealen Phase weibliche Hormone abgeben. Das Wachstum des Follikels ist synchronisiert mit der Vorbereitung des Endometriums für die Einnistung eines Embryos. 5 Hormone koordinieren die beiden Zyklen: Gonadotropin releasing hormone (GnRH) aus dem Hypothalamus Follikel stimulierendes Hormon (FSH) aus der Adenohypophyse (?) Lutheinisierendes Hormon (LH) aus der Adenohypophyse Östrogene aus Ovarien Progesteron aus Ovarien Follikelphase Hypophyse sekretiert geringe Mengen von FSH und LH auf Grund von GnRH-Stimulation durch den Hypothalamus Zellen der unreifen Follikel haben nun nur Rezeptoren für FSH, das das Follikelwachstum stimuliert Der wachsende Follikel sekretiert anfänglich wenig Östrogen, das die Sekretion von Hypophysenhormonen hemmt und FSH/LH auf niedrigem Stand hält. Steigende Östrogensekretion durch den wachsenden Follikel verändert die Verhältnisse radikal: FSH und LH werden durch GnRH-Stimulation verstärkt ausgeschüttet. Mittlerweilen haben die Follikel LH-Rezeptoren und werden zur endgültigen Reifung stimuliert. Ca. 1 Tag später erfolgt die Ovulation (positive Feedback zwischen Follikel und LH!). Nach der Ovulation stimuliert LH die Bildung des corpus luteum aus dem Follikel, der nun Östrogen und Progesteron sekretiert. Diese beiden Hormone inhibieren die Sekretion von LH und FSH (negative feedback). Desintegration des corpus luteum nach Höhepunkt bei 10 Tagen. Östrogen und Progesteron verschwinden fast. Die Inhibition von FSH fällt weg, und neue Follikel beginnen zu reifen. Synchronisierung mit dem Menstruationszyklus: Östrogene verursachen Verdickung des Endometriums: Follikelphase ist korreliert mit der Proliferation Phase des Uterus. Vor der Ovulation ist der Uterus für die Aufnahme eines Embryos bereit. Nach dem Eisprung stimulieren Östrogen und Progesteron die weitere Ausbildung des Endometrium. Der luteale Zyklus ist also mit der sekretorischen Phase korreliert. Bei der desintegration des Gelbkörpers fallen Östrogen und Progesteron weg, es kommt zur Blutung. Östrogene bilden auch die sekundären Geschlechtsmerkmale der Frau aus (Brüste, Fetteinlagerung, Wassereinlagerung, Calciummetabolismus). Menopause: Menstruation hört auf, da die Ovarien nicht mehr auf Gonadotropine reagieren und die Östrogenproduktion zurückgeht. Evolutiver Grund: Fürsorge für Enkelkinder erhöht Fitness der „alten Frau. 15 Grundlagen der Biologie IA Zusammenfassung Campbell Teil Prof. J.-C. Perriard Embryonalentwicklung • • • Schwangerschaft (Gestation) ist das Tragen einer oder mehrerer Embryonen im Uterus. Empfängnis ist die Befruchtung der Eizelle durch ein Spermium. Beim Menschen: Schwangerschaft: 40 Wochen/266 Tage (allg.: grössere Organismen haben längere Schwangerschaften). Abbildung 15 – Bildung der Zygote. 1: Ovulation setzt eine sekundäre Oocyte frei. 2: Nach dem Endringen des Spermiums vollendet die Eizelle die Meiose II. Danach erfolgt die Befruchtung (Karyogamie). 3: Furchungsteilungen setzen ein. 4: Das Zellbällchen wird durch Sekrete der OviduktSchleimhaut ernährt. 5: Implantation des Blastocyste 7 Tage nach der Empfängnis. • • • Schwangerschaft wird in drei Trimester aufgeteilt: Trimerster 1 Befruchtung Furchungsteilungen Einnisten nach 3-4 Tagen Entwicklung zur Balstocyste nach 1 Woche Aus auswachsenden extraembryonalen Strukturen und dem Endometrium (welches über die Balstocyste hinwegwächst) entsteht die Placenta (Gasaustausch, Nährstoffzufuhr, Entgiftung). Blut aus der Nabelschnnur wandert durch Arterien zur Placenta und kehrt über die Nabelwehne zur Leber des Embryos zurück. Das 1. Trimester ist auch der Zeitraum der Organogenese. Der Embryo ist sehr empfindlich. Nach 4 Wochen: Herzschlag Nach 8 Wochen: Fast alle Adultstrukturen erkennbar. Der Embryo sekretiert HCG (human chorionic gonadotropin, Schwangerschaftstest!), um Östrogen und Progesteronproduktion der des Gelbkörpers aufrecht zu erhalten und Menstruation zu verhindern. Das Progesteron verursacht Änderungen in der Mutter: Bildung von Mucus im Cervix Wachstum des mütterlichen Teils der Placenta Unterdrückung von Menstruation und Ovulation Trimester 2 Der Fötus ist nun ca. 5 cm lang. 16 Grundlagen der Biologie IA Zusammenfassung Campbell Teil Prof. J.-C. Perriard Das Wachstum beschleunigt sich und der Fötus wird aktiv. Die Schwangerschaft wird sichtbar. Die Plazenta bildet nun selbst Progesteron, der Gelbkörper bildet sich zurück. Abbildung 16 – Blutzirkulation in der Placenta. Ab der 4. Woche ist die Placenta aktiv. Der Stoffaustausch erfolgt über diffusion, aktiven Transport oder selektive Absorption. • • • • Trimester 3 Der Fötus wächst auf ca. 3-3.5 kg und 50 cm heran. Die Organe der Mutter werden deformiert, es kommt zu Beschwerden. Durch sehr hohe Östrogenwerte werden Oxytocin-Rezeptoren am Uterus gebildet. Oxytocin wird durch Fötus und und Neurohypophyse (?) gebildet und stimuliert heftige Kontraktionen des Uterus, auch über Prostaglandinproduktion, was den Effekt noch verstärkt (positive feedbackc). Einleitung der Geburt. Allgemeine Entwicklung in den 3 Trimestern: 5 Wochen: Extremitätenknospen, Augen, Herz, Leber und andere rudimentäre Organe haben sich entwickelt. Embryo: 1 cm. 14 Wochen: Fötus, jetzt etwa 6 cm lang, wächst und entwickelt sich. 20 Wochen: Bis zum Ende des 2. Trimesters hat der Fötus eine Grösse von 30 cm erreicht. Geburt (Parturition) wird durch starke Uteruskontraktionen ausgelöst (Wehen). Stufe 1: Öffnung und Verdünnung des Cervix Stufe 2: Geburt des Babys (delivery) Stufe 3: Nachgeburt (Plazenta) Milchsekretion (Lactation) ist ein Aspekt der postnatalen Pflege, die nur bei Säugetieren vorkommt. Durch das Absinken des Progesteronspiegels wird die 17 Grundlagen der Biologie IA Zusammenfassung Campbell Teil Prof. J.-C. Perriard Adenohypophyse dazu angeregt, Prolactin zu sekretieren: Milchproduktion in den Milchdrüsen kontrolliert durch Oxytocin. Abbildung 17 – 3 Stufen der Geburt. 18 Grundlagen der Biologie IA Zusammenfassung Campbell Teil Prof. J.-C. Perriard Abbildung 18 – Hormonelle Steuerung der Wehen. • • Reproduktionsimmunologie Warum wird der Fötus, der auch väterliche Oberflächenrezeptoren besitzt, nicht als Fremdkörper abgestossen? Trophoblast entwickelt sich aus dem Blastocyst und dringt ins Endometrium ein und hilft später, die Placenta zu bilden. Er bildet eine Barriere zwischen Muttergewebe und Embryo. Wahrscheinlich stört der Trophoblast die T-Lymphocyten der Mutter. Es werden T-Supressorzellen im Uterus gebildet, welche die Wirkung von Il-2 blockieren. Sind die väterlichen Antigene denen der Mutter zu ähnlich, so wird der Embryo abgestossen, da der Trophoblast gar nicht als Fremdgewebe erkannt wird. Ohne diesen immunologischen Alarm entstehen keine Suppressorzellen. Behandlung mit den Antigenen des Mannes bringt Abhilfe. Eine andere Hypothese geht davon aus, dass es zu einem enzymatischen Abbau von Tryptophan kommt, ohne das die TZellen nicht überleben können. Oder der Trophoblast schützt den Embryo vor dem Angriff des Komplementsystem (Proteine bei Mäusen nachgewiesen). Empfängnisverhütung Natürliche Familienplanung/Zeitwahlmethode: Kein Geschlechtsverkehr, wenn die Wahrscheinlichkeit für eine Schwangerschaft gross ist. Indikation der Ovulation durch Temperaturmessung und Beobachtung des Mucus des Cervix. Einige Tage vor und nach Eisprung kein Geschlechtsverkehr. 19 Grundlagen der Biologie IA Zusammenfassung Campbell Teil Prof. J.-C. Perriard Trotzdem: 10-20/100 Frauen pro Jahr werden schwanger (1020% Fehlerquote). Barrieremethoden Schwangerschaftsraten unter 10% Kondom Diaphragma (effektiver mit spermizidem Schaum oder Gel) Portiokappe (Cervixkappe) Kondom für die Frau Intrauterinspiralen verhindern die Einnistung des Blastocysts im Uterus. Sehr kleine Schwangerschaftsraten. Aber gefährliche Nebenwirkungen (Uterusentzündung, Vaginalblutung, Einnisten des Embryo im Oviduct, Abstossung der Spirale). Neu: Spiralen mit Progesteron. Coitus interruptus ist sehr unsicher. Antibabypille: Schnwagerschaftsraten und 1% Hormonkombinationen von Östrogen und Progestin: Unterdrückt die LH-Freisetzung (keine Ovulation), sowie FSH (Follikelreifung) und GnRH. Morning after pill: etwa 75% effektiv Minipille enthält nur Progestin Mucus im Cervix wird zäh, Spermien können nicht mehr durch, ist aber recht unsicher. Es gibt mittlerweile Implantate, die für 5 Jahre wirken. Pillen können zu Kardovaskulären Problemen führen. Sterilisierung Tubal ligation: Durch Entfernung oder Zerstörung eines Teils des Eileiters wird der Transport des reifen Eis verhindert. Vasektomie: Durchschneiden des Samenleiters beim Mann. Sichere Methode, keine Nebenwirkungen, aber endgültig. Abtreibung Mife priston (RU486) unterdrückt Progesteronsekretion und leitet mit Prostaglandin Wehen ein. Erlaubt bis 7. Woche. Operative Entfernung des Embryos. Einzige Sicherheit gegen Geschlechtskrankheiten liefert das Kondom, wenn auch nicht 100% sicher. o o o Fortpflanzungmedizin • • • • Genetische Krankheiten können heute mit Amniozenthese oder Chorionzottenbopsie nachgewiesen werden, wenn sich der Fötus noch im Uterus befindet. Diese beiden Methoden stehen aber im Verdacht, Fehlgeburten mitzuverursachen. Embryozellen können auch im mütterlichen Blut nachgewiesen werden. Heute sind die meisten so detektierbaren Krankheiten. Es bleibt die Wahl zwischen krankem Kind und Abtreibung. Samenspenderbanken (männl. Infertilität) und In-vitro-Fertilisation (bei Blockade des mütterl. Ovidukts) helfen Paaren, die ohne Hilfe keine Kinder haben können, welche zu kriegen. 20 Grundlagen der Biologie IA • Zusammenfassung Campbell Teil Prof. J.-C. Perriard Nach hormoneller Stimulation der Follikel werden die chirurgisch entnommenen Eizellen im Reagenzglas befruchtet. Der Erfolg ist gross, die Kosten auch. Die Pille für den Mann ist in Entwicklung, aber noch immer nicht gebrauchsreif. Abbildung 19 – Methoden der Empfägnisverhütung. 21 Grundlagen der Biologie IA Zusammenfassung Campbell Teil Prof. J.-C. Perriard Kapitel 47 ANIMAL DEVELOPMENT Die Stadien der frühen Embryonalentwicklung Epigenese • • • • • Füher existierte die Idee der Präformation: Die Embryonalentwicklung bestand dieser Theorie nach einfach aus Wachstum eines winzig kleinen, in der Eizelle oder dem Spermium präformierten Embryo. Epigenese wurde von Aristoteles vorgeschlagen: Die Form eines Tiers entsteht graduell aus einem unförmigen Zellhaufen. Allerdings ist durch unterschiedliche Verteilung von Plasmafaktoren (mRNA, Proteine) eine Polarität vorgegeben, und somit ist in der Zygote auch ein bisschen etwas vorbestimmt (zusätzlich zum vererbten Genom). Nach den ersten paar Zellteilungen sind also die verschiedenen Nuclei verschiedenen Umgebungen ausgesetzt, was zu differentieller Genexpression führt. Morphogenese ist der Prozess, durch den ein Tier seine Form annimmt. Befruchtung • • • • • • • • • • Zweck der Befruchtung: Kombination der haploiden Chromosomensätze. Die Eizelle wird durch den Kontakt mit dem Spermium aktiviert (metabolische Prozesse, die die Embryonalentwicklung einleiten, beginnen). Seeigel sind eine beliebte Modellspezies. Sie sind wie die Vertebraten auch Deuterostomier. Akrosomenreaktion: Setzt hydrolytische Enzyme frei, die das Eindringen eines Acrosomenfortsatzes (acrosomal process) in die Gallerthülle ermöglichen. Actinfilamente sind involviert (2). Wird ausgelöst durch den Kontakt des Spermiums mit der langsam sich auflösenden Gallerthülle und darauf folgende Entleerung des Acrosomes. Enzyme verdauen ein Loch in die Gallerthülle. Die Spitze des Akrosomenfortsatzes ist mit Proteinen ausgestattet, die an Rezeptormoleküle der Vitellinschicht binden. Dieses Erkennungssystem stellt sicher, dass nur Gameten der gleichen Spezies verschmelzen (äussere Befruchtung!) (3). Die Akrosomenreaktion führt zur Verschmelzung der Plasmamembranen von Eizelle und Spermium (4) und Eindringen des Nucleus. 1 bis 3 Sekunden nach der Befruchtung ist der schnelle Block gegen Polyspermie aktiv, ausgelöst durch Natriumeinstrom in die Zelle und damit verbundener Membrandepolarisation. (5) Anschliessend folgt die Kortikalreaktion, die Veränderungen in der äusseren Cytoplasmaschicht der Eizelle auslöst. Calciumionen werden durch das ER ins Cytosol abgegeben, beginnend and er Stelle, wo das Spermium eintrat. IP3 und DAG werden produziert, was die Calciumfreisetzung auslöst, welche sich dann durch positives Feedback über die ganze Zelle ausbreitet. 22 Grundlagen der Biologie IA • • • Zusammenfassung Campbell Teil Prof. J.-C. Perriard Kortikalgranula fusionieren ausgelöst durch die Calciumkonzentration mit der Plasmamembran und entlassen ihren Inhalt in den Paravitellinraum, worauf die Vitellinschicht durch Enzyme von der Plasmamembran gelöst wird (6). Die Vitellinschicht wird gehärtet und der Paravitellinraum wird durch Osmose ausgelöst durch Mucopolysaccharide geweitet. Bildung der Fertilisationshülle, die weiteres Spermieneindringen verhindert (langsamer Block gegen Polyspermie). Abbildung 20 – Acrosomen- und Kortikalreaktion. Abbildung 21 – Welle der Calciumionenfreisetzung während der Corticalreaktion. 23 Grundlagen der Biologie IA • • • • Zusammenfassung Campbell Teil Prof. J.-C. Perriard Aktivierung der Eizelle: Durch die hohe Calciumionenkonzentration werden metabolische Veränderungen in der Zelle ausgelöst, die Proteinsynthese und Zellatmung verschnellern sich rasch. Das DAG scheint Proteine zu aktivieren, die Hydroniumionen aus der Zelle schleusen, das Innere basisch werden lassen und somit zu den metabolischen Veränderungen beitragen. Das Spermium ist daran nicht beteiligt. Aktivierung kann auch durch Calciumeinspritzung oder Hitzeschock erreicht werden (Parthogenese). Dies funktioniert sogar bei entkernten Eizellen, d.h. die Faktoren (v.a. mRNA) für die Aktivierung liegen im Plasma vor. Nach 20 Minuten verschmelzen die Nuclei, nach 90 Minuten erste Zellteilung. Abbildung 22 – Timeline der Prozesse nach der Befruchtung bei Seeigeln. • • • • • Befruchtung in Säugetieren findet normalerweise im Inneren des Weibchens statt. Kapazitation: Die Beweglichkeit des Spermiums wird durch die Veränderung einiger Moleküle auf der Spermienoberfläche durch Sekrete des Weibchens erhöht. Benötigt ca. 6 Studnden. Das Säugerei (sekundäre Oocyte) ist von einer Schicht aus Follikelzellen umgeben, durch die das Spermium wandern muss (1), bevor es die Zona pellucida erreicht (ECM der Eizelle), bestehend aus drei Glycoproteinen. ZP3 funktioniert als Spermienrezeptor. Darauf folgt die Akrosomenreaktion (2), die das Durchdringen der Zone pellucida (3) ermöglicht. Es kommt zur Verschmelzung der Zellmembranen, der Spermiennucleus dringt ein (4). Fast block gegen Polyspermie und Kortikalreaktion existieren auch bei Säugetieren. Verhärtung der Zona pellucida wirket als langsamer Block gegen Polyspermie (5). 24 Grundlagen der Biologie IA • • Zusammenfassung Campbell Teil Prof. J.-C. Perriard Mikrovilli holen das ganze Spermium in die Eizelle. Der Basalkörper der Flagelle des Spermiums teilt sich und bildet zwei Zentrosome mit Zentriolen (wichtig für Zellteilungen). Die Kernhüllen zerfallen, und erst nach der ersten Zellteilung kommt es zur Bildung von diploiden Nuclei. Abbildung 23 – Befruchtung bei Säugetieren. Furchung • • • • • Es existieren drei Stadien: Blastula: Mehrzelliges Bällchen Gastrula: Bildet die drei Keimblätter Neurula: Organogenese (?) Furchung ist die Abfolge rascher Zellteilungen, fast nur S- und M-Phase werden aneinandergereiht. Der Embryo wird dabei nicht grösser. Die entstehenden, kleineren Zellen nennt man Blastomeren. Die verschiedenen Regionen in der Eizelle befinden sich nun in verschiedenen Zellen. Ausser Säugetieren haben die Eizellen und Zygoten eine definitve Polarität, definiert durch die heterogene Verteilung von Substanzen in der Zelle. Furchungsteilungen orientieren sich an der Polarität. Dotter besteht aus gespeicherten Nährstoffen. Er ist am vegetalen Pol (wo die Polkörperchen bei der Oogenese entstehen, z.T. auch Kopfende des Tiers) der Eizelle konzentriert. Der animale Pol enthält kaum Dotter. 25 Grundlagen der Biologie IA • • • Zusammenfassung Campbell Teil Prof. J.-C. Perriard Die animalische Hemisphäre ist dunkelgrau auf Grund von eingebettetem Melanin im Cortex. Die vegetale Hemisphäre enthält gelben Dotter. Die Plasmamembran und der assoziierte Cortex rotieren auf den Punkt des Spermieneintrittes zu, es bildet sich der graue Halbmond gegenüber der Eintrittsstelle (evtl. weil das Centrosom aus dem Spermium das Cytoskelett reorganisiert). Abbildung 24 – Festlegung der Körperachsen und erste Furchungsteilungsebene bei Amphibien. • • • • • • Die erste Furchung spaltet den grauen Halbmond (dorsale Seite des Embryos). Schon vor der ersten Teilung sind also alle Achsen festgelegt! Die animale Hemisphäre teilt sich schneller (Dotter hemmt Zellteilung, Frosch), es entstehen kleinere Blastomeren. Ohne Dotter (Seeigel) werden alle Blastomeren gleich gross. Frosch, Seeigel: 1. und 2. Teilung meridional, 3. äquatorial. Viele Deuterostomen teilen Ähnliche frühe Embryonalentwicklung. Die Morula (16-64 Zellen) ist ein Bällchen aus Zellen („Maulbeere). Durch die Bildung des Blastocoels (flüssigkeitsgefüllt) entsteht die Blastula (mind. 128 Zellen). 26 Grundlagen der Biologie IA • • • Zusammenfassung Campbell Teil Prof. J.-C. Perriard Spezies mit Dotterreichen Eiern: Vögel, Reptilien, Fische, Insekten haben Embryos, die sich durch meroblastische Teilung entwickeln (nur ein kleiner Teil teilt sich, der Dotter ist eine Zelle. Holoblastische Teilung (dotterarme (Seeigel) oder normaldottrige (Frösche) Eizellen): Die ganze Eizelle teilt sich. Bei Insekteneiern geschieht eine Spezielle Art der meroblastischen Teilung: der Zellkern teilt sich viele Male, dann wandern die Zellkerne an den Rand der Zelle, und erst dann wird das Cytoplasma unterteilt. Gastrulation • • • • • • • • • • • Durch die Gastrulation werden die Blastulacellen stark reorganisiert. Es entstehen Veränderungen in Zellbeweglichkeit Zellform Anhaftung der Zellen an andere Zellen und die ECM. Die Gastrula enthält drei Zellschichten: Ektoderm: Aussen an der Gastrula. Nervensystem, Epidermis und Derivate (Näge, Haare), Mund, Rectum. Mesoderm Zwischen Ekto- und Entoderm. Niere, Herz, Muskeln, Dermis (innere Hautschichten). Entoderm: um den embryonalen Verdauungstrakt. Darm und zugehörige Organe (Leber, Pankreas), Epithelien des Atmungssystems, Geschlechtssystem. Gastrulation im Seeigel: Mesenchym-Zellen vom vegetativen Pol wandern ins Blastocoel (1). Die restlichen Zellen am vegetativen Pol flachen sich ab (vegetal plate), die sich einwärtsstülpt (Invagination) (2). Es folgt eine Reorganisation der Zellen der vegetal plate, es entsteht eine engere Tasche, das Archenteron (Urdarm) (3). Die Blastopore ist das offene Ende des Archenteron (wird bei Deuterostomen zum Anus). Auf der gegenüberliegenden Seite entsteht eine weitere Öffnung (4), der Urmund. Dazwischen liegt ein rudimentärer Verdauungskanal. Triploblastischer Körperaufbau entsteht also sehr früh in der Entwicklung. Im Frosch sind diese Mechanismen komplizierter, weil die Blastulawand mehr als eine Zellschicht dick ist, und die grossen Dotterzellen den Prozess erschweren (1). Das Ganze beginnt mit der Bildung der dorsalen Urmundlippe der Blastopore, indem einige Zellen ihre Form ändern und einwärts wandern. Sie entsteht, wo vorher der graue Halbmond war. Es entsteht eine runde Blastopore. Danach rollen Zellen, die später Mesoderm und Endoderm bilden, auf der Embryooberfläche über die Kante der dorsalen Urmundlippe hinweg und in den Embryo hinein (Involution). Zellen vom animalen Pol, die später die Aussenhaut bilden, wandern über die äussere Oberfläche des Embryos (2). Die Lippe der Blastopore wird rund. Die drei Keimblätter im Innern werden gebildet, während die Zellen sich weiter einwärtsbewegen. Sie füllen langsam den Platz im Blastocoel (3). 27 Grundlagen der Biologie IA • Zusammenfassung Campbell Teil Prof. J.-C. Perriard Am Schluss umschliesst die Blastopore einen Dotterzipfel. Die drei Keimblätter sind gebildet (4). Abbildung 25 – Gastrulation beim Seeigel. Die Filopodia ziehen das Archenteron an die gegenüberliegende Wand, wo es mit der Blastocoelwand fusioniert. Mesenchymzellen sekretieren am Schluss Calciumcarbonat, das zu einem einfachen Innenskelett wird. 28 Grundlagen der Biologie IA Zusammenfassung Campbell Teil Prof. J.-C. Perriard Abbildung 26 – Gastrulation beim Froschembryo. Organogenese • • • • In der Organogenese werden die rudimentären Organe angelegt. 3 Arten von morphogenetischen Veränderungen: Faltungen Spaltungen Kondensation (dichte Packung von Zellen) Zuerst entstehen Neuralrohr und Notochord, charakteristisch für alle Chordata-Embryonen. Das Notochord wird aus dorsalem Mesoderm oberhalb des Archenteron gebildet. Es wird später länger und streckt den Embryo. Danach funktioniert 29 Grundlagen der Biologie IA • • • • Zusammenfassung Campbell Teil Prof. J.-C. Perriard als als Kern, um den sich Mesodermzellen lagern und die Wirbel bilden. Bleibt in Form von Bandscheiben erhalten. Das Neuralrohr entsteht als Platte aus dorsalem Ektoderm über dem Notochord. Die neural plate faltet sich nach innen, und das Neuralrohr entsteht. Aus ihm entstehen Gehirn und Rückenmark (diese Organe sind darum häufig hohl). Somiten kondensieren aus Mesodermzellen seitlich des Notochord. Sie sind seriell angeordnet. Aus ihnen entstehen die Wirbelsäule und die Muskeln des axialen Skeletts (aus diesem Grund sind Chordata prinzipiell segmentierte Tiere). Seitlich der Somiten spaltet sich das Mesoderm in zwei Schichten, die das Coelom bilden. Die neural crest ist ein Vertebraten-Merkmal. Sie bildet sich, wo das Neuralrohr sich vom Ektoderm löst. Diese Zellen wandern später aus, und bilden Pigmentzellen der Haut, einige Knochen und Muskeln des Schädels, Zähne, Medulla der Hypophyse, und Komponenten des peripheren Nervensystems (Ganglien). 30 Grundlagen der Biologie IA • Zusammenfassung Campbell Teil Prof. J.-C. Perriard Der Frosch entwickelt sich zu einer Kaulquappe (Larvenstadium). Abbildung 27 Welche Organe aus den drei Keimblättern hervorgehen. Amnioten • • • • • • • Embryos der Amnioten entwickeln sich in einem flüssigkeitsgefüllten Sack in einer Schale oder dem Uterus (Anpassungen an das Landleben). Das Amnion umgibt bei Vögeln, Reptilien und Säugern den Embryo und enthält Flüssigkeit. Entwicklung der Vögel Nach der Befruchtung durchlaufen Vogelembryonen meroblastische Teilung, bei der sich nur Zellen in einer kleinen Region teilen. Es entsteht eine Blastodisc, die auf dem ungeteilten Dotter liegen bleibt. Die Blastomeren ordnen sich dann in eine obere und eine untere Schicht an (Epiblast und Hypoblast) (1). Zwischen diesen Schichten liegt das Blastocoel. Dieses Stadium entspricht der Blastula (obwohl die Form anders ist). Bei der Gastrulation wandern Zellen von der Oberfläche in eine darunterliegende Schicht (2). Einige Zellen des Epiblast wandern zur Mitte der Blastodisc und wandern von dort nach innen zum Dotter hin. Es entsteht die Primitivrinne (primitive streak). 31 Grundlagen der Biologie IA • Zusammenfassung Campbell Teil Prof. J.-C. Perriard Dieser verlängert sich über die ganze Blastodisc und markiert die vornehinten-Achse (equivalent zur Blastopore). Alle Zellen, die den Embryo bilden, stammen vom Epiblast. Einige Epiblastzellen bewegen sich seitlich ins Blastocoel ein und bilden das Mesoderm. Abbildung 28 – Frühe Embryonalentwicklung beim Hühnchen. • Jene, welche das Endoderm bilden, wandern weiter nach unten und verdängen die Hypoblastzellen. Die Zellen, die an der Oberfläche bleiben, bilden das Endoderm. 32 Grundlagen der Biologie IA • • • • Zusammenfassung Campbell Teil Prof. J.-C. Perriard Der Hypoblast formt später den Dottersack und eine Verbindung vom Dotter zum Embryo. Danach kommen die Ränder der embryonic disc zusammen und bilden eine dreilagige Röhre, die in der Mitte mit dem Dotter verbunden bleibt (3). Die folgenden Schritte sind ähnlich wie im Frosch. Die Gewebeschichten die ausserhalb des Embryo-„Rohres liegen, entwickeln sich in die vier embryonischen Membranen, die die weitere Entwicklung des Embryos im Ei unterstützen. Es sind: Dottersack: Zellen des Dottersackes verdauen Dotter und Blutgefässe transportieren die Nahrung zum Embryo. Amnion: Schliesst den Embryo in Flüssigkeit ein und verhindert so sein Austrocknen. Zusammen mit dem Chorion schützt er ihn auch vor mechanischen Einwirkungen. Allantois: Die Allantois erstreckt sich ins extraembryonal Coelom und nimmt die Harnsäure auf. Mit dem Chorion zusammen bildet sie auch das Atemorgan des Embryo. Chorion: Schützt vor mechanischen Einwirkungen und ist von Dottersack und Amnion durch ein Coelom getrennt. Abbildung 29 – Entwicklung der extraembryonalen Membranen im Hühnchen. • • • • Entwicklung der Säugetiere Bei den meisten Säugetieren findet die erste Embryonalentwicklung statt, während sich die befruchtete Eizelle vom Eileiter in den Uterus bewegt. Die Eizelle der Säugetiere ist sehr klein und hat wenig Nahrungsreserven gespeichert (kein Dotter). Die Zyote zeigt keine sichtbare Polarität, die Furchungen verlaufen holoblastisch. 33 Grundlagen der Biologie IA • • Zusammenfassung Campbell Teil Prof. J.-C. Perriard Die Furchungsteilungen verlaufen relativ langsam (beim Menschen ist erst nach 36 die erste Teilung abgeschlossen). Die Blastomeren sind alle gleich gross. Im Prozess der Compaction während des 8-Zellen-Stadiums beginnen sie, stark aneinander zu haften (Cadherinbildung). Abbildung 30 Frühe Embryonalentwicklung beim Menschen. 34 Grundlagen der Biologie IA Zusammenfassung Campbell Teil Prof. J.-C. Perriard 1. Ca. 7 Tage nach der Befruchtung sind mehr als 100 Zellen der Blastocyste um eine zentrale Höhlung angeordnet. a. In eine Seite der Blastocystenhöhlung ragt ein Zellhäufchen, das als inner cell mass bekannt ist, aus dem sich der Embryo proper und einige extraembryonale Membranen entwickeln. b. Der Trophoblast ist das äussere Epithelium, das zusammen mit Mesoderm den embryonalen Teil der Plazenta bilden wird. 2. Der Trophoblast beginnt mit der Implantation. Mit Hilfe von Enzymen dringt er ins Endometrium ein. a. Badend im Blut verdickt sich der Trophoblast und bildet fingerähnliche Ausstülpungen. Aus der inneren Zellmasse bilden sich Epiblast un Hypoblast (analog zu Vögeln bildet sich der Embryo v.a. aus dem Epiblasten). 3. Die extraembryonalen Membranen entwickeln sich. Chorion aus Trophoblast, Amnion aus Epiblast, ebenso wie mesodermale Zellen, die zur Plazenta beitragen. 4. Gastrulation erfolgt durch Einwärtsbewegung von Epiblastzellen durch eine Primitivrinne und bildet Mesoderm und Endoderm. a. Es liegt nun ein 3-Schichtiger Embryo vor, umgeben von extraembryonalem Mesoderm. b. Chorion umgibt den Embryo und die anderen Membranen c. Amnion schliesst den Embryo in flüssigkeitsgefüllten Hohlraum ein d. der Dottersack umschliesst eine weitere flüssigkeitsgefüllte Höhle (enthält aber keinen Dotter, sondern bildet Blutzellen!) e. Allantois entsteht aus dem rudimentären Darm und ist in die Nabelschnur eingebaut und bildet Blutgefässe für die Versorgung des Embryos. • • Wie man sieht, wurden die extraembryonalen Membranen von den Reptilien übernommen, wenn auch in etwas abgeänderter Form. Die Organogenese beginnt mit Neuralrohr, Notochord und Somitenbildung. Nach dem ersten Trimester liegen alle Organe vor. Zelluläre und molekulare Basis von Morphogenese und Differenzierung Morphogenese • • • • • • Nur in Tieren schliesst Morphogenese Zellwanderungen ein. Bewegung und Formänderung von Zellen ist in Furchung, Gastrulation und Organogenese wichtig. Veränderungen der Zellform benötigt normalerweise die Umordnung des Cytoskeletts. Zellen können innerhalb des Embryos mit Hilfe von Cytoskeletfasern umherkriechen, indem sie zelluläre Ausstülpungen ausstrecken und einziehen (amoeboide Bewegung). Lemellipodia: flach, Filopodia: Spikes. Bei der Gastrulation wandern so Zellen in die Tiefe und ziehen andere hinter sich her und bilden so das Blastocoel. Zellen der neural crest wandern individuell durch den Embryo. 35 Grundlagen der Biologie IA Zusammenfassung Campbell Teil Prof. J.-C. Perriard Abbildung 31 – Veränderungen in der Zellform während der Morphogenese. Bei der Bildung des Neuralrohres aus dem Ektoderm helfen Mikrotubuli, die Zellen der neural plate zu verlängern. Microfilamente am dorsalen Ende kontrahieren, so dass die Zellen deformiert werden, was zur Einwärtskrümmung des Ektoderms führt. • • Konvergente Extension rearrangiert Zellen so, dass eine Lage Zellen schmaler, aber länger wird, indem sich Zellen zwischen einander hineinschieben (Archenteronbildung im Seeigel). Wahrscheinlich hat die ECM (extracellular matrix) eine wichtige Funktion in diesem Vorgang. Nichtwandernde Zellen können so mit Hilfe von Fibronectin als „Schienen für wandernde Zellen dienen. Abbildung 32 – Konvergente Extension. • • Zelladhäsionsmoleküle (CAMs) verbinden Zellen und helfen bei morphogenetischen Bewegungen und stabiler Gewebebildung. Cadherine brauchen Calcium für ihre Funktion. Ohne sie kann z.B. die Blastula nicht entstehen. Das Schicksal von Zellen hängt von cytoplasmischen Determinanten und Zell-Zell-Induktion ab 36 Grundlagen der Biologie IA • • Zusammenfassung Campbell Teil Prof. J.-C. Perriard In Tierspezies (ausgenommen Säuger) ist die heterogene Verteilung von cytoplasmischen Determinanten im unbefruchteten Ei für regionale Differenzierung des Embryos verantwortlich (Körperachsen, mRNAVerteilung). Induktion, die Interaktion zwischen Embryozellen, verursacht Veränderungen in der Genexpression, was zu Differenzierung führt. Induktion durch chemische Signale oder Oberflächeninteraktionen. Schicksalskarten • • • Für C. elegans existieren Karten, welche die Entwicklungsgeschichte jeder Zelle dokumentieren. Fate maps (Anlagepläne) sind nicht so genau, sie beschreiben nur Gebiete. Bei Embryonen, deren Achsen determiniert sind, kann abgeleitet werden, was aus welchen Regionen der Blastula oder Zygote entsteht. W. Vogt färbte verschiedene Oberflächenbereiche der Blastula und verfolgte, wo die Färbung endete. So konnten Zellen aus den drei Keimblättern in die Blastula zurückverfolgt werden. Abbildung 33 – Fate maps für 2 Chordaten. Durch Anfärbung verschiedener Zellen oder Regionen kann das Schicksal dieser Zellen nachverfolgt werden. • Gründerzellen (founder cells) sind für die meisten Gewebebildungen verantwortlich. 37 Grundlagen der Biologie IA • Zusammenfassung Campbell Teil Prof. J.-C. Perriard Je älter der Embryo wird, desto weniger vielseitig sind die Zellen. Ihr Potential wird eingeschränkt. Cytoplasmische Determinanten • • • • Polarität und der grundlegende Körperaufbau: Bilateralsymmetrische Tiere haben drei Achsen. Die Anlage dieser Achsen ist der erste Schritt in der Morphogenese. In Säugetieren ist die Polarität bis zur Furchungsteilung nicht sichtbar (evtl. spielt der Eintrittspunkt des Spermiums eine Rolle). In vielen anderen Tieren werden diese Anlagen früher gebildet und sind z.B. durch Dotter sichtbar (Kopf-Fuss Achse). Bei der Fertilisation wird dann die Bauch-Rücken-Achse festgelegt. Beschränkung der Totipotenz: Die erste Furchung kann zwei identische Blastomeren produzieren, trotz unterschiedlicher Anordnung von Cytoplasmafaktoren. Sie bleiben totipotent und können beide zu vollständigen Individuen werden. Abbildung 34 – Bei „falscher Furchung bleibt nur die Zelle mit dem grauen Halbmond totipotent. • Die Zellen von Säugetieren bleiben totipotent bis zur Bildung der Blastocyste (im Gegensatz zu vielen anderen Organismen, wo nur die Zygote totipotent ist). 38 Grundlagen der Biologie IA • Zusammenfassung Campbell Teil Prof. J.-C. Perriard Allgemein sind die Zellen ab der späten Gastrulaphase determiniert. So kann z.B. eine transplantierte Amphibienzelle dann keine neural plate mehr bilden. Differenzierung und Musterbildung • • Induktion: Zellen können ihre Nachbarzellen beeinflussen (durch Aktivierung spezieller Gene, die zu Differenzierung führen). Spemann-Mangold: Dorsale Urmundlippe der frühen Gastrula spielt Schlüsselrolle in der Embryonalentwicklung, über eine Kette von Induktionen, die zu Neuralrohrbildung führt. Abbildung 35 – Der Spemann-Mangold-Organizer. • Transplantation eines Stücks der dorsalen Urmundlippe in die Bauchseite einer anderen Gastrula (1). 39 Grundlagen der Biologie IA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Zusammenfassung Campbell Teil Prof. J.-C. Perriard Der Akzeptorembryo formte einen zweiten Notochord und ein zweites Neuralrohr, sogar einen fast kompletten 2. Embryo in der Region des Transplantats. Allerdings wurden die Strukturen des 2. Embryos zum Empfänger gebildet, das Transplantat diente nur als Organizer (2). Auf Grund dieser Wichtigkeit wurde dieser Organizer zum primary organizer. BMP-4 (bone morphogenetic protein) wird auf der Dorsalseite inaktiviert, was evtl. Grund für diese Entwicklung sein könnte. Musterbildung Entwicklung der räumlichen Organisation eines Tieres. Positionsinformationen informieren eine Zelle darüber, wo sie relativ zu den Köperachsen steht. Vertrebratengliedmassen beginnen als Knospen. 3 Achsen sind für die Ausbildung einer Gliedmasse verantwortlich: proximal-distal, anteriorposterior, dorsal-ventral. Die Embryonalzellen in den Gliedmassenknospen reagieren auf Positionsinformationen bezüglich dieser Achsen. Eine Gliedmassenknospe besteht aus einem Kern aus Mesoderm bedeckt von Ektoderm. Es gibt zwei wichtige, proteinsekretierende Kontrollregionen: Apikale Ektodermisleiste (AER), eine Verdickung am Ende der Knospe, die FGF (fibroblasten growth factor) absondert, verantwortlich für das Wachstum entlang der proximal-distal-Achse. Veränderungen an der Leiste führen zu Missbildungen. Zone of polarizing activity (ZPA), befindet sich, wo die posteriore Seite der Knospe am Körper anwächst, ist verantwortlich für Entwicklung entlang der anterior-posterior-Achse durch Aussenden induktiver Signale. Zellen nahe an der ZPA – posteriore Strukturen, Zellen weit entfernt – anteriore Strukturen. Die Transplantation einer zweiten ZPA an eine Armknospe führt zur Ausbildung von weiteren Fingern, aber in gespiegelter Anordnung. ZPA sekretiert sonic hedgehog (ein protein growth factor), der für die Wirkung verantwortlich ist. Sekretion an der falschen Stelle kann zu zusätzlichen Fingern führen. Morphogen: Substanz, die Positionsinformation liefert in Form eines Konzentrationsgradienten entlang einer embryonalen Achse. Es ist unklar, ob sonic hedgehog ein Morphogen ist, oder nur die Bildung von Morphogenen auslöst. Musterbildung erfordert jedenfalls, dass Zellen Informationen aus ihrer Umgebung bekommen und verarbeiten, die je nach Ort unterschiedlich sind. Sie ermöglichen es der Zelle, zu bestimmen, wo sie im dreidimensionalen Raum ist. Proteine oder AER/ZPA können die Rolle des Messengers übernehmen. Für die Aubildung verschiedener Strukturen (Vorderbein, Hinterbein) sind weitere Faktoren nötig, die bewirken, dass die Zellen auf gleiche Signale unterschiedlich reagieren. Hox-Gene sind involviert in der Festlegung der Identität der verschiedenen Gliedmassenregionen. 40 Grundlagen der Biologie IA Zusammenfassung Campbell Teil Prof. J.-C. Perriard Kapitel 48 NERVOUS SYSTEMS Überblick Input, Integration and Output • • • • • • Sinnesrezeptoren sammeln Informationen über die Umgebung sowie Vorgänge im Körper selbst. Der sensory input wird dann zur Integration weitergeleitet. Integration ist der Prozess, in dem der Input verarbeitet wird und mit entsprechenden Reaktionen assoziiert wird. Meist wird Integration durch das Zentralnervensystem (ZNS) durchgeführt (Gehirn und Rückenmark). Motorischer Output ist die Übertragung der Informationen aus dem Integrationszentrum zu Effektorzellen (Muskel- oder Drüsenzellen) durch Nerven. Nerven sind Bündel von Nervenfasern, zusammengehalten durch Bindegewebe. Die Informationsweiterleitung geschieht durch chemische und elektrische Signale. Abbildung 36 – Übersicht über das Nervensystem der Vertebraten. Input und Output geschehen nicht streng linear, sondern Integration läuft ständig im Hintergrund. Nervensysteme • Die strukturelle und funktionelle Einheit des Nervensystems ist das Neuron oder Nervenzelle. 41 Grundlagen der Biologie IA • • • Zusammenfassung Campbell Teil Prof. J.-C. Perriard Die Zelle besitzt einen Zellkörper, der den Kern und die anderen Organellen enthält, sowie fasrige Fortsätze. Dendriten sind kurze, stark verzweigte Fortsätze, die eingehende Informationen erhalten. Axone sind normalerweise viel länger als Dendriten und übertragen Signale von der Nervenzelle weg zu anderen Zellen. Ein Neuron hat stets nur ein Axon. Einige Axone sind bis zu einem Meter lang. Abbildung 37 – Struktur des Vertebratenneurons. • • • • • • • Die konische Erhöhung, wo das Axon in den Zellkörper übergeht, nennt sich Axonhügel (axon hillock). Sie spielt eine entscheidende Rolle in der Übertragung und Integration von Nervenimpulsen. Das Axon ist von Myelinscheiden umgeben. Die synaptischen Endplatten (synaptic terminals) übertragen an der Synapse durch die Freisetzung von Neurotransmitter Informationen von einer Zelle zur anderen. Ein Axon kann hunderte oder tausende von synaptischen Endplatten haben. Präsynaptische Zelle: Information weiterleitende Zelle, postsynaptische Zelle: Informationsempfangende Zelle. Der Reflexbogen ist der einfachste Nervenkreislauf (nerve circuit). Die einfachsten Reflexbögen brauchen nur zwei Nervenzellen: Ein sensorisches und ein motorisches Neuron. Das Motorneuron innerviert darauf hin eine Effektorzelle, die eine Reaktion ausführt. Der Kniesehnenreflex wird durch einen Schlag auf die Patellasehne ausgelöst, was von einem Rezeptor registriert wird und durch ein sensorisches Neuron über ein Motorneuron die Kontraktion des Quadrizeps auslöst. Gleichzeitig wird der Beinbizeps hinhibiert, was einen zweiten Nervenkreislauf einschliesst. Dazu interagieren die sensorischen Neuronen auch noch mit Interneuronen. Die meisten Nervenkreisläufe involvieren eine grosse Anzahl von Neuronen, und die Interneuronen sind fast permanent aktiv und kommunizieren untereinander. 42 Grundlagen der Biologie IA Zusammenfassung Campbell Teil Prof. J.-C. Perriard Abbildung 38 – Der Kniescheibenreflex wird durch das Antippen der Patellasehne ausgelöst. • • • • • • Die Zellkörper von Motorneuronen und Interneuronen sind normalerweise in der grauen Materie (gray matter) des ZNS lokalisiert. Die weisse Materie ausserhalb besteht aus motorischen und senorischen Axons. Der Zellkörper des sensorischen Neurons dagegen ist ausserhalb, in Spinalganglien lokalisiert. Ganglien sind Anhäufungen von Nervenzellkörpern, die im peripheren Nervensystem lokalisiert sind und oft dieselbe Funktion haben. Ähnliche Cluster im Gehirn werden Nuclei genannt. Es gibt drei grundlegende Organisationstypen in Nervenkreisläufen. Informationen von einer Quelle zu verschiedenen Bereichen des Gehirns. Informationen von einem präsnaptischen Neuron breiten sich auf mehrere postsynaptische Neuronen aus (Auge). Informationen von mehreren präsynaptischen Neuronen vereinigen sich auf einem postsynaptischen Neuron (Identifikation eines Objekts). Fluss im Kreis, z.B. Gedächtnisbildung. Gliazellen sind entscheidend für die Funktion von Nervensystemen. Möglicherweise haben sie neben der unterstützenden Funktion auch eine Funktion in der Signalübertragung. Funktionen der Gliazellen: Im Embryo legen sie Bahnen, an denen entlang die Nervenzellen wandern oder aus dem Neuralrohr wachsen. Im adulten ZNS unterstützen Astrozyten die Neuronen metabolisch und strukturell. Sie induzieren auch die Bildung der Blut-Hirn-Schranke, 43 Grundlagen der Biologie IA Zusammenfassung Campbell Teil Prof. J.-C. Perriard die den Austausch der meisten Stoffe vom Blut ins Gehirn, was eine genaue Kontrolle des Milieus erlaubt, das die Nervenzellen umgibt. Oligodendrocyten (ZNS) und Schwann-Zellen (PNS) sind Gliazellen, die isolierende Myelinscheiden um die Axone bilden. Diese Memranen sind lipidreich, was elektrisch gut isoliert und die Geschwindigkeit der Impulsweiterleitung erhöht. Zerstörung der Myelinscheiden führt zu schweren Störungen (multiple Sklerose). Abbildung 39 – Die Neuronen der verschiedenen Organismen sind sehr divers: a) Die Dendriten kommunizieren mit sensorischen Nervenzellen. Das Axon ist normalerweise myeliniert. b) Das obere hat mehrere Dendriten und ein verzweigtes Axon, das untere stark verzweigte Dendriten. c) Der Zellkörper ist nur mit den Dendriten verbunden. Abbildung 40 – Schwann-Zellen. Die Lücken zwischen den Zellen werden Ranviersche Schnürringe genannt. 44 Grundlagen der Biologie IA Zusammenfassung Campbell Teil Prof. J.-C. Perriard Eigenschaften von Nervensignalen Membranpotentiale • • • • Praktisch alle Nervensignale sind Änderungen im Membranpotential der Nervenzelle, verursacht durch die Bewegung von Ionen durch die Plasmamembran. Das Membranpotential ist der Potentialunterschied zwischen innen und aussen. Das Potential kann mit Microelektroden gemessen werden. Es beträgt typischerweise zwischen –50 und –100 mV in Tierzellen und kann v.a. bei den grossen Axonen von Tintenfischen gut gemessen werden. Das Ruhepotential des Neurons beträgt ca. –70 mV. Abbildung 41 – Messung des Membranpotentials mit Messonden innerhalb und ausserhalb der Zelle. • • • • • • Das Membranpotential resultiert aus einer Differenz in der ionischen Zusammensetzung von intrazellulärer und extrazellulärer Flüssigkeit. Die Natrium-Kalium-Pumpe hält den Gradienten aufrecht. Hauptkationen in der Zelle: Kalimionen ausserhalb: Natrium-Ionen. Hauptanionen in der Zelle: Sulfat, Phosphat, Proteine, Aminosäuren ausserhalb: Chlorid Ionen können nur durch selektive Kanäle durch die Plasmamembran wandern, so dass die Permeabilität der Membran für verschiedene Ionen unterschiedlich sein kann. Tierzelle: Permeabilität für Kalium grösser als für Natrium. Diffusion von Kalium aus der Zelle führt zu negativer Ladungsbilanz in der Zelle, da die grossen Anionen (Proteine) nicht folgen können. 45 Grundlagen der Biologie IA • • • • Zusammenfassung Campbell Teil Prof. J.-C. Perriard Kalium diffundiert auf Grund des chemischen Gradienten (Konzentrationsdifferenz) aus der Zelle. Der elektrische Gradient hingegen wirkt gegen die Diffusion von Kationen aus der Zelle. Das Gleichgewichtspotential für Kaliumionen läge bei ca. –85 mV. Bei diesem Potential würde Gleichgewicht zwischen dem elektrischen und dem chemischen Gradienten wirken. Für die Natriumionen ausserhalb der Zelle bewirken beide Gradienten die Diffusion in die Zelle hinein. Durch die Diffusion von Natrium senkt den Betrag des Ruhepotentiales etwas, auf ca. –70 mV. Die Natrium-Kalium-Pumpe verhindert, dass die Konzentrationen sich ausgleichen (Kalium würde ja ständig aus der Zelle diffundieren, da das Membranpotential nicht dem Gleichgewichtspotential für Kaliumionen entspricht). Abbildung 42 – a) Ionenkonzentrationen innerhalb und ausserhalb der Zelle. b) Die Natrium-KaliumPumpe hält den Konzentrationsgradienten aufrecht. Sie pumpt immer zwei Kalium-Ionen in die Zelle und 3 Natrium-Ionen hinaus. Nervenimpulse • • • • Entstehen aus der Veränderung des Membranpotentials ermöglicht durch spezialisierte Ionenkanäle (gated ion channels). Nur Muskel- und Nervenzellen besizten die Möglichkeit, grosse Veränderungen in ihren Membranpotentialen zu generieren. Man nennt sie deshalb erregbare Zellen (exciteable cells). Gated ion channels öffnen und schliessen sich auf Grund von Stimuli und erlauben nur den Durchtritt einer Ionensorte. Chemically-gated Ion Channels: Reagieren auf chemische Stimuli (z.B. Neurotransmitter). Voltage-gated Ion Channels: Reagieren auf Veränderungen des Membranpotentials. Hyperpolarisation und Depolarisation sind gestufte (graded) Potentiale. Hyperpolarisation vergrössert das Potential (z.B. durch Öffnung eines 46 Grundlagen der Biologie IA • Zusammenfassung Campbell Teil Prof. J.-C. Perriard Kaliumionenkanals), Depolarisation verkleinert es (z.B. durch Öffnung eines Natriumionenkanals). Bei dieser Art von Potentialen hängt der Betrag der Potentialveränderung von der Stärke des Stimulus ab. Abbildung 43 – c) Bei Überschreitung des Schwellenpotentials (treshold potential) resultiert ein Aktionspotential. • • • • • • • Wird durch einen starken Depolarisationsreiz ein Schwellenpotential überschritten, so folgt ein Aktionspotential. In Neuronen geschieht das nur im Axon. Das Aktionspotential wird normalerweise durch eine Depolarisation an einem Dendriten ausgelöst, die sich über die Zelle ausbreitet. Das Schwellenpotential liegt bei ca. –50 bis –55 mV. Hyperpolarisation erschwert das Erreichen des Schwellenpotentials. Das Aktionspotential ist der eigentliche Nervenimpuls. Es ist ein alles-odernichts-Ereignis, d.h. die stärke des Aktionpotentials hängt nicht von der Stärke des auslösenden Reizes ab. Die Reizstärke bestimmt die Rate, mit der die Aktionspotentiale generiert werden. Voltage-Gated Ion Channels spielen eine entscheidende Rolle im Mechanismus der Aktionspotentiales. Es ist in 5 Phasen eingeteilt (vgl. Tabelle). Tabelle 1 – Übersicht Aktionspotential Phase Ruhezustand Schwelle Na-Kanäle geschlossen einige geöffnet durch ankommenden Stimulus; falls stark genug öffnen sich alle K-Kanäle geschlossen geschlossen 47 Potential -70 mV -55 mV Grundlagen der Biologie IA Depolarisation Repolarisation Undershoot Zusammenfassung Campbell offen; Na fliesst in hohem Umfang ein die inactivation gates schliessen die Kanäle geschloss