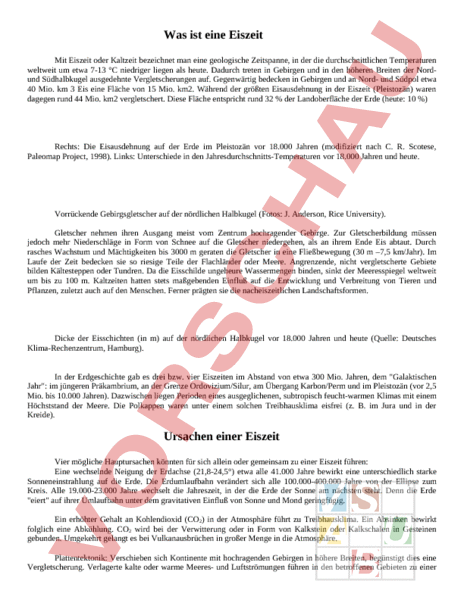Arbeitsblatt: Eiszeit
Material-Details
Zum Lesen
Geographie
Gemischte Themen
klassenübergreifend
3 Seiten
Statistik
73577
955
2
01.01.2011
Autor/in
Martynas Kandratavicius
Land: andere Länder
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Was ist eine Eiszeit Mit Eiszeit oder Kaltzeit bezeichnet man eine geologische Zeitspanne, in der die durchschnittlichen Temperaturen weltweit um etwa 7-13 C niedriger liegen als heute. Dadurch treten in Gebirgen und in den höheren Breiten der Nordund Südhalbkugel ausgedehnte Vergletscherungen auf. Gegenwärtig bedecken in Gebirgen und an Nord- und Südpol etwa 40 Mio. km 3 Eis eine Fläche von 15 Mio. km2. Während der größten Eisausdehnung in der Eiszeit (Pleistozän) waren dagegen rund 44 Mio. km2 vergletschert. Diese Fläche entspricht rund 32 der Landoberfläche der Erde (heute: 10 %) Rechts: Die Eisausdehnung auf der Erde im Pleistozän vor 18.000 Jahren (modifiziert nach C. R. Scotese, Paleomap Project, 1998). Links: Unterschiede in den Jahresdurchschnitts-Temperaturen vor 18.000 Jahren und heute. Vorrückende Gebirgsgletscher auf der nördlichen Halbkugel (Fotos: J. Anderson, Rice University). Gletscher nehmen ihren Ausgang meist vom Zentrum hochragender Gebirge. Zur Gletscherbildung müssen jedoch mehr Niederschläge in Form von Schnee auf die Gletscher niedergehen, als an ihrem Ende Eis abtaut. Durch rasches Wachstum und Mächtigkeiten bis 3000 geraten die Gletscher in eine Fließbewegung (30 –7,5 km/Jahr). Im Laufe der Zeit bedecken sie so riesige Teile der Flachländer oder Meere. Angrenzende, nicht vergletscherte Gebiete bilden Kältesteppen oder Tundren. Da die Eisschilde ungeheure Wassermengen binden, sinkt der Meeresspiegel weltweit um bis zu 100 m. Kaltzeiten hatten stets maßgebenden Einfluß auf die Entwicklung und Verbreitung von Tieren und Pflanzen, zuletzt auch auf den Menschen. Ferner prägten sie die nacheiszeitlichen Landschaftsformen. Dicke der Eisschichten (in m) auf der nördlichen Halbkugel vor 18.000 Jahren und heute (Quelle: Deutsches Klima-Rechenzentrum, Hamburg). In der Erdgeschichte gab es drei bzw. vier Eiszeiten im Abstand von etwa 300 Mio. Jahren, dem Galaktischen Jahr: im jüngeren Präkambrium, an der Grenze Ordovizium/Silur, am Übergang Karbon/Perm und im Pleistozän (vor 2,5 Mio. bis 10.000 Jahren). Dazwischen liegen Perioden eines ausgeglichenen, subtropisch feucht-warmen Klimas mit einem Höchststand der Meere. Die Polkappen waren unter einem solchen Treibhausklima eisfrei (z. B. im Jura und in der Kreide). Ursachen einer Eiszeit Vier mögliche Hauptursachen könnten für sich allein oder gemeinsam zu einer Eiszeit führen: Eine wechselnde Neigung der Erdachse (21,8-24,5) etwa alle 41.000 Jahre bewirkt eine unterschiedlich starke Sonneneinstrahlung auf die Erde. Die Erdumlaufbahn verändert sich alle 100.000-400.000 Jahre von der Ellipse zum Kreis. Alle 19.000-23.000 Jahre wechselt die Jahreszeit, in der die Erde der Sonne am nächsten steht. Denn die Erde eiert auf ihrer Umlaufbahn unter dem gravitativen Einfluß von Sonne und Mond geringfügig. Ein erhöhter Gehalt an Kohlendioxid (CO2) in der Atmosphäre führt zu Treibhausklima. Ein Absinken bewirkt folglich eine Abkühlung. CO2 wird bei der Verwitterung oder in Form von Kalkstein oder Kalkschalen in Gesteinen gebunden. Umgekehrt gelangt es bei Vulkanausbrüchen in großer Menge in die Atmosphäre. Plattentektonik: Verschieben sich Kontinente mit hochragenden Gebirgen in höhere Breiten, begünstigt dies eine Vergletscherung. Verlagerte kalte oder warme Meeres- und Luftströmungen führen in den betroffenen Gebieten zu einer spürbaren Abkühlung oder Erwärmung. Solche Verlagerungen entstehen auch durch den Wegfall oder den Neuaufbau von untermeerischen Schwellen, Gebirgen oder Landbrücken. Ist erst einmal ein ausgedehnter Eisschild vorhanden, reflektiert die helle Fläche das Sonnenlicht verstärkt in den Weltraum zurück (Albedo-Effekt). Dieser zusätzliche Wärmeverlust bewirkt eine weitere Abkühlung. Großräumige Auswirkung eines Hochgebirgsreliefs auf die atmosphärische Zirkulation (nach Bennett Glasser 1996: Glacial Geology) Kosmische Ursachen: Große Meteoriteneinschläge wirbeln soviel Staub in die Atmosphäre, daß die Sonne über Jahre oder Jahrzehnte verdunkelt wird. Eine Abkühlung ist die Folge. Ein ähnlicher Vorgang fände statt, wenn ausgedehnter Vulkanismus in einem stärkeren Maße als heute für längere Zeit Staub und Gase in die Atmosphäre brächte. Größte Eisausdehnung (weiß) während der Saale-Kaltzeit vor ca. 150.000 Jahren (links) und heute (rechts) (nach Reichardt 1979: Die Eiszeit).