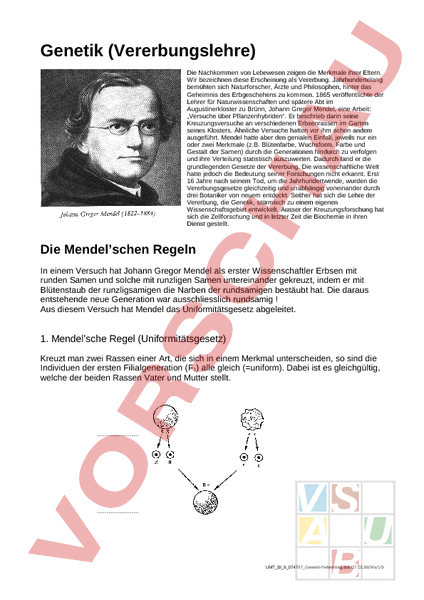Arbeitsblatt: Genetik Hefteintrag
Material-Details
Theorie der Grundsätze der Genetik
Biologie
Genetik
9. Schuljahr
9 Seiten
Statistik
74787
1495
20
16.01.2011
Autor/in
Ueli Wanner
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Genetik (Vererbungslehre) Die Nachkommen von Lebewesen zeigen die Merkmale ihrer Eltern. Wir bezeichnen diese Erscheinung als Vererbung. Jahrhundertelang bemühten sich Naturforscher, Ärzte und Philosophen, hinter das Geheimnis des Erbgeschehens zu kommen. 1865 veröffentlichte der Lehrer für Naturwissenschaften und spätere Abt im Augustinerkloster zu Brünn, Johann Gregor Mendel, eine Arbeit: „Versuche über Pflanzenhybriden. Er beschrieb darin seine Kreuzungsversuche an verschiedenen Erbsenrassen im Garten seines Klosters. Ähnliche Versuche hatten vor ihm schon andere ausgeführt. Mendel hatte aber den genialen Einfall, jeweils nur ein oder zwei Merkmale (z.B. Blütenfarbe, Wuchsform, Farbe und Gestalt der Samen) durch die Generationen hindurch zu verfolgen und ihre Verteilung statistisch auszuwerten. Dadurch fand er die grundlegenden Gesetze der Vererbung. Die wissenschaftliche Welt hatte jedoch die Bedeutung seiner Forschungen nicht erkannt. Erst 16 Jahre nach seinem Tod, um die Jahrhundertwende, wurden die Vererbungsgesetze gleichzeitig und unabhängig voneinander durch drei Botaniker von neuem entdeckt. Seither hat sich die Lehre der Vererbung, die Genetik, stürmisch zu einem eigenen Wissenschaftsgebiet entwickelt. Ausser der Kreuzungsforschung hat sich die Zellforschung und in letzter Zeit die Biochemie in ihren Dienst gestellt. Die Mendelschen Regeln In einem Versuch hat Johann Gregor Mendel als erster Wissenschaftler Erbsen mit runden Samen und solche mit runzligen Samen untereinander gekreuzt, indem er mit Blütenstaub der runzligsamigen die Narben der rundsamigen bestäubt hat. Die daraus entstehende neue Generation war ausschliesslich rundsamig Aus diesem Versuch hat Mendel das Uniformitätsgesetz abgeleitet. 1. Mendelsche Regel (Uniformitätsgesetz) Kreuzt man zwei Rassen einer Art, die sich in einem Merkmal unterscheiden, so sind die Individuen der ersten Filialgeneration (F1) alle gleich (uniform). Dabei ist es gleichgültig, welche der beiden Rassen Vater und Mutter stellt. UMT_BI_9_074787_Genetik-Hefteintrag.doc/27.02.96/Wa/1/9 2. Mendelsche Regel (Spaltungsgesetz) In seinen Klostergärten setzte Mendel lauter Mischlingssamen der 1. Filialgeneration (F1). Durch Selbstbestäubung entstanden 8000 Pflanzen der F2-Generation. Davon hatten 6000 runde und 2000 runzelige Samen. Bei weiteren solchen Versuchen tauchte immer wieder dieses Verhältnis von 3 1 auf. Mendel nannte diese Erscheinung Spaltungsgesetz, da eine Aufspaltung in die zwei Arten der Parentalgeneration (P) auftrat. Bei dieser Art der Vererbung zeigt der Bastard der F1-Generation nur das Merkmal der glattsamigen Elternpflanze. Das Merkmal der runzligsamigen Elternteils ist scheinbar völlig verschwunden, in Wirklichkeit wird es von dem Merkmal der glattsamigen Pflanze so überdeckt oder beherrscht, dass es nicht in Erscheinung treten kann. Man nennt deshalb das eine Merkmal das .(überdeckende), das andere das . (überdeckte) Merkmal. Diese Art der Vererbung nennt man dominant-rezessive Vererbung: UMT_BI_9_074787_Genetik-Hefteintrag.doc/27.02.96/Wa/2/9 Bestäubt man die Narbe der rotblühenden Wunderblume mit Pollen einer weissblühenden Wunderblume oder umgekehrt und sät die entstandenen Samen aus, so erhält man in dieser ersten Tochtergeneration (F1) lauter Bastarde, die rosa blühen, also eine Mittelstellung zwischen den Eltern einnehmen. Bei der Kreuzung der rosafarbenen Bastarde unter sich entstehen in der nächsten Generation (F2) dreierlei Nachkommen: rotblühende, rosablühende und weissblühende. Dieses Zahlenverhältnis 1:2:1 wird um so genauer gefunden, je mehr Nachkommen gezogen werden. Bestäubt man weiterhin die rotblühenden Pflanzen unter sich, so erhält man in F3 wie in allen späteren Generationen nur noch rotblühende Pflanzen. Entsprechendes gilt für die weissblühenden Pflanzen, die ebenfalls „rein weiterzüchten. Werden dagegen die rosablühenden unter sich gekreuzt, so erhält man von ihnen in F3 wiederum rot-, rosaund weissblühende Pflanzen im Verhältnis 1:2:1, von denen die rosablühenden auch in den weiteren Generationen in derselben Weise aufspalten. Diese Art der Vererbung, bei welcher der Mischling mit seinen Merkmalen zwischen denen der Elterngeneration steht, wird als intermediäre Vererbung bezeichnet. Beispiel der intermediären Vererbung: UMT_BI_9_074787_Genetik-Hefteintrag.doc/27.02.96/Wa/3/9 Gene und Chromosomen Mendel folgerte aus seinen Versuchen, dass jedes Merkmal, z.B. die Samenform, Augenfarbe etc. aus dem Zusammenwirken von zwei Erbfaktoren heraus entsteht. Treffen zwei gleiche Erbfaktoren zusammen, sind die Nachkommen reinerbig (homozygot). Vereinen sich verschiedene Anlagen, z.B. rot und weiss, sind die Nachkommen mischerbig (heterozygot). Allen Merkmalen, die ein bestimmtes Tier, eine Pflanze oder den Menschen zu genau demjenigen Lebewesen machen, das es ist, liegen unzählige Erbfaktoren zugrunde. Diese Erbfaktoren heissen Gene. All diese tausende von Genen sind auf einer bestimmten Anzahl von Chromosomen zusammengefasst. Jedes Gen hat auf einem Chromosom seinen genauen Platz. In jeder Körperzelle kommen alle Chromosomen doppelt als sogenanntes Chromosomenpaar vor. Die Anzahl der Chromosomen ist von Lebewesen zu Lebewesen sehr unterschiedlich. Sie ist aber kein Zeiger für den Entwicklungsstand eines Lebewesens. Chromosomenzahlen einiger Lebewesen Pflanzen Natternzunge (Farn) Streifenfarn Kartoffel Hafer Apfelbaum Mais Himbeere Tiere 1260 144 48 42 34 20 14 Karpfen Hund Huhn Pferd Schwein Taube Pferdespulwurm 104 78 78 66 40 16 4 Der Mensch hat 46 Chromosomen. Neue Zellen entstehen durch Teilung schon bestehender Zellen. Dabei müssen die Erbinformationen unverändert weitergegeben werden. Chromosomensatz des Menschen (Mann) UMT_BI_9_074787_Genetik-Hefteintrag.doc/27.02.96/Wa/4/9 Normale Zellteilung (Mitose) Da in jeder unserer Körperzellen gleich viele Chromosomen sind, müssen die Chromosomen bei jeder Zellteilung kopiert werden. Vor der Teilung. Die Chromosomen sind als dünne Fäden erkennbar. Prophase: Die Chromosomen werden kürzer und dicker. Sie teilen sich in zwei identische Längshälften. Das Zentralkörperchen teilt sich und die Zellmembran, die den Zellkern umgeben hat, löst sich auf. Metaphase: Die Chromosomen wandern in die Mitte der Zelle und ordnen sich in einer Ebene, wie auf einem Teller an. Fäden von den Zentralkörperchen heften sich an die Chromosomenhälften. Anaphase: Die Fäden verkürzen sich und ziehen je eine Chromosomenhälfte zu entgegengesetzten Polen. Telophase: Die Chromosomen sammeln sich. Es bilden sich zwei Kerne und die Zelle schnürt sich ein. Die Chromosomen ergänzen sich wieder zu vollständigen, wieder teilbaren Chromosomen. Sie werden wieder zu ineinander verschlungene Fäden. Die Zelle teilt sich. UMT_BI_9_074787_Genetik-Hefteintrag.doc/27.02.96/Wa/5/9 Die Reifeteilung (Meiose) Alle menschlichen Körperzellen enthalten in ihrem Kern die gleiche Anzahl Chromosomen, nämlich 46. Jeder Mensch ist aus der Verschmelzung von Samen und Eizellen hervorgegangen. Wenn nun beide Keimzellen jeweils 46 Chromosomen weitergeben würden, hätte die nächste Generation bereits 92 Chromosomen und so weiter. Durch genaue Untersuchung fand man heraus, dass sich die 46 Chromosomen in 23 Paare ordnen lassen. Die beiden Chromosomen, die sich in Grösse und Gestalt gleichen, heissen homologe Chromosomen. Eines davon stammt von der Mutter, das andere vom Vater. Man sagt: Körperzellen besitzen einen doppelten Chromosomensatz, sie sind diploid. Keimzellen dagegen besitzen nur 23 Chromosomen. Während die Samen- und die Eizellen heranreiften, muss sich also der doppelte Chromosomensatz auf die Hälfte reduziert haben. Keimzellen besitzen einen einfachen Chromosomensatz, sie sind haploid. Keimmutterzellen Reduktionsteilung Die homologen Chromosomen ordnen sich paarweise in einer Ebene. Die Fäden der Zentralkörperchen heften sich an die Chromosomen. Die Fäden verkürzen sich und ziehen die Paare auseinander. Die homologen Paare wurden getrennt. Die Zelle beginnt sich einzuschnüren. Es bilden sich zwei neue Kerne mit 23 Chromosomen. 2. Reifeteilungsschritt Von hier an entspricht die Teilung einer normalen Zellteilung (Mitose), wobei sich bei der Eizelle nur eine Zelle voll entwickelt und die anderen verkümmern. UMT_BI_9_074787_Genetik-Hefteintrag.doc/27.02.96/Wa/6/9 Der menschliche Chromosomensatz Wir müssen zwischen dem weiblichen und dem männlichen Chromosomensatz unterscheiden. Frauen haben 22 Chromosomenpaare und als Geschlechtschromosomenpaar zwei X-förmige Chromosomen (XX). Beim Mann findet man 22 Chromosomenpaare und ein X- und ein Y-förmiges Geschlechtschromosomenpaar (XY). Das 23. Chromosomenpaar macht also den „kleinen Unterschied zwischen Mann und Frau aus. Die Vererbung des Geschlechts: X UMT_BI_9_074787_Genetik-Hefteintrag.doc/27.02.96/Wa/7/9 Zucht Deutscher Doggen Anwendung der Erbgesetze Im untenstehenden Bild ist das Ergebnis der Kreuzung von schwarzweiss gescheckten Deutschen Doggen dargestellt. Die Hundezüchter haben lange vergeblich versucht, die gescheckten Formen erbrein zu erhalten, aber ohne Erfolg. Warum war dieses Zuchtziel unerreichbar Schliesslich wurden auch die einfarbig dunklen als „Standard-Typen zugelassen. Die ganz hellen sind unerwünscht; sie sind nicht sehr gefällig, sie hören nicht gut und haben schlechte Augen. Wie muss der Hundezüchter kreuzen, um nur gescheckte und dunkle Typen aber keine hellen zu erhalten Eltern Nachkommen Die Nachkommen schwarz-weiss gefleckter Deutscher Doggen sind teils hell (1/4), teils wieder schwarz-weiss gescheckt (1/2) und teils einfarbig dunkel(1/4). . . . . . . . . . . . . . . UMT_BI_9_074787_Genetik-Hefteintrag.doc/27.02.96/Wa/8/9 Stammbaum europäischer Fürstenhäuser mit Bluterkrankheit . . . .