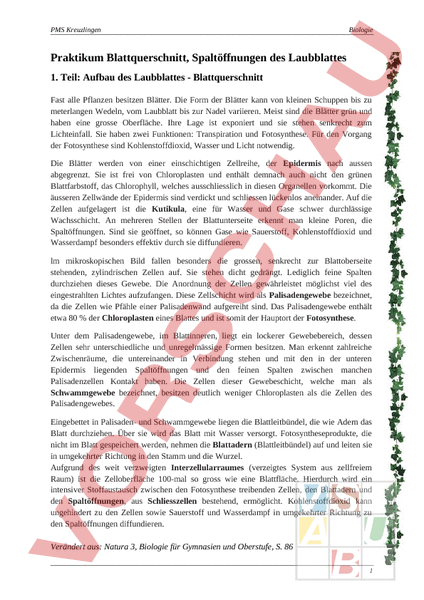Arbeitsblatt: Blattquerschnitt Praktikum
Material-Details
Praktikum zum Thema Aufbau des Blattes und Blattquerschnitt mit Einleitung und Anleitung für die Mittelschule, 1. Klasse
Biologie
Pflanzen / Botanik
10. Schuljahr
4 Seiten
Statistik
75639
2360
13
27.01.2011
Autor/in
Hans Momo
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
PMS Kreuzlingen Biologie Praktikum Blattquerschnitt, Spaltöffnungen des Laubblattes 1. Teil: Aufbau des Laubblattes Blattquerschnitt Fast alle Pflanzen besitzen Blätter. Die Form der Blätter kann von kleinen Schuppen bis zu meterlangen Wedeln, vom Laubblatt bis zur Nadel variieren. Meist sind die Blätter grün und haben eine grosse Oberfläche. Ihre Lage ist exponiert und sie stehen senkrecht zum Lichteinfall. Sie haben zwei Funktionen: Transpiration und Fotosynthese. Für den Vorgang der Fotosynthese sind Kohlenstoffdioxid, Wasser und Licht notwendig. Die Blätter werden von einer einschichtigen Zellreihe, der Epidermis nach aussen abgegrenzt. Sie ist frei von Chloroplasten und enthält demnach auch nicht den grünen Blattfarbstoff, das Chlorophyll, welches ausschliesslich in diesen Organellen vorkommt. Die äusseren Zellwände der Epidermis sind verdickt und schliessen lückenlos aneinander. Auf die Zellen aufgelagert ist die Kutikula, eine für Wasser und Gase schwer durchlässige Wachsschicht. An mehreren Stellen der Blattunterseite erkennt man kleine Poren, die Spaltöffnungen. Sind sie geöffnet, so können Gase wie Sauerstoff, Kohlenstoffdioxid und Wasserdampf besonders effektiv durch sie diffundieren. lm mikroskopischen Bild fallen besonders die grossen, senkrecht zur Blattoberseite stehenden, zylindrischen Zellen auf. Sie stehen dicht gedrängt. Lediglich feine Spalten durchziehen dieses Gewebe. Die Anordnung der Zellen gewährleistet möglichst viel des eingestrahlten Lichtes aufzufangen. Diese Zellschicht wird als Palisadengewebe bezeichnet, da die Zellen wie Pfähle einer Palisadenwand aufgereiht sind. Das Palisadengewebe enthält etwa 80 der Chloroplasten eines Blattes und ist somit der Hauptort der Fotosynthese. Unter dem Palisadengewebe, im Blattinneren, liegt ein lockerer Gewebebereich, dessen Zellen sehr unterschiedliche und unregelmässige Formen besitzen. Man erkennt zahlreiche Zwischenräume, die untereinander in Verbindung stehen und mit den in der unteren Epidermis liegenden Spaltöffnungen und den feinen Spalten zwischen manchen Palisadenzellen Kontakt haben. Die Zellen dieser Gewebeschicht, welche man als Schwammgewebe bezeichnet, besitzen deutlich weniger Chloroplasten als die Zellen des Palisadengewebes. Eingebettet in Palisaden- und Schwammgewebe liegen die Blattleitbündel, die wie Adern das Blatt durchziehen. Über sie wird das Blatt mit Wasser versorgt. Fotosyntheseprodukte, die nicht im Blatt gespeichert werden, nehmen die Blattadern (Blattleitbündel) auf und leiten sie in umgekehrter Richtung in den Stamm und die Wurzel. Aufgrund des weit verzweigten Interzellularraumes (verzeigtes System aus zellfreiem Raum) ist die Zelloberfläche 100-mal so gross wie eine Blattfläche. Hierdurch wird ein intensiver Stoffaustausch zwischen den Fotosynthese treibenden Zellen, den Blattadern und den Spaltöffnungen, aus Schliesszellen bestehend, ermöglicht. Kohlenstoffdioxid kann ungehindert zu den Zellen sowie Sauerstoff und Wasserdampf in umgekehrter Richtung zu den Spaltöffnungen diffundieren. Verändert aus: Natura 3, Biologie für Gymnasien und Oberstufe, S. 86 1 PMS Kreuzlingen Biologie Aufgaben 1. Ordnen Sie den Ziffern der schematischen Abbildung die richtigen Bezeichnungen zu. Benutzen Sie dafür die Begriffe aus dem obigen Text und schreiben Sie sie auf die Linien. 2. Versuchen Sie die entsprechenden Teile im Mikrofoto wieder zu erkennen. Schreiben Sie die entsprechenden Nummern ins Foto. 2 PMS Kreuzlingen Biologie Versuch 1: Aufbau des Laubblattes Herstellen eines Blattquerschnittes Material: Blätter vom Kirschlorbeer (immergrüner Strauch), Mikroskopierbesteck, Mikroskop, Pasteurpipette, Leitungswasser Aufgabe Schneiden Sie mit einem Rasiermesser aus dem zu untersuchenden Blatt parallel zu den Blattrippen schmale Streifen heraus. Stellen Sie daraus mehrere dünne Blattschnitte von dem Lorbeer her. Legen Sie diese auf einen Objektträger, auf den Sie vorher einen Tropfen Wasser aufgetropft haben. Suchen Sie im vorliegenden Präparat eine möglichst dünne und intakte Stelle. Mikroskopieren Sie bei 100facher Vergrösserung und zeichnen Sie diesen Blattquerschnitt. Machen Sie eine saubere Skizze mit Skala. Beschriften Sie die Zeichnung und vergleichen Sie ihr Ergebnis mit der Abbildung auf Seite 2 in diesen Unterlagen. 2. Teil: Bau und Funktion von Spaltöffnungen (Stomata) Da die Epidermis und Kutikula der Laubblätter für Wasser und Luft fast undurchlässig sind, erlauben Spaltöffnungen den Gasaustausch der Blätter mit ihrer Umwelt. So tritt beispielsweise Wasser in Form von Wasserdampf aus den Spaltöffnungen. Sobald die Blätter jedoch Gefahr laufen auszutrocknen, sind die Spaltöffnungen in der Lage sich zu schliessen. Jedoch nicht nur Wasserdampf, sondern für den Stoffwechsel wichtige Gase gelangen über die Spaltöffnungen aus dem Blatt (Sauerstoff), beziehungsweise in das Blatt (Kohlenstoffdioxid). Alle Spaltöffnungen (Stomata) sind umgeben von zwei bohnenförmigen Schliesszellen, die in ihrer Mitte einen Spalt frei lassen und sich an ihren Enden berühren. Ihre unmittelbaren Nachbarzellen werden als Nebenzellen bezeichnet. Sie gehören ebenfalls zum Spaltöffnungsapparat. Die Schliesszellen enthalten als einzige Zellen der Epidermis Chloroplasten. Eine weitere Besonderheit der Schliesszellen ist die unterschiedliche Verdickung der Zellwände. Die Wände auf der Blattaussen- und Blattinnenseite sind besonders massiv aufgebaut. Damit sind sie relativ starr und in ihrer Form unveränderbar. Demgegenüber sind die an die Nebenzellen grenzenden Zellwände unverdickt und folglich elastisch. Auch die dem Spalt zugewandte Bauchseite der Schliesszellen besitzt einen dünnen, elastischen Bereich. Erhöht sich der Innendruck (Turgor) der Schliesszellen, so dehnen sich die elastischen Rückenwände. Die Zellen wölben sich in die Nebenzellen hinein. Da die Aussen- und Innenwände relativ starr sind, wird die etwas elastische Bauchseite durch die Bewegung der Rückenseite nachgezogen. Die Gestalt der Schliesszellen wird stärker bohnenförmig, der Spalt öffnet sich. (siehe Abbildung rechts). 3 PMS Kreuzlingen Biologie Die Öffnung des Spaltes hängt ausschliesslich vom Turgor der Schliesszellen ab. Da bei Wassermangel auch in diesen Zellen der Turgor abnimmt, wird verständlich, dass sich die Stomata unter diesen Bedingungen schliessen. Dieser Regulationsmechanismus ist bei Trockenheit sozusagen ein Sicherheitsventil. Verändert aus: Natura 3, Biologie für Gymnasien und Oberstufe, S. 87 Versuch 2: Untersuchung des Baus von Spaltöffnungen (Stomata) Material: Kirschlorbeerblätter (Blätter von Geranien ebenfalls möglich) Aufgabe Nehmen Sie von der Unterseite eines Kirschlorbeerblattes ein Stück der Epidermis (weisse Schicht ohne Chlorophyll, mit der spitzen Pinzette ins Blatt stechen und vorsichtig die oberen Schichten bei leichter Drehung der Pinzette wegziehen) und mikroskopieren Sie bei 100-400facher Vergrösserung. Machen Sie eine saubere Skizze mit Beschriftung und Skala. Denkanstösse für dieses Praktikum/ Diskussionspunkte Wieso befindet sich das Palisadengewebe in der oberen Blatthälfte? Wieso findet man das Schwammgewebe in der unteren Blatthälfte? Warum zählt man auf der Blattunterseite viele Spaltöffnungen, an der Blattoberseite nur wenige? Bei der Seerose ist es genau umgekehrt Wozu braucht ein Blatt überhaupt Spaltöffnungen? etc. 4