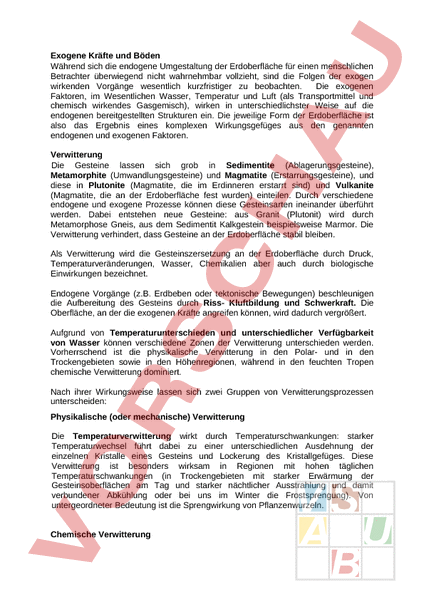Arbeitsblatt: Exogene Kräfte und Böden
Material-Details
Exogene Kräfte und Böden
Geographie
Anderes Thema
10. Schuljahr
5 Seiten
Statistik
76849
1573
10
16.02.2011
Autor/in
Bernd Goldgruber
Land: Österreich
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Exogene Kräfte und Böden Während sich die endogene Umgestaltung der Erdoberfläche für einen menschlichen Betrachter überwiegend nicht wahrnehmbar vollzieht, sind die Folgen der exogen wirkenden Vorgänge wesentlich kurzfristiger zu beobachten. Die exogenen Faktoren, im Wesentlichen Wasser, Temperatur und Luft (als Transportmittel und chemisch wirkendes Gasgemisch), wirken in unterschiedlichster Weise auf die endogenen bereitgestellten Strukturen ein. Die jeweilige Form der Erdoberfläche ist also das Ergebnis eines komplexen Wirkungsgefüges aus den genannten endogenen und exogenen Faktoren. Verwitterung Die Gesteine lassen sich grob in Sedimentite (Ablagerungsgesteine), Metamorphite (Umwandlungsgesteine) und Magmatite (Erstarrungsgesteine), und diese in Plutonite (Magmatite, die im Erdinneren erstarrt sind) und Vulkanite (Magmatite, die an der Erdoberfläche fest wurden) einteilen. Durch verschiedene endogene und exogene Prozesse können diese Gesteinsarten ineinander überführt werden. Dabei entstehen neue Gesteine: aus Granit (Plutonit) wird durch Metamorphose Gneis, aus dem Sedimentit Kalkgestein beispielsweise Marmor. Die Verwitterung verhindert, dass Gesteine an der Erdoberfläche stabil bleiben. Als Verwitterung wird die Gesteinszersetzung an der Erdoberfläche durch Druck, Temperaturveränderungen, Wasser, Chemikalien aber auch durch biologische Einwirkungen bezeichnet. Endogene Vorgänge (z.B. Erdbeben oder tektonische Bewegungen) beschleunigen die Aufbereitung des Gesteins durch Riss- Kluftbildung und Schwerkraft. Die Oberfläche, an der die exogenen Kräfte angreifen können, wird dadurch vergrößert. Aufgrund von Temperaturunterschieden und unterschiedlicher Verfügbarkeit von Wasser können verschiedene Zonen der Verwitterung unterschieden werden. Vorherrschend ist die physikalische Verwitterung in den Polar- und in den Trockengebieten sowie in den Höhenregionen, während in den feuchten Tropen chemische Verwitterung dominiert. Nach ihrer Wirkungsweise lassen sich zwei Gruppen von Verwitterungsprozessen unterscheiden: Physikalische (oder mechanische) Verwitterung Die Temperaturverwitterung wirkt durch Temperaturschwankungen: starker Temperaturwechsel führt dabei zu einer unterschiedlichen Ausdehnung der einzelnen Kristalle eines Gesteins und Lockerung des Kristallgefüges. Diese Verwitterung ist besonders wirksam in Regionen mit hohen täglichen Temperaturschwankungen (in Trockengebieten mit starker Erwärmung der Gesteinsoberflächen am Tag und starker nächtlicher Ausstrahlung und damit verbundener Abkühlung oder bei uns im Winter die Frostsprengung). Von untergeordneter Bedeutung ist die Sprengwirkung von Pflanzenwurzeln. Chemische Verwitterung Die chemische Verwitterung erfordert die Anwesenheit von Wasser. Ihre Wirksamkeit wird durch steigende Temperaturen erhöht. Eine Sonderform ist die Kohlesäureverwitterung in Kalkgebieten: Kalkverwitterung (Karst entsteht) oder die Salzverwitterung kommen. Die Oberflächenformen in Mitteleuropa Mitteleuropa ist geprägt vom engen Nebeneinander glazialer (von Eiszeit geprägt und fluvialer Oberflächenformen, den unterschiedlichsten Küstenformen und in den Gebirgen vom Formenschatz des Karstes und der Schichtstufenlandschaft. Hier wirkt sowohl physikalische wie auch chemische Verwitterung. Generell lässt sich die Abtragung verschiedenen Prozessen zuordnen: Die linienhafte Abtragung der Verwitterungsprodukte durch das fließende Wasser bezeichnet man als Erosion, die flächenhafte als Denudation und die Abtragung durch das Meer als Abrasion. Die Abtragung durch den Wind wird Deflation genannt und die abtragende Wirkung von Eis Glazialerosion. Aufbau eines Gletschers Glazialer Formenschatz Gletscher sind große Eismassen, die sich auf der Landoberfläche bilden und sich durch Zunahme ihres Gewichtes bewegen. Die Talgletscher in den Alpen werden von der Inlandsvereisung Grönlands und der Antarktis unterscheiden. Gletscher bilden sich aus Firn, der in Mulden auch im Sommer liegen bleibt und durch neue aufgelagerte Schichten zu Eis gepresst wird. Die Firnlinie (entspricht in etwa der klimatischen Schneegrenze) trennt das Nährgebiet hier ist der Schneefall größer als das Abschmelzen) von dem tiefer gelegenen Zehrgebiet, in dem das Abschmelzen überwiegt. Als Moräne wird der vom Gletscher mitgeführte und abgelagerte Gesteinsschutt bezeichnet. Ein Gletscher hinterlässt sowohl Abtragungsformen wie Trogal, Rundhöcker oder Zungenbeckensee als auch Ablagerungsformen wie Moränen, fluvioglaziale Formen wie Schotterflächen oder Sander, die durch Schmelzwasser gebildet werden. Das sich bewegende Eis überformt durch seinen Druck, aber auch durch das mitgeführte Material die Landoberfläche. So erhielten Alpentäler durch die erodierenden Gletscher einen U-förmigen Querschnitt und werden als Trogtäler bezeichnet. Gletscherzungen können im weicheren Untergrund große, flache Hohlformen schaffen, die Zungenbecken, die postglazial (nacheiszeitlich) mit Wasser gefüllt zum Zungenbeckensee werden. Fast alle Seen in Österreich sind Glazialseen, die durch die Ausschürfung eiszeitlicher Gletscher und durch die Absperrung der Schmelzwässer durch Moränen und andere Abtragungssedimente entstanden sind; der Bodensee geht auf den Rheingletscher zurück, die mehr als 40 Seen des Salzkammerguts auf den Traungletscher. Weitere Seengebiete liegen in Kärnten und im Salzburger Flachgau. Oft sind die Seen Reste ehemals viel größerer Eisstauseen. Der Neusiedler See ist ein ebenfalls eiszeitlich vorgeformter Steppensee, der durch die abtragende und anschüttende Tätigkeit von Vorläufern heutiger Flüsse entstanden ist. Eiszeiten Große Teile Mitteleuropas wurden durch die vier Eiszeiten geprägt. Während einer Vereisungsperiode (auch Eis- oder Kaltzeit genannt) bedeckten bei abgesenkten Temperaturen die Gletscher über einen längeren Zeitraum größere Landmassen. Warmzeiten unterbrachen die Eiszeiten: die Temperaturen waren wesentlich höher und die Eismassen schmolzen soweit ab, dass sich eine, wenn auch spärliche, Flora, ausbilden konnte. Fluvialer Formenschatz Untersucht man die Formenbildung im Bereich eines Flusses, lassen sich eine Vielzahl unterschiedlicher Oberflächenformen erkennen. Diese Formen sind abhängig von den Wassermengen des fließenden Gewässers, seiner Transportbelastung, der Erosionsbasis und dem Untergrund. Die grundlegenden Prozesse sind dabei Erosion, Transport und Akkumulation. Diese Erosionsleistung eines Flusses ist abhängig vom Untergrund und von der Schleppkraft, dem Produkt aus der Wassermenge und der Fließgeschwindigkeit. Ob sich ein Fluss einschneidet oder ob er akkumuliert, ergibt sich aus seinem Belastungsverhältnis. Die Erosion erfolgt durch die reibenden, schleifenden und mitunter auch brechenden Gerölle in die Tiefe, seitwärts und rückschreitend. Der Fluss verlagert so seine flacheren Strecken immer weiter zur Quelle hin. Mit dem Erreichen des Meeres findet keine Erosion mehr statt: die absolute Erosionsbasis ist erreicht. Rückschreitende Erosion vergrößert das Einzugsgebiet eines Flusses. Damit wird auch die Wasserscheide, die Grenze zwischen den Einzugsgebieten von zwei Flusssystemen, verlegt. Vielerorts begleiten Flussterrassen den Flusslauf. Diese Terrassen sind auf den Wechsel von Seitenerosion und Tiefenerosion zurückzuführen. Dieser Wechsel ist einerseits durch klimatisch verursachte unterschiedliche Wasserführung des Flusses bedingt und andererseits dadurch verursacht, dass sich Hebungs- und Einschneidungsvorgänge oftmals nicht gleichzeitig abspielten. Küste Eine Küste ist der dynamische, unterschiedlich breite Übergangsbereich zwischen Wasser und Land. Sowohl die Kraft des Meeres wie auch der Wind wirken hier auf das Land ein und sorgen für ständige Veränderung. Den Gezeiten (Ebbe und Flut) kommt bei der Ausformung der Küste besondere Bedeutung zu. Sie entstehen durch die Anziehungskräfte des Mondes, der Erde und der Sonne sowie der Fliehkraft und der Drehung der Erde. Zwei Flutberge umkreisen die Erde und sind an den Umlauf des Mondes um die Erde mit einer Dauer von 24 Stunden und 50 Minuten gekoppelt. Flut und Ebbe dauern damit jeweils täglich 6 Stunden und 12,5 Minuten, ihre Zeiten verschieben sich täglich. Den Höhenunterschied zwischen Hoch- und Niedrigwasser nennt man Tidenhub. Dieser wird an Küsten mit hohem Tidenhub zur Gewinnung von Energie verwendet. Man unterscheidet Küsten nach ihrer Form als Steil- und Flachküsten oder teilt die Küsten nach ihrer Entstehung ein. Steilküsten können sich vor allem im festen Gestein dann bilden, wenn die Wellen in steilem Winkel auf einen Steilhang treffen und der Meeresgrund sehr rasch absinkt. Die Brandung höht den Steilhang in der Brandungshohlkehle aus, bis das überhängende Gestein nachstürzt. Auf diese Weise entsteht ein Kliff, das rasch zurückverlegt wird. Flachküsten entstehen dort, wo verhältnismäßig lockeres Material die Küste bildet, der Meeresboden sanft ansteigt und damit die Wellen langsam auslaufen können. Durch auf- und ablaufende Wellen wird gleichzeitig Kies und Sand abgelagert und wieder vom Wasser abtransportiert. Bei schräg auflaufenden Wellen kommt es deshalb zum Materialversatz entlang der Küste und damit zur Strandversetzung. Das an der Steilküste aberodierte Material wird längs der Küste verfrachtet und dort, wo die Küstenlinie einbuchtet, abgelagert. Karstformen Als Karst wird ursprünglich ein Teil der Dinarischen Gebirgslandschaft aus Kalkgestein zwischen Triest und Rijeka bezeichnet. Heute werden damit alle Erscheinungen benannt, die durch die Korrosion (Lösung) von Gesteinen, insbesondere von Kalkgesteinen, bewirkt werden. Die Korrosion von Kalk erfordert neben Wasser Kohlensäure. Dann wird Kalkgestein in lösliches Kalziumhydrogencarbonat umgewandelt. Das Kalziumhydrogencarbonat kann leicht in Lösung gehen und abtransportiert werden. Je mehr Kohlendioxid im Wasser gelöst ist, desto mehr Kalk kann letztendlich gelöst werden. Umgekehrt kommt es bei einer Erwärmung des Wassers zu einer Umkehrung des Prozesses und zu einer Ausfällung von Kalk. Die Korrosion greift die Kalkschichten an der Oberfläche und in Klüften an. Es entstehen sowohl im bedeckten Karst (hier sind Boden und Vegetation noch vorhanden) wie auch im nackten Karst (hier fehlen sie) ganze Felder von mehr oder minder tiefen, sich kreuzenden Furchen, die Karren. Wo das Wasser die Karren erweitert, entstehen trichterförmige Vertiefungen mit einem Durchmesser bis zu 1000 m, die Dolinen. Sie können aber auch durch Einsturz eines unterirdischen Hohlraums entstehen. Größere Hohlformen im Karst sind die Quadratkilometer großen Poljen: sie haben einen ebenen Boden aus lehmigen Ablagerungen und ermöglichen dadurch eine agrarische Nutzung. Durch die Abdichtung nach unten wird in diesen Gebieten die seitliche Korrosion verstärkt und steile, scharf abgegrenzte Hänge begrenzen die Poljen. Auf seinem Weg durch das Gestein erweitert das Wasser Spalten zu Tropfsteinhöhlen. Dort können durch Ausscheidung von Kalk Tropfsteine entstehen: von den Decken wachsen die spitzen Stalaktiten herab, am Boden die Stalagmiten. Boden Die Bedeutung des Bodens wird oft unterschätzt, obwohl er ein wichtiger Produktionsfaktor ist. So sind die in Mitteleuropa vorkommenden Böden Der Boden ist Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere und Pflanzen, Teil der Ökosysteme mit ihren Stoffkreisläufen, besonders im Hinblick auf Waserund Nährstoffhaushalt, prägendes Element der Natur und Landschaft. Damit bildet die hauchdünne, oft nur wenige Dezimeter mächtige Schicht der heutigen Böden eine Momentaufnahme eines langen Prozesses, der von vielen Faktoren beeinflusst wird. Der durch die Verwitterung entstandene Boden muss als System aufgefasst und beschrieben werden.