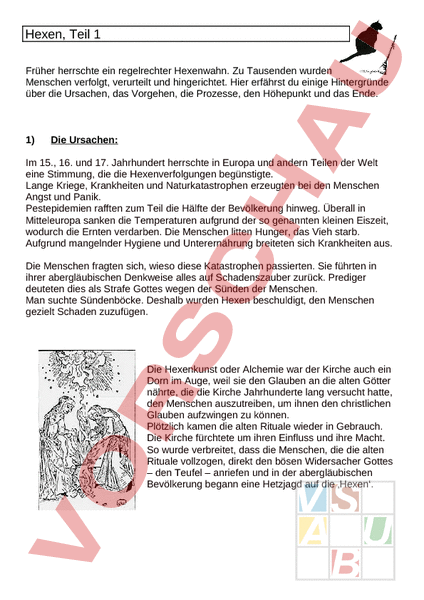Arbeitsblatt: Hexenverfolgung Text
Material-Details
Kurzer Text über Ursachen, Vorgehen, Prozess und Ende der Hexenverfolgung
Geschichte
Anderes Thema
5. Schuljahr
3 Seiten
Statistik
77974
941
11
04.03.2011
Autor/in
Regina Mollet
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Hexen, Teil 1 Früher herrschte ein regelrechter Hexenwahn. Zu Tausenden wurden Menschen verfolgt, verurteilt und hingerichtet. Hier erfährst du einige Hintergründe über die Ursachen, das Vorgehen, die Prozesse, den Höhepunkt und das Ende. 1) Die Ursachen: Im 15., 16. und 17. Jahrhundert herrschte in Europa und andern Teilen der Welt eine Stimmung, die die Hexenverfolgungen begünstigte. Lange Kriege, Krankheiten und Naturkatastrophen erzeugten bei den Menschen Angst und Panik. Pestepidemien rafften zum Teil die Hälfte der Bevölkerung hinweg. Überall in Mitteleuropa sanken die Temperaturen aufgrund der so genannten kleinen Eiszeit, wodurch die Ernten verdarben. Die Menschen litten Hunger, das Vieh starb. Aufgrund mangelnder Hygiene und Unterernährung breiteten sich Krankheiten aus. Die Menschen fragten sich, wieso diese Katastrophen passierten. Sie führten in ihrer abergläubischen Denkweise alles auf Schadenszauber zurück. Prediger deuteten dies als Strafe Gottes wegen der Sünden der Menschen. Man suchte Sündenböcke. Deshalb wurden Hexen beschuldigt, den Menschen gezielt Schaden zuzufügen. Die Hexenkunst oder Alchemie war der Kirche auch ein Dorn im Auge, weil sie den Glauben an die alten Götter nährte, die die Kirche Jahrhunderte lang versucht hatte, den Menschen auszutreiben, um ihnen den christlichen Glauben aufzwingen zu können. Plötzlich kamen die alten Rituale wieder in Gebrauch. Die Kirche fürchtete um ihren Einfluss und ihre Macht. So wurde verbreitet, dass die Menschen, die die alten Rituale vollzogen, direkt den bösen Widersacher Gottes – den Teufel – anriefen und in der abergläubischen Bevölkerung begann eine Hetzjagd auf die ‚Hexen‘. Hexen, Teil 2 2) Das Vorgehen: Der Papst in Rom erliess ein Gesetz, wonach die Gläubigen verpflichtet waren, nach Ketzern ( Irrgläubige) zu fahnden und sie anzuzeigen. Die Zeugen wurden geheim gehalten und auch der Prozess fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Verteidiger wurden nicht zugelassen und eine Berufung für den Verurteilten gab es nicht. Dagegen war aber die Folter gestattet. Unter der grausamen Folter hatten die Angeklagten keine Chance und gaben auch die verrücktesten Sachen zu. Die Kirche war fest entschlossen, diese Teufelsanbeter auszurotten. Die Strafen waren drastisch: Lebenslanger Kerker oder am häufigsten der Scheiterhaufen. Der Wahn der Hexenverfolgung wütete hauptsächlich in grossen Teilen Europas (England, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Polen, Finnland), aber auch in amerikanischen Kolonien. Papst Innozenz VIII. erliess im 15. Jahrhundert Gebote, wie gegen die tödliche Gefahr der Hexerei vorzugehen sei. 3) Der Prozess: Um einen Hexenprozess in Gang zu setzen, war es notwendig, dass jemand angeklagt wurde. Gewöhnlich setzten missgünstige Nachbarn, Verwandte oder Untergebene einen Hexenverdacht in die Welt. Dazu genügte bereits ein vages Gerücht. Oft wurde eine Anklage nur aus Hass, Willkür oder Neid erhoben. Die Richter hatten die Pflicht, jedem Verdacht nachzugehen. Das Urteil wurde schnell gefällt und war endgültig. Folgende Merkmale und Verhaltensweisen wurden zu den Indizien gezählt: Häufiger oder mangelnder Kirchenbesuch, Aufenthalt auf einem Feld vor einem Unwetter, Verwandtschaft oder Freundschaft mit einer bereits verurteilten Hexe, ein schlechter Ruf, geringes Körpergewicht, Muttermale usw. Es wurden vor allem Frauen der Hexerei angeklagt, weil sie früher als minderwertig, schwach, treulos, redselig und leicht beeinflussbar galten. Doch auch angebliche Hexenmeister oder später gar Kinder wurden angeklagt. Vor allem Menschen, die die Kirche kritisierten oder medizinische Fähigkeiten und Kenntnisse besassen. Angeklagte kamen vor Gericht. Der Richter war meist ein Mann der Kirche oder ein Untertan des Königs. Hexen, Teil 3 Eigentlich gab es genaue Regelungen einer Prozessführung, aber die Richter rechtfertigten ihr schreckliches Vorgehen damit, dass Hexerei ein so abscheuliches Verbrechen sei und die ganze Menschheit bedrohe. Zum Beispiel war die Wiederholung einer Folter gesetzlich verboten, aber die Richter bezeichneten die verbotene Wiederholung einfach als „Fortsetzung und somit war sie gestattet. Angesichts dieser Methoden hatte eine angeklagte Person kaum eine Chance. Gab sie nicht die gewünschte Antwort, wurde sie einfach so lange gequält, bis sie gestand, ohnmächtig zusammenbrach oder gar starb. Zwar waren bei den Prozessen manchmal Verteidiger zugelassen, diese getrauten sich aber kaum einzugreifen, aus Angst, selber in Verdacht zu geraten. Auch die „Hexenprobe wurde angewandt: Dabei wurden die Angeklagten nackt und gefesselt ins Wasser geworfen. Wenn sie an der Oberfläche blieben, waren sie schuldig, denn das Wasser, welches als Element der Reinheit galt, hatte sie abgestossen. Wenn die Verurteilten nicht schon während der Folter gestorben waren, wurden sie fast ausnahmslos zum Tod auf dem Scheiterhaufen verurteilt. Diese Hexenverbrennungen waren öffentliche Schauspiele, um die Zuschauer abzuschrecken. 4) Höhepunkt und Ende: In Frankreich begann die Hexenverfolgung zuerst. Sie erreichte Ende des 16. Jahrhunderts ihren Höhepunkt. Jedoch war Frankreich auch das erste Land, das den Hexenwahn wieder abstellte. Ludwig XVI schaffte 1682 die Hexenverfolgung ab. Die letzte Hexe Europas (Anna Göldin) wurde 1782 im Kanton Glarus in der Schweiz geköpft. Unter den Opfern der Hexenverfolgung befanden sich Arbeiter, Beamte und Adelige. Sogar Priester und Kinder wurden von der Verfolgung nicht ausgenommen. Geschichtsforscher rechnen heute mit ca. 100000 hingerichteten Opfern in ganz Europa.