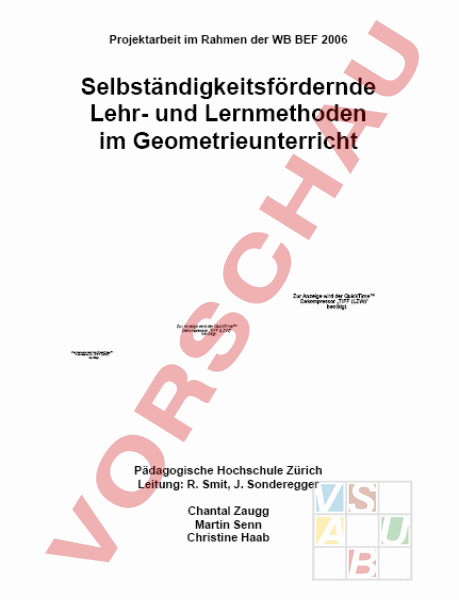Arbeitsblatt: Zentrische Streckung
Material-Details
Projektarbeit im Rahmen der WB BEF 2006: Selbständigkeitsfördernde Lehr- und Lernmethoden; Thema Zentrische Streckung Inklusive Arbeitsblätter, Lernziele, Schülertheorie
Geometrie
Anderes Thema
8. Schuljahr
20 Seiten
Statistik
782
2775
112
29.03.2006
Autor/in
Martin Senn
Rietlirain 17
8713 Uerikon
8713 Uerikon
032 510 32 08
079 216 11 45
079 216 11 45
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Projektarbeit im Rahmen der WB BEF 2006 Selbständigkeitsfördernde Lehr- und Lernmethoden im Geometrieunterricht Zur Anzeige wird der QuickTime Dekompressor „TIFF (LZW) benötigt. Zur Anzeige wird der QuickTime Dekompressor „TIFF (LZW) benötigt. Zur Anzeige wird der QuickTime Dekompressor „TIFF (LZW) benötigt. Pädagogische Hochschule Zürich Leitung: R. Smit, J. Sonderegger Chantal Zaugg Martin Senn Christine Haab Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 2 Einleitung. 3 Ziele. 3 Theoretische Grundlagen des Lernens aus konstruktivistischer Sicht. 4 Folgerungen für den Unterricht 5 Beschrieb des Arbeits- und Gruppenprozesses 6 Interview mit F. Keller 7 Persönliche Reflexion 8 Quellenangabe 9 Anhang Lernziele „Zentrische Streckung Arbeitsplan „Zentrische Streckung Einstiegsaufgabe „Figuren sortieren Theorieblätter „Zentrische Streckung Lernaufgaben „Streckenteilung Partnerwettbewerb „Figuren einpassen Arbeitsblatt „Figuren einpassen Lernaufgabe „Zentrische Streckung im Alltag WB BEF 2006 Seite 2 Einleitung Im Rahmen der Weiterbildung für Berufseinsteiger hatten wir die Gelegenheit, uns vertieft mit einem uns wichtigen Thema auseinander zu setzen. Schon bald waren wir uns einig, etwas zur Geometrie zu machen. Wir machten im Berufsalltag ähnliche, zum Teil frustrierende Erfahrungen mit dem obligatorischen Lehrmittel. Wir stellten fest, dass die SchülerInnen sehr oft Mühe haben, selbständig mit diesem Buch zu arbeiten. Die wenigsten Aufgaben können ohne Hilfestellung der Lehrperson gelöst werden. Dies wirkt sich negativ auf die Motivation der SchülerInnen aus und erschwert eine Individualisierung des Geometrieunterrichts erheblich. Aus diesem Grund wollten wir uns mit diesem Sachverhalt genauer auseinander setzen. Unser Ziel war nicht, ein neues Lehrmittel zu entwerfen, sondern einen Weg zu finden, wie wir mit Hilfe anderer Lehr- und Lernmethoden den SchülerInnen den Zugang zu den bestehenden Aufgaben vereinfachen können. Neben dem theoretischen Aspekt war es uns wichtig, die Praxisnähe nicht zu verlieren. So beschlossen wir, ein Kapitel des Geometrielehrmittels nach unseren neu gewonnenen Erkenntnissen umzusetzen. Ziele • • • • • Erkennen unserer Probleme im Geometrieunterricht durch Reflexion unseres Umgangs mit dem Lehrmittel Entdecken neuer Lehr- und Lernstrategien Kennenlernen anderer Lehrmittel und Erstellen eines Anforderungsprofils für ein ideales Lehrmittel Überprüfen unseres Anforderungsprofils an ein Lehrmittel anhand eines Interviews mit F. Keller Exemplarische Umsetzung der neuen Erkenntnisse WB BEF 2006 Seite 3 Theoretische Grundlagen des Lernens aus konstruktivistischer Sicht Primäre Funktion des Gehirns ist es, überlebenswirksames Verhalten zu erzeugen. Zur Erfüllung dieser Funktion entwickelt es – ausgehend vom vorhandenen Wissen – laufend Hypothesen. Den Sinnesorganen weist das Gehirn die Aufgabe zu, die Hypothesen zu überprüfen. Es gibt keine Übertragung realer Fakten ins Gehirn. Sinneseindrücke werden in einen neutralen Code übertragen. Was daraus wird, hängt unter anderem vom Zielort ab. So konstruiert sich das Gehirn mit Hilfe seines Wissensbestandes Wahrnehmungen aus wenigen Elementen. Mentalen Prozessen entsprechen physiologische Aktivitäten in und zwischen Gehirnzellen (Neuronen). Dabei werden aktive Verbindungen zwischen Neuronen verstärkt. Ungebrauchte Verbindungen verkümmern mit der Zeit. So baut das aktive Gehirn sich ein Leben lang um und verändert damit seine Möglichkeiten: Es lernt. Emotionen, Bewertung und bewusste Vernetzung von Sinneseindrücken beeinflussen deren Verarbeitungstiefe und damit die Verankerung im Gehirn und die spätere Verfügbarkeit der mentalen Inhalte. Diese neurobiologischen Erkenntnisse stützen eine konstruktivistische Lerntheorie. Die SchülerInnen konstruieren sich ihre Welt selbst. Direkte Belehrung gibt es nicht. Lehrmittel bieten den Lernenden die Lernumgebung, die ihnen Erfahrungen und Emotionen ermöglichen. Die Lehrperson arrangiert die Lernsituation und ermöglicht damit soziale Interaktionen, die für das Lernen entscheidend sind. Doch schlussendlich bestimmt der Lernende, was und wie er lernt. WB BEF 2006 Seite 4 Folgerungen für den Unterricht 1. Freude erleichtert das Lernen Wer Freude hat ist motiviert und lernt gerne. Emotionen steuern den Zugang zu einem Thema. Deshalb soll das Spielerische, neben dem Traditionellen, im Geometrieunterricht einen wichtigen Platz einnehmen. 2. Positive soziale Interaktionen erleichtern das Lernen Das Arbeiten in Lerngruppen erweitert die Lernmöglichkeiten durch Austausch von Erkenntnissen. Verschiedene Lernstrategien können so erfahren werden. Der soziale Kontakt fördert das Wohlbefinden und damit die Motivation. 3. Solide sprachliche Fähigkeiten vertiefen das Lernen Wer formuliert, versteht besser. Wenn SchülerInnen sprachlich formulieren und kommentieren können, verbessern sich nicht nur ihre sprachlichen Fähigkeiten, sondern vertiefen auch das Verständnis der gestellten Aufgaben. Die schriftliche Reflexion des Lernprozesses ist ein wichtiger Bestandteil des Geometrieunterrichts. 4. Individualisierung ermöglicht niveaugerechtes Lernen Die SchülerInnen haben unterschiedliche Vorwissen, Lernstrategien und Interessen. Durch vielfältiges Material finden sie subjektiv sinnvolle Zugänge zu den jeweiligen Aufgabenbereichen. 5. Eigenverantwortung übernehmen für das Lernen Jeder Schüler ist selber verantwortlich für sein Lernen. Durch Transparenz der Anforderungen und sorgfältiger Führung der Lehrperson gelingt es den SchülerInnen, selbständig zu entscheiden, welche Aufgaben sie lösen müssen, um ihr Ziel zu erreichen. 6. Problemorientierung fördert die Motivation Alltagsbezogene Problemstellungen versetzen die Lernenden in die Rolle des Forschers und der Forscherin. Dies motiviert und löst eigenständige Lernprozesse aus. WB BEF 2006 Seite 5 Beschrieb des Arbeits- und Gruppenprozesses Die Terminplanung und Organisation des Projekts war sehr gut. Da die Planung in gemeinsamer Arbeit entstanden ist und alle dahinter stehen konnten, hatten wir ein gemeinsames Ziel vor Augen. Dies hat wesentlich zum Gelingen der Projektarbeit beigetragen. In der ersten Phase unserer Projektarbeit tauschten wir unsere Erfahrungen mit dem Geometrielehrmittel aus. Wir überlegten uns, welches seine Stärken und Schwächen sind. Daraus entwickelten wir ein Anforderungsprofil, welches ein für uns ideales Geometrielehrmittel erfüllen müsste. Anhand dieser Kriterien untersuchten wir in der Mediothek verschiedene Lehrmittel. Schon bald schieden einige davon aus. Wir konzentrierten uns ab diesem Zeitpunkt auf das mathbu.ch und das Geometrielehrmittel des sabe-Verlags. Um uns bewusst zu werden, wieso uns diese Lehrmittel ansprachen, beschäftigten wir uns mit ihren methodischen und didaktischen Grundlagen. Daraus ergaben sich Ergänzungen in unserem Anforderungsprofil. Als Vorbereitung fürs nächste Treffen setzten wir im Hohl im Kapitel „Zentrische Streckung Lernspuren. Eine Spur für die stärkeren und eine für die schwächeren Sek SchülerInnen. Beim nächsten Treffen diskutierten wir unsere Ergebnisse und suchten einen Konsens. Im weiteren Verlauf wurde uns bewusst, dass die Aufgaben des Hohl-Lehrmittels unsere neu definierten Ziele für den Unterricht nicht zur vollständigen Zufriedenheit erfüllen. Wir überlegten uns, wie wir die Aufgaben verändern oder ergänzen könnten. Dazu sichteten wir ein weiteres Mal die beiden anderen Lehrmittel. Dabei stiessen wir auf einige interessante Lernaufgaben, die wir an geeigneter Stelle einbauten. Zudem entwickelten wir eigene alltagsbezogene Aufgaben, um unsere Ziele (siehe Folgerungen 1. bis 6.) besser erfüllen zu können. In einer weiteren Sitzung überdachten wir die Theorieteile des Kapitels „Zentrische Streckung. Wir passten auch diese soweit an, um auch in diesem Bereich den SchülerInnen Gelegenheit zu selbstständigerem Arbeiten zu ermöglichen. Vor allem ging es uns um die Versprachlichung einer Einsicht beziehungsweise eines Problems. Weiter stellten wir ergänzende Unterlagen zusammen und überdachten nochmals die früher gesetzten Lernspuren. Wir erkannten, dass die Zeit nicht mehr reicht um ein weiteres Kapitel vertieft zu bearbeiten. In der Schlussphase raubte uns das Layouten und Zusammenstellen der Präsentation viel Zeit. Wir sind jedoch mit dem Resultat zufrieden. Die Projektarbeit in unserer Gruppe haben wir als sehr positiv erlebt. WB BEF 2006 Seite 6 Interview mit F. Keller Die spannende Arbeit an unserem Projekt hat noch zu einem Nebenprodukt geführt. Wir haben uns überlegt, wie denn ein ideales Lehrmittel für uns aussehen müsste. Wir sind zu folgendem Anforderungsprofil gekommen (mit F. Keller überarbeitete Version): • • • • • • • • • • • • • Realitätsnahe, motivierende Aufgaben, die im Erfahrungsbereich der Jugendlichen liegen Ansprechendes Layout (übersichtlich, gut strukturiert, attraktiv) Leicht verständliche Formulierungen (Fachsprache so weit wie nötig) Abwechslungsreiche Aufgabenstellungen Schwierigkeitsgrad und Gewichtung einer Aufgabe sollen erkennbar sein (Lernspur) Ausformulierte Lernziele Genügend Übungs- und Arbeitsmaterial für alle Lernstufen Problemlöseaufgaben Handlungsorientierung Fordert zur Reflexion des eigenen Lernens auf (Lerntagebuch) Handliches Format Schülergerechte Theorie Orientierung an den Anforderungen weiterer Ausbildungen (Mittelschulen) Obwohl dies nicht das Kernthema unseres Projektes ist, haben wir aus persönlichen Interessen ein Interview mit F. Keller organisiert. Er hat ein Grobkonzept für das neue Mathematiklehrmittel des Kantons Zürich ausgearbeitet. Sein Ziel ist es, bis im Sommer 2010 dieses grosse Vorhaben zu realisieren. Wir haben uns an den folgenden Fragestellungen orientiert. Die kursiv gedruckten Antworten geben einen Überblick über das interessante Gespräch. Fragestellungen: • Welche der Punkte unseres Anforderungsprofils für ein Lehrmittel wurden beachtet? Besonders hervorgehoben hat er die Handlungsorientierung, das Problemlösen und allgemein die Wichtigkeit vollständig abgeschlossener Denkprozesse. • Hat man sich daran orientiert, was man, ausgehend vom Hohl, verändern möchte? Oder an anderen Kantonen? Oder an politischen oder wirtschaftlichen Interessen? Oder neuesten Erkenntnissen aus der Lernforschung? Hauptsächlich an den neuesten Erkenntnissen der Lernforschung. Auch gesellschaftliche Forderungen (z.B. Thema Geld/Schulden) sollen einfliessen. • Welche Schwerpunkte wurden gesetzt? Durch verschiedene Themenhefte soll der Lehrperson das Setzen unterschiedlicher Schwerpunkte (thematische und methodisch-didaktische) ermöglicht werden. • Wann kann man mit dem neuen Lehrmittel rechnen? Auf das Schuljahr 2010/2011. WB BEF 2006 Seite 7 Persönliche Reflexion Chantal Zaugg Ich bin mit dem Resultat unserer Projektarbeit sehr zufrieden. Im Rahmen dieser Weiterbildung hatte ich endlich mal Zeit, mich intensiv mit meinem Sorgenkind Geometrie auseinander zu setzen. Die Reflexion meines eigenen Geometrieunterrichts und der Austausch darüber in der Gruppe zeigte mir, wieso ich mit diesen Lektionen nicht ganz zufrieden bin. Durch die Sichtung verschiedener Lehrmittel und die intensiven Diskussionen ist mir bewusst geworden, wie ich es besser machen kann. Der spannendste Teil unseres Projekts war für mich das Umsetzen unserer Erkenntnisse auf ein Kapitel. Diese Arbeit hat mir Spass gemacht. Ich freue mich darauf, dieses Thema mit meinen Klassen durch zu nehmen! Gerne würde ich das für alle Geometriekapitel so detailliert und durchdacht weiterführen, jedoch wird mir dafür wohl die Zeit fehlen. Allerdings habe ich Erkenntnisse gewonnen, die auch ohne stundenlanges Vorbereiten erfolgreichen und motivierenden Geometrieunterricht ermöglichen. Zudem werde ich vermehrt auch Aufgaben und Ideen aus anderen Lehrmitteln einsetzen. Martin Senn Durch die vertiefte Auseinandersetzung mit dem Themenbereich zentrische Streckung und der Frage wie man in diesem Bereich einen selbstständigkeits-fördernden Geometrieunterricht gestalten kann, habe ich einige neue Erkenntnisse und Ideen für meinen Geometrieunterricht gewonnen. Motivation für die Arbeit waren die immer wieder frustrierenden Erlebnisse im Umgang mit dem offiziellen Geometrielehrmittel. Ich fragte mich, wie ich, gestützt auf dieses Lehrmittel, einen Geometrieunterricht gestalten kann, der meinen eigenen Ansprüchen gerecht wird. Schon am ersten Projekttag merkte ich, dass ich mit meinem Problem nicht alleine war. Durch das Studium verschiedener Lerntheorien wurden mir diese eigentlich nicht neuen Grundsätze wieder stärker bewusst. Damit klärten sich auch meine Kritikpunkte am Geometrielehrmittel. Bei der Arbeit merkte ich dann, dass es gar nicht so einfach ist, im genauer betrachteten Themenbereich Aufgabenstellungen und Lernsituationen zu kreieren, die meinen hohen Anforderungen gerecht werden. Trotzdem bin ich mit unserer Umsetzung für das Kapitel „zentrische Streckung zufrieden, und ich freue mich darauf, diese schon bald im Unterricht umsetzen zu können. Christine Haab Im Rahmen dieser Projektarbeit konnte ich ein für mich relevantes Unterrichtsthema genauer betrachten und in der Projektgruppe diskutieren. Es schien mir so, als stünden wir alle an ähnlichen Problemen an und auch das eigentliche Ziel der Arbeit war schnell gefunden. Weniger Krampf und mehr Spass im Geometrieunterricht für Schüler und Lehrperson! Vor allem die Diskussion der didaktisch-methodischen Grundsätze des Geometrieunterrichts und der Austausch von Erfahrungen waren sehr spannend. So gehe ich nun mit vielen neuen Ideen und Strategien in meine Klasse zurück. WB BEF 2006 Seite 8 Quellenangabe • • mathmu.ch, Klett und Balmer Verlag, Zug, 1. Ausgabe 2004 Geometrie 3, sabe Verlag, 1. Ausgabe 2005 WB BEF 2006 Seite 9