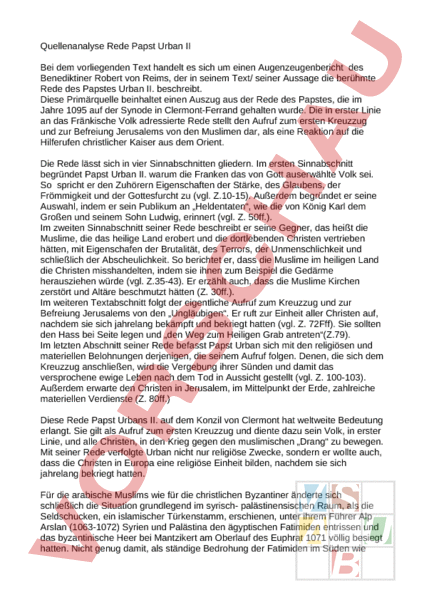Arbeitsblatt: Analyse Papst Urban II
Material-Details
Eine Redeanalyse von Papst Urban der II für den Geschichteunterricht in der Jahrgangsstufe 11
Geschichte
Anderes Thema
12. Schuljahr
2 Seiten
Statistik
78515
12954
72
13.03.2011
Autor/in
Raafat Mahmoud
Land: Deutschland
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Quellenanalyse Rede Papst Urban II Bei dem vorliegenden Text handelt es sich um einen Augenzeugenbericht des Benediktiner Robert von Reims, der in seinem Text/ seiner Aussage die berühmte Rede des Papstes Urban II. beschreibt. Diese Primärquelle beinhaltet einen Auszug aus der Rede des Papstes, die im Jahre 1095 auf der Synode in Clermont-Ferrand gehalten wurde. Die in erster Linie an das Fränkische Volk adressierte Rede stellt den Aufruf zum ersten Kreuzzug und zur Befreiung Jerusalems von den Muslimen dar, als eine Reaktion auf die Hilferufen christlicher Kaiser aus dem Orient. Die Rede lässt sich in vier Sinnabschnitten gliedern. Im ersten Sinnabschnitt begründet Papst Urban II. warum die Franken das von Gott auserwählte Volk sei. So spricht er den Zuhörern Eigenschaften der Stärke, des Glaubens, der Frömmigkeit und der Gottesfurcht zu (vgl. Z.10-15). Außerdem begründet er seine Auswahl, indem er sein Publikum an „Heldentaten, wie die von König Karl dem Großen und seinem Sohn Ludwig, erinnert (vgl. Z. 50ff.). Im zweiten Sinnabschnitt seiner Rede beschreibt er seine Gegner, das heißt die Muslime, die das heilige Land erobert und die dortlebenden Christen vertrieben hätten, mit Eigenschafen der Brutalität, des Terrors, der Unmenschlichkeit und schließlich der Abscheulichkeit. So berichtet er, dass die Muslime im heiligen Land die Christen misshandelten, indem sie ihnen zum Beispiel die Gedärme herausziehen würde (vgl. Z.35-43). Er erzählt auch, dass die Muslime Kirchen zerstört und Altäre beschmutzt hätten (Z. 30ff.). Im weiteren Textabschnitt folgt der eigentliche Aufruf zum Kreuzzug und zur Befreiung Jerusalems von den „Ungläubigen. Er ruft zur Einheit aller Christen auf, nachdem sie sich jahrelang bekämpft und bekriegt hatten (vgl. Z. 72Fff). Sie sollten den Hass bei Seite legen und „den Weg zum Heiligen Grab antreten(Z.79). Im letzten Abschnitt seiner Rede befasst Papst Urban sich mit den religiösen und materiellen Belohnungen derjenigen, die seinem Aufruf folgen. Denen, die sich dem Kreuzzug anschließen, wird die Vergebung ihrer Sünden und damit das versprochene ewige Leben nach dem Tod in Aussicht gestellt (vgl. Z. 100-103). Außerdem erwarte den Christen in Jerusalem, im Mittelpunkt der Erde, zahlreiche materiellen Verdienste (Z. 80ff.) Diese Rede Papst Urbans II. auf dem Konzil von Clermont hat weltweite Bedeutung erlangt. Sie gilt als Aufruf zum ersten Kreuzzug und diente dazu sein Volk, in erster Linie, und alle Christen, in den Krieg gegen den muslimischen „Drang zu bewegen. Mit seiner Rede verfolgte Urban nicht nur religiöse Zwecke, sondern er wollte auch, dass die Christen in Europa eine religiöse Einheit bilden, nachdem sie sich jahrelang bekriegt hatten. Für die arabische Muslims wie für die christlichen Byzantiner änderte sich schließlich die Situation grundlegend im syrisch- palästinensischen Raum, als die Seldschucken, ein islamischer Türkenstamm, erschienen, unter ihrem Führer Alp Arslan (1063-1072) Syrien und Palästina den ägyptischen Fatimiden entrissen und das byzantinische Heer bei Mantzikert am Oberlauf des Euphrat 1071 völlig besiegt hatten. Nicht genug damit, als ständige Bedrohung der Fatimiden im Süden wie Oststroms im Westen errichteten sie mit der Hauptstadt ikonion das Sultanat von Ikonion, das etwa die Hälfte Kleinasiens umfasste. Byzanz hatte in diesen türkischen Seldschuken einen wesentliche intolerantenteren Gegner als die arabischen Fatimiden gefunden. Die heilige Stätten in Jerusalem blieben verloren, die Lage der dortigen Christen verschlechterte sich drastisch, die unter arabischer Duldung im 10. Jahrhundert auf sechtzehn und im 11. Jahrhundert auf einhundertsiebzehn schnell angewachsene Zahl der Wallfahrten aus Europa in das palästinensische Zentrum der Christenheit, die einzig noch dauerhafte Gemeinsamkeit von Katholiken und Orthodoxen, erfuhr nun die rohe Gewalt und unbarmherzige Verfolgung durch die Türken. Als sich auch der byzantinischer Kaiser Alexios I. Kommenos (1081-1118) dieser militanten Seldschuken nicht mehr erwehren konnte, sandte er unter Hinweis auf das gemeinsame religiöse Interesse im Frühjahr 1095 ein Hilferuf um abendländische Söldner an den Papst, in richtiger Einschätzung der wirklichen Machtverhältnisse und Hilfsaussichten. Papst Urban II. war ein zu gelehriger Mensch, um nicht diese immer noch bestehende Vorteile im Augenblick des Hilferufes aus Konstantinopel wahrzunehmen und jetzt in die Tat umzusetzen. Nur, das Ziel wandelte sich spätestens zwischen dem Frühjahr 1095 und dem 27 Nov. 1095: Die Hilfe sollte nämlich nicht an Konstantinopel zukommen, sondern dem Heiligen Land, nicht der Befreiung Kleinasiens, sondern der Befreiung der heiligen Stätten, vor allem des heiligen Grabes,aus den Händen der Ungläubigen. Wer die Hand auf Jerusalem legen konnte, dem gebührte der religiöse Vorrang. Der flammende Appell Papst Urbans II. zur Befreiung Jerusalems am 27. November 1095 auf der Synode zu Clermont in Südfrankreich (Urban war Franzose) traf nicht nur auf Zuhörer, die religiös und hochsensibilisiert waren, die ein neues Glaubens- Kampffeld gegen den Islam entdeckt hatten und die über die von zurückkehrenden Wallfahrern ausgemalten Gräueltaten der Seldschuken empört waren. Er erreichte auch Menschen, denen der Nahe Osten die Verheißung des Gelobten Landes war, wo man im Überfluss reiche Länder und große Schätze leicht erringen, Ruhm und Ansehen gewinnen Konnte. Ziele also, die infolge der „Primogenitur, die den ältesten Sohn zum Alleinerben des Grundbesitzes bestimmte und die übrigen leer ausgingen ließ, in Europa nicht mehr zu verwirklichen waren. Die Bauern erhofften Befreiung von drückenden Lasten der Grundherrschaft, von Armut und der Hoffnungslosigkeit, sich aus ihrem eindringen Knechtsstatus lösen zu können. Die Ritter würden als angesehen Leute gelten, wenn sie sich auf den Weg ins gelobte Land machen. Sie sahen schon größten Reichtum auf sich zukommen. Wenn all diese Vorstellungen nicht mit religiösen Vorteilen wie Sündenvergebung und dem Segen der Kirche zu verwirklichen waren, dann wird deutlich warum Papst Urbans II. Worte Europa ins Fieber der Kreuzfahrten fallen ließen.Historiker erzählen, dass nach dieser Rede Tausende in den Schlachtruf ausbrachen: „Deus lo volt, Gott will es, und sich zum Zeichen der bewaffneten Pilgerfahrt ein rotes Stoffkreuz vorne auf die Schulte nähten. Papst Urban II. galt als ein sehr guter Prediger. Er konnte schnell die Leute beeinflussen und sie dazu bringen Sachen zu machen, die er möchte. Er spielte oft mit der Psyche der Menschen und setzte sie schnell in Fieber.