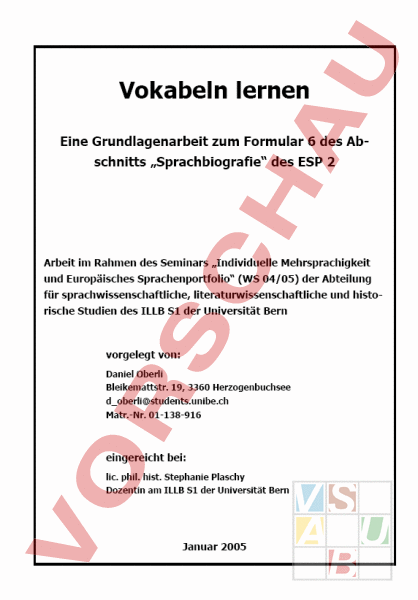Arbeitsblatt: Vokabeln lernen
Material-Details
Grundlegendes und Strategien zum Vokabeln lernen
Administration / Methodik
Lehr- und Lernformen
klassenübergreifend
18 Seiten
Statistik
8011
2872
36
10.07.2007
Autor/in
Daniel Oberli
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Vokabeln lernen Eine Grundlagenarbeit zum Formular 6 des Abschnitts „Sprachbiografie des ESP 2 Arbeit im Rahmen des Seminars „Individuelle Mehrsprachigkeit und Europäisches Sprachenportfolio (WS 04/05) der Abteilung für sprachwissenschaftliche, literaturwissenschaftliche und historische Studien des ILLB S1 der Universität Bern vorgelegt von: Daniel Oberli Bleikemattstr. 19, 3360 Herzogenbuchsee Matr.-Nr. 01-138-916 eingereicht bei: lic. phil. hist. Stephanie Plaschy Dozentin am ILLB S1 der Universität Bern Januar 2005 Inhaltsverzeichnis 1 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung. 2 2 Neurologische und kognitive Grundlagen. 3 2.1 Aufbau und Funktionsweise des Gehirns 3 2.2 Das Gedächtnis . 4 Inhaltsabhängige Gedächtnisformen 4 Speicherabhängige Gedächtnisformen . 5 Speicherung des Wissens 6 2.3 Lernen im Sinne von Wissenserwerb 6 Mnemotechniken 8 3 Vokabeln lernen. 9 3.1 Allgemeine Hinweise. 9 3.2 Vokabeln lernen im schulischen Unterricht . 10 3.3 Strategien für das individuelle Lernen von Vokabeln 11 Die Vokabelkartei. 11 Wortschatzheft, Wortschatzblätter 11 „Word Web, „Topic Page 12 Motorisches, mimisches, gestisches oder ganzkörperliches Lernen . 12 Kreative Wortbildtechnik, mentale Visualisierung, Merkverse, Eselsbrücken . 13 Übersetzungskuriositäten, skurrile visuelle Vorstellungsbilder . 13 Vokabeln lernen am Lektionstext 13 Vokabeln lernen mit Computer . 14 Vokabeln lernen mit Tonband, Audio-CD oder mp3-Dateien 14 Vokabeln lernen mit Reim und Rhythmus. 14 Schlüsselwortmethode 15 Expanded retrieval practice 16 4 Literaturverzeichnis 17 Einleitung 1 2 Einleitung Das Europäische Sprachenportfolio 2, also die Version für Kinder und Jugendliche, befasst sich im Abschnitt „Sprachbiografie grundsätzlich mit drei Themen, welche anhand mehrerer Formulare aufgeführt sind: erstens mit den bisherigen Erfahrungen in Bezug auf fremde Sprachen und Kulturen, zweitens mit den Zukunftsplänen in Bezug auf das interkulturelle Lernen und insbesondere auf das Fremdsprachenlernen und drittens mit Lerntechniken. Eines der Formulare zum Thema Lerntechniken ist überschrieben mit „Wie ich am erfolgreichsten Wörter lerne. Ich bin der Ansicht, dass die meisten Schülerinnen und Schüler und auch viele Lehrkräfte kaum mehr als zwei bis drei verschiedene Lerntechniken kennen respektive anwenden, und somit dieses Formular bei den meisten Schülerinnen und Schülern wohl fast leer bleibt. Deshalb habe ich mich entschieden, mich näher mit diesem Thema zu befassen. Im einführenden Teil der Arbeit lege ich die theoretische Basis, indem ich mich den neurologischen und kognitiven Grundlagen für das Lernen widme. Dabei geht es in erster Linie um den Aufbau und die Funktionsweise des Gehirns, die Funktionsweise des Gedächtnisses sowie um das Lernen als Wissenserwerb. Der Hauptteil der Arbeit, wo es konkret um das Lernen von Vokabeln geht, ist in drei Unterkapitel aufgeteilt. Im ersten Unterkapitel liefere ich allgemeine Hinweise zum Lernen von Vokabeln. Dabei schaffe ich auch die Bezüge zwischen dem theoretischen Einführungsteil und den konkreten Anregungen zum Lernen von Vokabeln. Im zweiten Unterkapitel gehe ich kurz auf die Thematik „Lernen von Vokabeln im Unterricht ein. Das dritte Unterkapitel dieses Teils ist das längste der vorliegenden Arbeit. Es ist überschrieben mit „Strategien für das individuelle Lernen von Vokabeln. In diesem Teil stelle ich verschiedene Methoden vor, die zum Lernen von Vokabeln praktisch angewendet werden können. Es ist vollkommen klar, dass diese Zusammenstellung nur einen ganz kleinen Teil der bis heute entwickelten Strategien zum Lernen von Vokabeln beinhaltet, denn schlussendlich muss jeder Lernende eine individuell auf sich zugeschnittene Strategie entwickeln, mit der er erfolgreich arbeiten kann. In diesem Sinn sind die hier vorgestellten Methoden als Anregungen für das eigenständige Experimentieren zu verstehen. Neurologische und kognitive Grundlagen 2 3 Neurologische und kognitive Grundlagen 2.1 Aufbau und Funktionsweise des Gehirns (nach ZIMBARDO/GERRIG 2004: 77-107) Das menschliche Gehirn besteht aus drei miteinander verbundenen Schichten: dem Hirnstamm, dem limbischen System und dem Grosshirn. Der Hirnstamm enthält Strukturen, welche die internen Prozesse des Körpers steuern, also autonome Prozesse wie Pulsfrequenz, Atmung, Schlucken und Verdauung. Er bestimmt auch den generellen Erregungszustand des Gehirns. Der Hirnstamm besteht aus fünf Teilen: dem verlängerten Rückenmark (Medulla oblongata), welches Atmung, Blutdruck und Herzschlag reguliert, der Brücke oder Pons, die das Rückenmark mit dem Gehirn verbindet, der Formatio reticularis, welche die Grosshirnrinde auf eintreffende sensorische Impulse hinweist und für die Aufmerksamkeit des Bewusstseins und das Erwachen aus dem Schlaf verantwortlich ist, dem Thalamus, der die sensorischen Impulse an die entsprechenden Areale der Grosshirnrinde weiterleitet und dem Kleinhirn (Cerebellum), das die Körperhaltung und -bewegung steuert. Das limbische System, welches den Hirnstamm umgibt, kontrolliert und regelt die Emotionen, die Motivation, das Gedächtnis und physiologische Funktionen wie Körpertemperatur, Blutzuckerspiegel etc. Es besteht aus drei Teilen: dem Hippocampus, der beim Erwerb expliziter Gedächtnisinhalte1 eine wichtige Rolle spielt, der Amygdala, welche die Emotionen kontrolliert und massgebend an der Ausbildung eines emotionalen Gedächtnisses beteiligt ist, sowie dem Hypothalamus, der die Aktivitäten des endoktrinen Systems2, Gleichgewichtszustände im Körper und motivationales Verhalten wie beispielsweise Essen und Trinken oder sexuelle Erregung reguliert. Das Grosshirn, welches zwei Drittel der Gehirnmasse ausmacht, ist verantwortlich für „die Regulierung höherer kognitiver und emotionaler Funktionen (S. 87). Es ist in zwei Hemisphären unterteilt, welche durch den Corpus callosum, einen gewaltigen Strang von Nervenfasern, der auch Balken genannt wird, verbunden sind, damit ein Informationsaustausch zwischen den Hemisphären möglich ist. Die Gehirnforschung 1 2 „Gedächtnisinhalte, die man bewusst abrufen kann (S. 86) „das Netz von Drüsen, das Hormone produziert und in die Blutbahn entlässt (S. 93) Neurologische und kognitive Grundlagen 4 hat ergeben, dass die Hauptsteuerzentren für viele verschiedene Funktionen genau auf der Grosshirnrinde lokalisiert werden können. Aufgrund dieser Erkenntnisse und der Studien mit Split-Brain-Patienten3 wird heute angenommen, dass bei den meisten Menschen das logische und analytische Denken sowie die Steuerung der Sprache in erster Linie in der linken Hirnhälfte geschieht, während die rechte Hirnhälfte für Emotionen, Intuition, bildliche Vorstellungen sowie Rhythmus und Tonalität verantwortlich ist (vgl. z.B. EDELMANN 2000). Es ist jedoch erwiesen, dass an allen vom Gehirn gesteuerten Prozessen immer mehrere Hirnstrukturen beteiligt sind, die „zusammenarbeiten. Die Übermittlung von Information geschieht durch die Neuronen4 auf elektronischem (innerhalb der Neuronen) oder chemischem Weg (zwischen den Neuronen). 2.2 Das Gedächtnis (nach ZIMBARDO/GERRIG 2004: 291-342) Gedächtnis kann man definieren als „die Fähigkeit, Informationen zu speichern und abzurufen (S. 293). Gedächtnis ist also eine Form der Informationsverarbeitung. Oft wird das Gedächtnis als dreistufiger Prozess bestehend aus Enkodierung, Speicherung und Abruf betrachtet. Enkodierung bezeichnet den „Prozess, der eine mentale Repräsentation [der Information aus der externen Welt] im Gedächtnis aufbaut, Speicherung nennt man das „Behalten von enkodierter Information über eine Zeitspanne hinweg und Abruf meint „die Wiedergewinnung gespeicherter Information aus dem Gedächtnis (S. 297). Beim Abruf geht es somit darum, sich etwas zuvor Enkodiertes zu repräsentieren. Inhaltsabhängige Gedächtnisformen Es gibt grundsätzlich zwei verschiedene inhaltsabhängige Gedächtnisformen – das deklarative und das prozedurale Gedächtnis – und zwei verschiedene Arten des Gedächtnisgebrauchs – der implizite und der explizite. Das deklarative Gedächtnis ist das „Gedächtnis für Informationen wie Fakten und Ereignisse, das prozedurale Gedächtnis ist das „Gedächtnis, wie Dinge getan werden; die Art und Weise, wie perzeptuelle, kognitive und motorische Fertigkeiten erworben, aufrechterhalten und angewendet werden (S. 296). Das deklarative Gedächtnis wird manchmal noch zusätzlich unterteilt in das episodische Gedächtnis als Gedächtnis „für autobiografische Ereignisse und den Kon3 So werden starke Epileptiker genannt, denen das Corpus callosum operativ durchtrennt wurde, damit die heftige elektrische Aktivität, die epileptische Anfälle begleitet, nicht beide Hirnhälften schädigen kann. 4 Ein Neuron ist „eine Zelle im Nervensystem, die darauf spezialisiert ist, Informationen zu erhalten, zu verarbeiten und/oder auf andere Zellen zu übertragen (S. 97). Neurologische und kognitive Grundlagen 5 text, in dem sie auftraten und das semantische Gedächtnis, welches „generische kategoriale Gedächtnisinhalte, wie beispielsweise die Bedeutung von Wörtern und Konzepten bezeichnet (S. 315). Wird das Gedächtnis explizit gebraucht, dann erfordert dies eine bewusste Anstrengung zur Wiedergewinnung von Informationen. Beim impliziten Gebrauch des Gedächtnisses sind die Informationen durch Gedächtnisprozesse, die ohne bewusste Anstrengung ablaufen, verfügbar. Speicherabhängige Gedächtnisformen Man kann die Gedächtnisformen nicht nur nach Inhalt einteilen, sondern auch nach Speicherkapazität und Zeit, in welcher der Inhalt abrufbar ist. Das bekannteste Modell geht dabei von drei Gedächtnisformen aus: dem sensorischen, dem Kurzzeit- und dem Langzeitgedächtnis. Oft stellt man sich diese drei Gedächtnisformen als Orte vor, wohin die Inhalte abgelegt werden. Dies ist aber nicht zutreffend. Es ist besser, sich diese Formen als Mechanismus vorzustellen, „der die kognitiven Ressourcen auf eine kleine Menge mentaler Repräsentationen hin bündelt (S. 303). Das sensorische Gedächtnis, auch sensorisches Register genannt, „bewahrt eine genaue Repräsentation der physikalischen Eigenschaften sensorischer Reize für die Dauer von einigen Sekunden oder weniger (S. 300). Beim Kurzzeitgedächtnis handelt es sich um „Gedächtnisprozesse, die kürzliche Erfahrungen aufrechterhalten und Informationen aus dem Langzeitgedächtnis abrufen (S. 302). Das Kurzzeitgedächtnis besitzt eine begrenzte Kapazität und speichert die Informationen nur kurz. Durch Wiederholen der Inhalte kann die Speicherdauer verlängert und durch sinnvolles Zusammenfassen von einzelnen unzusammenhängenden Informationen zu bedeutungsvollen Informationseinheiten, sogenannten Chunks, die Speicherkapazität vergrössert werden. Das Langzeitgedächtnis umfasst „Gedächtnisprozesse zum Behalten von Informationen für den Abruf zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt (S. 309). Seine Speicherkapazität ist praktisch unbegrenzt. Das Langzeitgedächtnis basiert auf Strukturen, nach denen das Wissen geordnet ist. Eine bekannte Struktur sind die Konzepte; „sie werden gebildet, wenn Gedächtnisprozesse Klassen von Objekten oder Vorstellungen mit gemeinsamen Merkmalen zusammenfassen (S. 326). Die Prototypen der einzelnen Konzepte stellen dabei jeweils „das repräsentativste Exemplar einer Kategorie (ebd.) dar. Konzepte können oft auch als bedeutungsvolle Anordnungen gespeichert sein, welche hierarchisch geordnet sind. Eine andere Struktur sind die Schemata, hochkomplexe Cluster von Wissen, die sich auf Objekte, Menschen und Situationen beziehen. Der Psychologe Gerd Mietzel definiert diese folgendermassen: „Als Schema bezeichnet Neurologische und kognitive Grundlagen 6 man das allgemeine Wissen über ein Ereignis oder einen Gegenstand, das auf der Grundlage vorausgegangener Erfahrungen entstanden ist (Cohen, 1989); ein Schema fasst bedeutsame Merkmale von Reizgegebenheiten in abstrakter Form zusammen. (MIETZEL 1998: 195). Die unzähligen Konzepte und Schemata sind untereinander netzartig verknüpft, da die meisten Informationen nicht nur zu einem einzelnen Konzept oder Schema gehören. Speicherung des Wissens Vereinfacht gesagt werden die Inhalte des Kurzzeitgedächtnisses „als Aktivierungen von Neuronen – also als Hirnaktivität – gespeichert, die Inhalte des Langzeitgedächtnisses jedoch unabhängig von der Hirnaktivität „in Form von Verbindungen zwischen Neuronen als Hirnstruktur bestehend aus stabilen Proteinketten, wobei das Langzeitgedächtnis nach neuesten Untersuchungen vermutlich labiler ist als bisher angenommen 9.12.04). Die ganzen Abläufe und Zusammenhänge sind äusserst komplex und auch noch nicht vollständig erforscht. Ebenfalls unmöglich ist – jedenfalls bis heute – die genaue Lokalisation von bestimmten physikalischen Gedächtnisrepräsentationen. Dies hängt unter anderem damit zusammen, dass bei kognitiven Prozessen jeweils verschiedenste Gehirnregionen aktiv sind. 2.3 Lernen im Sinne von Wissenserwerb (nach STEINER in KRAPP/WEIDENMANN 2001: 164-204 und MIETZEL 1998: 181-246) Lernen im Sinne von Wissenserwerb ist gemäss dem Basler Psychologieprofessor Gerhard Steiner „ein bereichsspezifischer, komplexer und mehrstufiger Prozess, der die Teilprozesse des Verstehens, Speicherns und Abrufens einschliesst und der unter der Voraussetzung, dass diese drei genannten Prozesse günstig verlaufen auch zum Gebrauch (.) des erworbenen Wissens führen kann (STEINER in KRAPP/WEIDENMANN 2001: 164). Etwas knapper formuliert kann Lernen im Sinne von Wissenserwerb auch als „der Aufbau und die fortlaufende Modifikation von Wissensrepräsentationen (ebd.) definiert werden; es geht dabei also um das Aufbauen von neuen und Anpassen von bestehenden mentalen Wissensstrukturen. Beim Erwerben von Wissen geht es für den Lernenden zuerst einmal darum, die Fülle von ankommenden Reizen zu filtern und die Aufmerksamkeit auf ganz bestimmte Informationen zu richten. Das aufmerksame Wahrnehmen, das hier gefordert ist, besteht im Grunde genommen aus einem Vergleich der neuen Informationen mit den In- Neurologische und kognitive Grundlagen 7 halten des Langzeitgedächtnisses. Eine Information, die aufmerksam wahrgenommen wird, gelangt dann vom sensorischen Register ins Kurzzeitgedächtnis; alle Informationen, die nicht – bewusst oder unbewusst – aufmerksam wahrgenommen werden, gehen sofort wieder verloren. Im Kurzzeitgedächtnis erfolgt dann die aktive Verarbeitung der neuen Informationen. Dabei wird zuerst in einem komplexen Prozess Vorwissen aktiviert, damit anschliessend ein Verknüpfen der neuen Informationen mit dem Vorwissen möglich wird. Die dadurch entstehenden Verknüpfungen sind von unterschiedlicher Art: es gibt beispielsweise kausale, logisch-implikative, zeitliche, finale oder modale Relationen. Ist dieser Prozess der aktiven Informationsverarbeitung, in der Fachsprache Elaboration genannt, zumindest teilweise erfolgreich, dann gelangen neue Informationen ins Langzeitgedächtnis und werden dauerhaft gespeichert. Wenn solche gespeicherte Informationen abgerufen werden, dann wird einerseits deren Speicherung gestärkt und andererseits das Abrufen dieser Informationen trainiert, was dazu führt, dass das nächste Abrufen dieser Informationen müheloser und schneller erfolgt. Es ist offensichtlich, dass das Vorwissen ein entscheidender Faktor für das Lernen im Sinne von Wissenserwerb darstellt. Wer über geeignetes Vorwissen verfügt und dieses auch problemlos abrufen kann, lernt schneller, leichter und nachhaltiger. In diesem Zusammenhang sagt David Ausubel denn auch: „Wenn ich die gesamte Pädagogische Psychologie auf nur ein einziges Prinzip zu reduzieren hätte, würde ich folgendes sagen: Der wichtigste Einzelfaktor, der das Lernen beeinflusst, ist das, was der Lernende bereits weiss. (MIETZEL 1998: 191). Daneben gibt es aber auch noch weitere Faktoren, die für den Wissenserwerb förderlich sind. Gerd Mietzel führt in Bezug auf das schulische Lernen in erster Linie die folgenden auf: Der Lernende soll motiviert sein, dem Unterrichtsmaterial und seiner Verarbeitung hohe Aufmerksamkeit entgegenzubringen. Zur Verarbeitung soll er ausreichend Zeit zur Verfügung haben und auch nutzen können, denn es ist die aktive Auseinandersetzung mit den neuen Informationen, die dazu führt, dass diese dauerhaft gespeichert werden. Das Lernmaterial soll geordnet dargeboten werden, denn dadurch werden bestehende Beziehungen leichter sichtbar und wichtige Aspekte werden hervorgehoben. Dies führt dazu, dass dem Lernenden die Verknüpfung der neuen Informationen mit dem Vorwissen leichter fällt. Ergänzende Beispiele zum Lernmaterial bieten neue Verknüpfungsmöglichkeiten zum Vorwissen und sind deshalb ebenfalls sehr hilfreich. Durch Vergleiche werden neue Informationen leichter vorstellbar und konkreter, sie erhalten eine Ordnung, und der Lernende wird aktiviert, Neues und Bekanntes aktiv zu assimilieren. Neurologische und kognitive Grundlagen 8 Begriffe und abstrakte Definitionen sollten möglichst einen Bezug zu konkreten Situationen haben, damit der Lernende auch lernen kann, wie sie verwendet werden. Präinstruktionale5 Massnahmen wie vorangestellte Einordnungshilfen oder Übersichten sollen den Lernenden auf das neue Material einstellen und die Lücke zwischen dem neuen Material und den Vorkenntnissen überbrücken. Mnemotechniken Wenn etwas gelernt werden muss, bei dem die Anknüpfungspunkte im Vorwissen fehlen, dann kommt der Lernende nicht um das mechanische Auswendig-Lernen herum. Aber auch hier gibt es gewisse Strategien, die das Lernen unterstützen. Dazu gehören unter anderem die sogenannten Mnemotechniken, „Methoden zur Förderung des Behaltens (MIETZEL 1998: 239). Der Psychologe Werner Stangl schreibt dazu: Mnemotechniken sind Gedächtnisverfahren, deren Ursprung auf die Antike zurückgeht. Es gibt verschiedene Verfahren, alle haben jedoch gemein, dass die Gedächtnisleistung durch eine Assoziation der einzuprägenden Wörter, Sätze oder Zusammenhänge mit bildhaften Vorstellungen gesteigert wird. (.) Interessanterweise beruht der Erfolg von Mnemotechniken darauf, dass Informationen in einen gemeinsamen Kontext gebracht werden, die an sich in keinem logischen oder natürlichen Zusammenhang stehen. Lebhaftigkeit von Bildern fördert deren Einprägbarkeit. Reim und Rhythmus wirken ebenfalls behaltensfördernd, dadurch wird zusätzlich zum bildlichen das akustischmotorische Gedächtnis angesprochen. Farbe, sofern sie sparsam und eindeutig genutzt wird, ist vor allem im grammatikalischen Bereich sinnvoll mnemotechnisch einzusetzen. In der Lexik6 kann durch farbliche Markierungen die Aufmerksamkeit auf Ausnahmen, Schwierigkeiten oder Besonderheiten gelenkt werden. Die Einflüsse emotionell besetzter oder besonders bizarrer Gedächtnisbilder ist zwar noch nicht eindeutig geklärt, aber selbstgenerierte Bilder haben leichte Vorteile gegenüber vorgegebenen Bildern, da hier die eigene Kreativität besser angespornt wird. Dies trifft jedoch nur zu, wenn die Qualität der selbstgeschaffenen Bildmetaphern ebenso hoch ist wie die der vorgegebenen . 18.12.04) Eine dieser Mnemotechniken, die Schlüsselwort-Methode, werde ich im nächsten Kapitel ausführlicher darstellen, da sie sich besonders gut zum Lernen von Vokabeln einer Fremdsprache eignet. Mit solchen Methoden zur Förderung der Behaltensleistung wird jedoch nie erreicht werden können, dass das Gelernte dauerhaft zum Abruf aus dem Langzeitgedächtnis zur Verfügung steht; Mnemotechniken beugen einfach dem raschen Vergessen etwas vor. 5 6 dem eigentlichen Unterricht vorangestellte Wortschatz einer Fachsprache Vokabeln lernen 3 9 Vokabeln lernen 3.1 Allgemeine Hinweise Im Licht des vorigen Kapitels gibt es einige Dinge, die beim Lernen von Vokabeln allgemein berücksichtigt werden sollten, damit die Arbeit des Lernenden möglichst effizient wird. Besonders herausstreichen möchte ich folgende Punkte: Damit die neuen Vokabeln wenigstens ins Kurzzeitgedächtnis gelangen, muss der Lernende die Aufmerksamkeit auf diese richten. Beim individuellen Lernen geschieht dies automatisch, beim Lernen im Unterricht kann dies von der Lehrkraft durch eine aussergewöhnliche Präsentation erreicht werden (vgl. KIEWEG 2002: 5). Eine didaktische Methodenvielfalt und ein rhythmisierter Unterricht tragen ebenfalls viel zu einer erhöhten Aufmerksamkeit der Lernenden bei. Wenn die neuen Vokabeln „durch einen individuellen Relevanzfaktor Betroffenheit der Lernenden auslösen (KIEWEG 2002: 5), dann erhöht dies die Behaltensleistung. In die gleiche Richtung zielt in diesem Punkt der Psychologe Lutz Götze, wenn er sagt, dass „nur jene Informationen, die für das jeweilige Individuum wichtig sind (POLLETI 2000: 9) im Gedächtnis gespeichert werden. Sollen die neuen Vokabeln dauerhaft gespeichert werden, ist es für den Lernenden unerlässlich, sich aktiv damit auseinanderzusetzen. Dies geschieht beispielsweise beim Ordnen der neuen Vokabeln nach verschiedenen Gesichtspunkten, im Unterricht bei der Beschäftigung mit Vokabelübungen, beim Versuch, die Vokabeln in der Zielsprache zu umschreiben oder bei der Verwendung der Vokabeln im Sprachgebrauch. Für diese aktive Auseinandersetzung mit neuen Vokabeln sollte genügend Zeit zur Verfügung stehen. Wenn möglich sollte bei jeder neuen Vokabel Vorwissen aktiviert werden, mit dem diese Vokabel verknüpft und so in ein bereits bestehendes Wissenscluster integriert werden kann (vgl. z.B. ASSBECK 2000). Werden die neuen Vokabeln multisensorisch vermittelt respektive wahrgenommen (visuell, auditiv, haptisch, motorisch, etc.), dann werden verschiedene Gehirnregionen aktiviert, was zu einer erfolgreicheren Speicherung der neuen Information beiträgt, da die verschiedenen Wahrnehmungen alle einzeln gespeichert aber auch gleich untereinander verknüpft werden (vgl. KIEWEG 2002: 5). So bieten sich auch mehr Möglichkeiten, die neuen Informationen mit Vorwissen zu verknüpfen. Eine geordnete Darbietung der neuen Vokabeln erleichtert die Einordnung ins mentale Informationsnetz ebenfalls, da mehrere neue Vokabeln aufgrund der bereits bestehenden Verknüpfung gleichzeitig eingeordnet werden können. Auch hier bieten Vokabeln lernen 10 sich mehr Möglichkeiten, die neuen Informationen mit Vorwissen zu verknüpfen. Sind die Vokabeln nicht geordnet, kann sie der Lernende auch selber ordnen, und zwar beispielsweise nach Wortfamilien, thematisch, nach Bedeutung ( Synonyme, Antonyme), nach Wortarten, nach Wortbausteinen, nach Klang oder nach Reim (vgl. z.B. HINZ 1999, HOLTWISCH 2000 oder KIEWEG 2003). Handelt es sich bei den neuen Vokabeln nicht um Nomen, dann sollten sie eigentlich nicht ohne Kontext gelernt werden, damit der Lernende später auch fähig ist, diese Vokabeln im Sprachgebrauch korrekt zu verwenden (vgl. z.B. FINGER 1997). Ruhephasen in Form von Entspannungsübungen oder Schlaf bieten dem Hirn Gelegenheit, das neu Gelernte richtig ins mentale Informationsnetz einzuordnen (vgl. z.B. ZIMBARDO/GERRIG 2004: 218f. oder SCHIFFLER 2003: 83). Deshalb kann es gut sein, dass neu gelernte Vokabeln am nächsten Morgen besser „sitzen als direkt nach der aktiven Lernphase. Neben diesen Punkten ist für mich der sogenannte „Hawthorne-Effekt ebenfalls beachtenswert. Er besagt, „dass durch veränderte bzw. neue Lernbedingungen Leistungssteigerungen erzielt werden können (SCHIFFLER 2003: 83). Daraus ergibt sich, dass es beim Lernen von Vokabeln günstig ist, wenn der Lernende verschiedene Methoden miteinander kombiniert. 3.2 Vokabeln lernen im schulischen Unterricht Unter den Experten besteht Uneinigkeit in der Frage, ob die fremdsprachlichen Vokabeln vorzugsweise im Unterricht oder zu Hause gelernt werden sollen. Am erfolgversprechendsten ist für mich eine Kombination der beiden Lernorte: die neuen Vokabeln sollten im Unterricht eingeführt und semantisiert werden, damit die Lernenden diese anschliessend zu Hause lernen und üben können; danach sollten sie im Unterricht in authentischen Schreib- und Sprechsituationen praktisch verwendet werden können, damit sie noch besser im Gedächtnis der Lernenden gespeichert werden. Diese Einführung der neuen Vokabeln im Unterricht kann dabei auf ganz verschiedene Art und Weise erfolgen (vgl. z.B. NIEWELER/RELLEKE 2000). Ein zentraler Punkt dabei ist, dass die Schülerinnen und Schüler selber aktiv sind, also zum Beispiel die Bedeutung neuer Vokabeln anhand eines Bildes oder Textes selber erschliessen oder neue Vokabeln einer zweisprachigen Liste selbstständig sinnvoll gruppieren. Daneben gelten die allgemeinen Hinweise, welche ich im vorangehenden Kapitel erwähnt habe. Eine weitere Ausführung dieses Punktes ist im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich, da der Hauptschwerpunkt auf dem individuellen Lernen von Vokabeln liegt. Vokabeln lernen 11 3.3 Strategien für das individuelle Lernen von Vokabeln Die Vokabelkartei Die Vokabelkartei ist neben dem Lernen mit den klassischen Wortgleichungen die Standardmethode zum Lernen von Vokabeln. Da ich deshalb davon ausgehe, dass sie allgemein bekannt ist, bespreche ich sie im Rahmen dieser Arbeit nicht näher. Interessierte Leserinnen und Leser seien auf die beiden Beilagen zu den Nummern 1/1995 und 2/1995 der Zeitschrift „Der fremdsprachliche Unterricht Englisch von Ute Rampillon (RAMPILLON 1995) sowie die Internetseiten kurs/lern-05.htm und stangl-taller.at/ARBEITSBLAETTER/LERNTECHNIK/ Lernkartei.shtm verwiesen; dort finden sich diesbezüglich detaillierte Informationen. Wortschatzheft, Wortschatzblätter (nach HOLTWISCH 2000) Herbert Holtwisch propagiert anstelle der allseits bekannten kleinen Vokabelheftchen, in welche in der ersten Spalte die fremdsprachlichen Vokabeln und in der zweiten jeweils die muttersprachlichen Entsprechungen notiert werden, ein Wortschatzheft – respektive einzelne Wortschatzblätter im DIN-A4-Format –, in welches die Vokabeln nach individuell ausgewählten Ordnungskriterien eingetragen werden. In einem solchen Heft ist genügend Platz da, um die Vokabeln in einem „Word Web zu vernetzen, Beispielsätze zu ergänzen, damit die Vokabeln im richtigen Kontext gelernt werden, Visualisierungen zu zeichnen etc. Die beiden grössten Vorteile einzelner Blätter sind, dass diese fortlaufend ergänzt und individuell geordnet werden können. Letzteres entbindet den Lernenden von der Chronologie des verwendeten Lehrmittels. Bezüglich der Gestaltung der einzelnen Blätter oder Seiten schlägt Holtwisch vor, vier Spalten zu machen, diese aber nicht durchzuziehen, damit Kästchen, „Word Webs und bildliche Illustrationen über die ganze Seitenbreite gemacht werden können. In die erste Spalte soll jeweils die neue Vokabel eingetragen werden, die zweite Spalte ist gedacht für allfällige Aussprachehilfen, in der dritten Spalte soll ein Satz notiert werden, in welchem die neue Vokabel im richtigen Kontext verwendet wird; in der vierten Spalte ist schliesslich noch Platz für weitere Ergänzungen, Lernhinweisen, Merkhilfen und eventuell die muttersprachliche Entsprechung. Ich finde es interessant, dass Holtwisch offensichtlich davon ausgeht, dass fremdsprachliche Vokabeln in vielen Fällen ohne die entsprechenden muttersprachlichen Wörter gelernt werden können, wenn genügend andere Informationen zu den einzelnen Vokabeln vorhanden sind. Wenn dies tatsächlich der Fall ist, dann wäre das Vokabeln lernen 12 äusserst förderlich für das Denken in der Zielsprache, was wiederum zu einer weniger holprigen Sprachverwendung führen würde. „Word Web, „Topic Page (nach HINZ 1999) Mit „Word Web und „Topic Page werden zwei unterschiedliche Darstellungsweisen bezeichnet, welche auf der Vernetzung von Wörtern basieren. Das „Word Web ist „die visuelle netzartige Präsentation der Beziehung zwischen Wörtern und Wendungen in einem lexikalischen Feld, in ihm „werden Assoziationswörter und Wendungen wie bei einem Mind Map auf von einem Zentralbegriff ausgehenden Verästelungen bildhaft dargestellt (S. 349). Die nebenstehende Abbildung zeigt ein mögliches „Word Web zum englischen Wort street. „Word Web zu street Die „Topic Page dient dem gleichen Zweck wie das „Word Web, ist aber nicht netzartig strukturiert, sondern zweigeteilt. Dies ermöglicht „die Aufnahme der themenbzw. situationsbezogenen Lexik im linken Teil und bietet im rechten Teil Raum für kollokative7, orthographische oder grammatikalische Besonderheiten (S. 350). Motorisches, mimisches, gestisches oder ganzkörperliches Lernen (nach KIEWEG/KIEWEG 2002: 21-22 und SCHIFFLER 2003: 84) Wenn es die Vokabeln erlauben, sollten sie unbedingt auch motorisch, mimisch, gestisch oder ganzkörperlich gelernt werden, denn dadurch werden sie nicht nur als Schrift- und Klangbild gespeichert, sondern auch noch gemeinsam mit einer physischen Aktivität. Durch diese physische Aktivität erhalten die Vokabeln einen emotionalen Gehalt, was die Behaltensleistung nachweislich erhöht. Die lernpsychologischen Forschungen zeigen zudem auch, dass das Abrufen eines gespeicherten Gedächtnisinhalts erfolgreicher ist, wenn dieser multisensorisch gespeichert ist. Englische Vokabeln, die in Verbindung mit einer physischen Aktivität gelernt werden können, sind beispielsweise to scribble: „hinkritzeln (motorisch), stunned: „verblüfft (mimisch), horrified: „entsetzt (gestisch) oder to turn round: „sich umdrehen (ganzkörperlich). 7 die Reihenfolge betreffend Vokabeln lernen 13 Kreative Wortbildtechnik, mentale Visualisierung, Merkverse, Eselsbrücken Bei diesen vier Methoden geht es für den Lernenden darum, die neuen Vokabeln so zu gestalten, dass sie für ihn einen emotionalen Gehalt bekommen und somit erfolgreicher gespeichert werden können. Die kreative Wortbildtechnik ist besonders geeignet für gestalterisch begabte Lernende, die anderen greifen eher auf die Technik der mentalen Visualisierung zurück, bei der das Bild nur im Kopf gemacht wird. Merkverse basieren meistens auf Reim und Rhythmus, was die Behaltensleistung verbessert (siehe weiter unten). Eselsbrü- Beispiele zur kreativen Wortbildtechnik (aus KIEWEG/KIEWEG 2002: 21) cken verbinden die neuen Vokabeln mit bereits bekanntem Wissen; dadurch können sie ins mentale Wissenscluster integriert werden. Übersetzungskuriositäten, skurrile visuelle Vorstellungsbilder (nach KIEWEG/KIEWEG 2002: 22-23) „Durch die Verfremdung der Muttersprache, die für jeden Lernenden affektiv besetzt ist, lassen sich hohe Erinnerungsleistungen erzielen. So können Wörter und Strukturen mühelos behalten werden, wenn sie dem muttersprachlichen Gebrauch in irgendeiner Form zuwiderlaufen. (S.22) Beispiele: a) operating theatre: „operierendes Theater (Operationssaal); b) Where do you live?: „Wo tust du wohnen? Auch die Vorstellung skurriler Bilder zu bestimmten Wörtern kann die Behaltensleistung stark verbessern. Beispiel eines skurrilen visuellen Vorstellungsbildes (aus KIEWEG 2002: 7) Diese Methoden eignen sich aber nicht für alle Vokabeln, da es nur bei einer begrenzten Auswahl möglich ist, eine kuriose Übersetzung oder ein skurriles Bild zu kreieren. Vokabeln lernen am Lektionstext (nach LÜBKE 2000) Bei dieser Technik schreiben die Lernenden zuerst einen Abschnitt des Lektionstexts ab und lassen einen sehr breiten Rand. Anhand geeigneter Zusatzaufgaben beschäftigen sich die Lernenden dann mit den im Text vorkommenden Wörtern. Eine mögliche Zusatzaufgabe ist beispielsweise alle Nomen zu unterstreichen und sie anschliessend ne- Vokabeln lernen 14 ben dem Text nach Geschlecht geordnet aufzulisten, eine andere alle Wörter, die zu einem bestimmten Themenfeld gehören, zu suchen, geordnet aufzulisten und mit weiteren passenden Wörtern aus dem Wörterbuch zu ergänzen. Vokabeln lernen mit Computer Der Computer bietet ebenfalls viele Möglichkeiten, um das Lernen von Vokabeln effizienter zu machen. Es gibt verschiedenste Programme, die auch unterschiedliche Funktionen aufweisen.8 Fast allen gemeinsam ist eine Random-Funktion, die es (analog der Vokabelkartei) ermöglicht, dass die neuen Vokabeln immer in einer anderen Reihenfolge auftauchen. Es gibt auch Programme mit einer Erinnerungsfunktion; diese bewirkt, dass Vokabeln, die der Lernende nicht korrekt übersetzt hat, häufiger abgefragt als Vokabeln, die er beherrscht. Vokabeln lernen mit Tonband, Audio-CD oder mp3-Dateien Diese Technik ist vor allem für diejenigen Lernenden geeignet, die am besten auditiv lernen. Dabei gibt es zwei Varianten: entweder hört der Lernende die zuvor aufgenommenen Vokabeln aufmerksam an, oder er lässt das Band, die CD oder die MP3Datei einfach im Hintergrund laufen, während er etwas anderes macht, damit die Vokabeln unterbewusst gespeichert werden können. Ob die unterbewusste Speicherung wirklich funktioniert, ist allerdings umstritten; der Lernende wird aber dadurch, dass er ständig Dinge in der Zielsprache hört, sicher vertrauter mit deren Klang. Diese Tatsache zeigt auch auf, dass es optimal wäre, wenn die Vokabeln von einem Sprecher aufgenommen würden, der die Zielsprache als Muttersprache hat, damit der Lernende sich nicht ein falsches Klangbild einprägt. Vokabeln lernen mit Reim und Rhythmus (nach STENZEL 1995) Klaus Stenzel hat mit seiner Schulklasse das Englischlehrmittel „Learning English – Red Line 2 von Winfried Stahl (STAHL 1993) erprobt, das mit Hilfe von rhythmischer Akzentuierung und Musikbegleitung beim Lernen von Vokabeln gezielt auch die rechte Hirnhälfte ansprechen will. Die englischen Vokabeln und die entsprechenden deutschen Übersetzungen werden dabei „durch den Rhythmus eng aneinandergekoppelt und erzeugen durch das Verständnis emotionale Reaktionen bzw. bildliche Vorstellungen (S. 186). Das durch Rhythmus und Musik entstehende markante innere Klangbild 8 Unter und kann je ein Freeware-Programm zum Lernen von Vokabeln heruntergeladen werden. Vokabeln lernen 15 soll das Behalten der Vokabeln fördern. Die Vokabeln werden meist nicht isoliert gelernt, sondern in einem meaningful context in Form einer Phrase, eines Kurzdialogs oder ähnlichem. Als Illustration führe ich im folgenden einige Zeilen der Vocabulary Page 6 der Unit 2 dieses Lehrmittels auf: 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Do you know who owns this land? It belongs to farmer. They heard him scout. They must rescue him. The arrows flew. bow Youre the only one for me. Please dont leave me alone. Weißt du, wem dieses Land gehört? Es gehört einem Landwirt. Sie hörten ihn schreien. Sie müssen ihn befreien. Die Pfeile flogen. Bogen Du bist die einzige für mich. Bitte lass mich nicht im Stich. Lernen mit Reim und Rhythmus (eigene Darstellung nach STAHL 1993: 6) Stenzel schreibt zur Erprobung: „Die Ergebnisse der Erprobung haben die Skepsis des Verfassers beiseite geschoben. Das Verfahren funktioniert. Natürlich mag die Begeisterung der Schüler im Laufe der Zeit abflachen, doch bei der Wiederholung der Vokabeln am Ende des Schuljahrs war nicht nur für den Verfasser erstaunlich, dass die mit Musik gelernten Vokabeln schneller parat waren als die auf herkömmliche Weise gelernten Wörter. (S. 188) Schlüsselwortmethode (nach MIETZEL 1998: 239-241) Diese oftmals sehr aufwändige aber nachweislich äusserst effektive Mnemotechnik beinhaltet drei Schritte, die ich an einem englischsprachigen Schüler, der das spanische Wort für Ente, pato, lernen will: 1. Für die fremdsprachliche Vokabel wird ein muttersprachliches Schlüsselwort gesucht, das ihr akustisch oder in der Schreibweise ähnelt. Der Schüler entscheidet sich für das englische Wort pot, das etwa mit „Topf übersetzt werden kann. 2. Zwischen der fremdsprachlichen Vokabel und dem Schlüsselwort wird eine feste Assoziation gebildet, indem das der fremdsprachlichen Vokabel entsprechende muttersprachliche Wort sowie das Schlüsselwort in einem sinnvollen Satz kombiniert werden. Der Schüler bildet folgenden Satz: „The duck has pot on its head. 3. Nun stellt sich der Lernende den konstruierten Satz noch bildhaft vor. Wie dies in unserem Beispiel aussehen könnte, zeigt die nebenstehende Abbildung. Visualisierung der gedanklichen Verbindung von pot („Topf) und pato („Ente) Vokabeln lernen 16 Expanded retrieval practice (nach STEINER in KRAPP/WEIDENMANN 2001: 174f.) Die „Expanded retrieval practice geht auf Robert A. Bjork zurück. Dieser hat in Bezug auf das Lernen von Einzelinhalten ein striktes „Abruftraining in immer grösser werdenden zeitlichen Intervallen (S. 174) vorgeschlagen. Der Erfolg dieser Technik wird darauf zurückgeführt, „dass nicht einfach die Speicherung verbessert wird, sondern dass der Prozess des Abrufens selbst eine qualitative Verbesserung erfährt (S. 175). Es gibt Hinweise darauf, dass auch das Lernen von Vokabeln mit dieser Methode erfolgversprechend ist, da sie die Abrufkapazität, die ja im Gegensatz zur Kapazität des Langzeitgedächtnisses nicht praktisch unbegrenzt ist, erhöht. Im Gegensatz zu den anderen hier vorgestellten Methoden werden bei der „Expanded retrieval practice keine Vorschläge gemacht, wie die neuen Vokabeln erstmals gelernt werden sollen; sie bezieht sich nur auf die Verbesserung der langfristigen Speicherung der neuen Gedächtnisinhalte. Literaturverzeichnis 4 17 Literaturverzeichnis ARENDT, Manfred (2002): Vokabeln lernen? Nein danke!, in: PRAXIS 3/2002, S. 299308 ASSBECK, Johann (2000): „Der Lehrer sollte öfter abfragen Vokabellernen zu Hause und im Unterricht, in: Der fremdsprachliche Unterricht Französisch 3/2000, S. 33-37 EDELMANN, Walter (2000): Lernpsychologie, 6. vollständig überarbeitete Auflage, Weinheim: Beltz FINGER, Hans (1997): Wieviel Kontext beim Wörterlernen im Englischunterricht?, in: PRAXIS 3/1997, S. 252-256 HINZ, Klaus (1999): Wörter vernetzen und anwenden, in: PRAXIS 4/1999, S. 347-356 HOLTWISCH, Herbert (2000): Vokabelhefte und Wortgleichungen – und sonst nichts?, in: PRAXIS 4/2000, S. 367-376 KIEWEG, Maria KIEWEG, Werner (2002): Systematische Wortschatzarbeit im Schulalltag, in: Der fremdsprachliche Unterricht Englisch 1/2002, S. 20-27 KIEWEG, Werner (2002): Die lexikalische Kompetenz zwischen Wunschdenken und Realität, in: Der fremdsprachliche Unterricht Englisch 1/2002, S. 4-10 KRAPP, Andreas WEIDENMANN, Bernd (Hrsg.) (2001): Pädagogische Psychologie, 4. vollständig überarbeitete Auflage, Weinheim: Beltz LÜBKE, Diethard (2000): „.und lernt die Vokabeln!, in: Der fremdsprachliche Unterricht Französisch 3/2000, S. 24-26 MIETZEL, Gerd (1998): Pädagogische Psychologie des Lernens und Lehrens, 5. vollständig überarbeitete Auflage, Göttingen: Hogrefe NIEWELER, Andreas RELLEKE, Ute (2000): Variatio delectat – Lektionseinführung und Semantisierung im Anfangsunterricht, in: Der fremdsprachliche Unterricht Französisch 3/2000, S. 14-18 POLLETI, Axel (2000): Vokabeln – zentrales Problem des Französischunterrichts?, in: Der fremdsprachliche Unterricht Französisch 3/2000, S. 4-10 RAMPILLON, Ute (1995): Das Lernen des Lernens fremder Sprachen: Die Vokabelkartei, in: Der fremdsprachliche Unterricht Englisch 1/1995 RAMPILLON, Ute (1995): Das Lernen des Lernens fremder Sprachen: Die Vokabelkartei (2), in: Der fremdsprachliche Unterricht Englisch 2/1995 Literaturverzeichnis 18 SCHÄFER, Werner (2003): 80 Vokabeln in einer Stunde?, in: PRAXIS 4/2003, S. 420-423 SCHIFFLER, Ludger (2003): Interhemisphärisches Lehren und Lernen im Fremdsprachenunterricht, in: PRAXIS 1/03, S. 82-89 STAHL, Winfried (1993): Learning English. Red Line 2. Vokabellernen mit Musik für Klasse 6 an Realschulen, Stuttgart: Klett STEINER, Gerhard (2001): Lernen und Wissenserwerb, in: KRAPP, Andreas WEIDENMANN, Bernd (Hrsg.) (2001): Pädagogische Psychologie, 4. vollständig überarbeitete Auflage, Weinheim: Beltz, S. 137-205 STENZEL, Klaus (1995): Vokabellernen mit Musik, in: PRAXIS 2/1995, S. 186-188 ZIMBARDO, Philipp GERRIG, Richard (2004): Psychologie, 16. aktualisierte Auflage, München: Pearson Education Deutschland GmbH stangl-taller.at/GEDAECHTNIS/ModelleSpeicher.shtml; 9.12.04 stangl-taller.at/LERNEN/Lernstrategien.shtml; 18.12.04 23.12.04 23.12.04 4.01.05 4.01.05