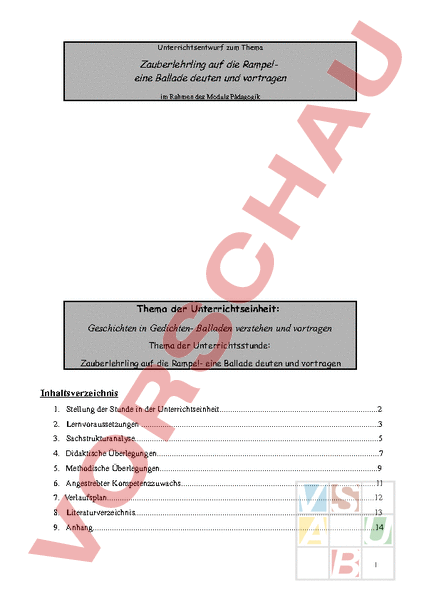Arbeitsblatt: Der Zauberlehrling
Material-Details
UE zum Thema Der Zauberlehrling
Deutsch
Leseförderung / Literatur
7. Schuljahr
18 Seiten
Statistik
80292
3416
48
17.04.2011
Autor/in
Katarzyna Behrendt
Land: Deutschland
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Unterrichtsentwurf zum Thema Zauberlehrling auf die Rampe!eine Ballade deuten und vortragen im Rahmen des Moduls Pädagogik Thema der Unterrichtseinheit: Geschichten in Gedichten- Balladen verstehen und vortragen Thema der Unterrichtsstunde: Zauberlehrling auf die Rampe!- eine Ballade deuten und vortragen Inhaltsverzeichnis 1. Stellung der Stunde in der Unterrichtseinheit2 2. Lernvoraussetzungen .3 3. Sachstrukturanalyse5 4. Didaktische Überlegungen7 5. Methodische Überlegungen9 6. Angestrebter Kompetenzzuwachs.11 7. Verlaufsplan.12 8. Literaturverzeichnis13 9. Anhang14 1 1. Stellung der Stunde in der Unterrichtseinheit Thema der Unterrichtseinheit: Geschichten in Gedichten- Balladen verstehen und vortragen St. Thema der Stunde Angestrebter Kompetenzzuwachs 1 Eine moderne Rap-Ballade- Die Schülerinnen und Schüler aktivieren ihr Vorwissen und Interesse zum das kennen wir doch! Thema Balladen, indem sie sich mit dem Inhalt und Form einer modernen Rap-Ballade Gedicht für Dich auseinandersetzen und den Bezug dieser Textsorte zur Gegenwart herstellen. 2 Die Ballade ist das Ur-Ei der Dichtung- die Merkmale einer Ballade untersuchen 3 John Maynard von Theodor Die Lernenden erklären, wie die Spannung in der Ballade John Maynard Fontane- eine Ballade erzeugt wird, indem sie die Wirkung der sprachlichen Mittel untersuchen, spannend vorlesen eine Spannungskurve der äußeren Handlung zeichnen und den Text dementsprechend vorlesen. Sie setzen sich produktiv mit dem Text auseinander, indem sie eine Grabinschrift für den Steuermann gestalten. 4 Der Zauberlehrling von J.W. Goethe- eine Ballade erschließen Die Schülerinnen und Schüler erweitern ihre Lesekompetenz, indem sie den Inhalt (äußere Handlung) der Ballade Der Zauberlehrling mithilfe von Lesetipps erschließen. 5 Zauberlehrling auf die Rampe! eine Ballade deuten und vortragen Die Lernenden vertiefen ihre Deutungskompetenz, indem sie die Empfindungen vom Zauberlehrling (innere Handlung) wahrnehmen und beschreiben. Sie erweitern ihre Lesekompetenz, indem sie ihre individuellen Vorstellungen und Empfindungen, die beim Lesen/Rezipieren entstehen, zum Ausdruck bringen und den Text involviert, flüssig und sinnverstehend vorlesen. Sie schlussfolgern, dass es für die gleichen Verse oft verschiedene Möglichkeiten der Realisierung gibt. 6 „Es ist noch kein Meister vom Himmel gefalleneinen Dialog zwischen dem Zauberlehrling und Meister szenisch darstellen Die Schülerinnen und Schüler erweitern ihre Urteilskompetenz, indem sie das Gespräch zwischen dem Zauberlehrling und Meister szenisch umsetzen und das Verhalten und Handlungsmotive vom Zauberlehrling beschreiben und beurteilen. Sie stärken ihre personale Kompetenz, indem sie die Aussage des Textes in Bezug zu ihrer eigenen Lebenswelt setzen und zum Schluss kommen, dass man manchmal seine Fähigkeiten überschätzt. Die Schülerinnen und Schüler benennen die Merkmale einer Ballade, indem sie die Ballade John Maynard von Theodor Fontane untersuchen. Die Lernenden versetzen sich in die Perspektive einer der Hauptfiguren 7-8 Die Rückkehr eines Verschollenen- Nis Randers (der Mutter) der Ballade Nis Randers hinein und nehmen ihre von Otto Ernst Empfindungen wahr, indem sie ihre Gedanken während der Rettungsaktion beschreiben. Sie erweitern ihre Medienkompetenz, indem sie die Ballade mit einem Sachtext (Zeitungsbericht) vergleichen und die Unterschiede benennen. Sie stärken ihre Lesekompetenz, indem sie die betonten und unbetonten Silben in der Ballade bestimmen und mit dem Metrum der Ballade Der Zauberlehrling vergleichen. 9 Die Ballade vom Nachahmungstrieb von Erich Kästner- einen Zeitungsbericht schreiben Die Schülerinnen und Schüler erweitern ihre Schreibkompetenz, indem sie zur Ballade vom Nachahmungstrieb einen Zeitungsbericht schreiben. Sie stärken ihre Medienkompetenz, indem sie den Bezug zwischen dem Zeitungsbericht und dem Verhalten der Jungen erkennen und die Wirkung der Medien auf die Menschen kritisch betrachten und beschreiben. 10 Wer/Was hat meinen Sohn umgebracht?- die Ballade Erlkönig von J.W. Goethe deuten Die Lernenden erweitern ihre Deutungskompetenz, indem sie die Ballade Erlkönig von J.W. Goethe untersuchen und eine mögliche Todesursache ermitteln. Sie stärken ihre Lesekompetenz, indem sie schlussfolgern, dass es verschiedene Interpretationsmöglichkeiten eines Textes gibt. 11 Der Knabe lebt und das Pferd ist tot!- zu der Ballade Erlkönig eine Parodie schreiben Die Schülerinnen und Schüler benennen die Merkmale der Textsorte Parodie, indem sie diese Heinz Erhardts Der König Erl entnehmen. Sie setzen sich mit der Ballade Erlkönig produktiv auseinander, indem sie zu dieser eine eigene Parodie schreiben. 2 12- Die Brückam Tay (28. Die Lernenden erweitern ihre Schreibkompetenz, indem sie das bereits erworbene Wissen anwenden, eine Ballade mithilfe des historischen 13 Dezember 1879) Hintergrunds zum Zeitungsbericht selbst schreiben und während der Schreibkonferenz selbständig überarbeiten. Sie vergleichen die Ergebnisse ihrer Arbeit mit der Ballade von Theodor Fontane. 14 Sabinchen war ein Die Schülerinnen und Schüler entwickeln ihre literarische Frauenzimmer- Moritat und Deutungskompetenz, indem sie die Moritat Sabinchen war ein Bänkelsang Frauenzimmer szenisch interpretieren. Sie erklären typische Merkmale des Bänkelsangs und beschreiben inhaltliche sowie formale Merkmale einer Moritat, indem sie Quizfragen für die Gruppe vorbereiten und beantworten. 15- Goethe vs. Die 16 Fantastischen Vier- wir rappen eine Ballade Die Lernenden benennen die Merkmale einer Rap-Fassung einer Ballade und setzen sich mit der Transformation einer selbst ausgewählten Ballade in eine andere Textsorte (Rap) auseinander. Sie erweitern ihre Kompetenz im Bereich Sprechen, indem sie unterschiedliche Sprechweisen und Darstellungsformen für ihren Vortrag auswählen und die Ballade rappen. 2. Lernvoraussetzungen Die Klasse R7a besteht aus 31 Schülerinnen und Schülern im Alter von zwölf bis vierzehn Jahren, wovon fünfzehn Mädchen und sechzehn Jungen sind. Die Lerngruppe habe ich mit dem Beginn des Schuljahres 2010/2011 zusammen mit Frau Ehls übernommen und unterrichte diese, nachdem ich einen Teil der Schüler bereits aus der Förderstufe kannte, mit vier Stunden in der Woche eigenständig. Die Lernenden stammen jeweils etwa zur Hälfte aus zwei verschiedenen Förderklassen, was sich auf das Unterrichtsgeschehen insofern auswirkte, dass sich die Lernenden erst einmal untereinander kennen lernen mussten. Obwohl der Prozess des Kennenlernens weitestgehend als abgeschlossen betrachtet werden kann, ist das alterstypische pubertäre Verhalten noch recht ausgeprägt. So suchen die Lernenden die Bestätigung in Peergroups und bilden ihre Individualität aus, was sich in der abnehmenden Konzentration auf den Lernstoff zugunsten persönlicher Gespräche und sogar in Auseinandersetzungen sowie durch pubertäres Imponiergehabe äußert. Nichtsdestotrotz sind diese Merkmale bei den Schülerinnen und Schülern der R7a unterschiedlich ausgeprägt. Sechs Schülerinnen und Schüler haben einen Migrationshintergrund. Zwar schlägt sich dieser bei einigen in einem weniger ausgeprägten Sprachvermögen nieder, jedoch weist die Lerngruppe keinerlei Schwierigkeiten auf, den sprachlichen Anforderungen des Unterrichts gerecht zu werden. Eine Schülerin (Franziska) besitzt eine anerkannte LRS, was bei ihr allerdings nicht so gravierend auffällt, da sie sich bemüht, dies mit sehr viel Fleiß zu kompensieren. Die Lerngruppe zeigte bisher ein relativ homogenes Leistungsspektrum sowie eine zufriedenstellende Lernbereitschaft, was an den Arbeitsergebnissen, dem Arbeitstempo und der Beteiligung der einzelnen zu erkennen ist. Die Schülerinnen und Schüler sind mit Engagement und Interesse im Deutschunterricht dabei. Die meisten arbeiten aktiv im Unterricht mit. Allerdings kann es vorkommen, dass sich dies nicht zwangsweise in einer entsprechenden Meldebeteiligung ausdrückt. Gerade einige schriftlich sehr starke Schülerinnen (Leonie, Johanna), die bei Ansprache 3 meinerseits qualitativ gute bis sehr gute Antworten geben, melden sich nicht immer freiwillig. Dies kann u.a. darauf zurückgeführt werden, dass die Jungen ein dominantes Verhalten aufweisen und im Unterricht recht präsent sind. Sie melden sich gerne zu Wort und wollen unbedingt ihre Ergebnisse präsentieren. Dies gilt insbesondere für Altan, Lucas und Felix, aber auch für Alica und Franziska. Die oben genannten Schülerinnen und Schüler sind stets bemüht den Unterricht voranzubringen, beteiligen sich kontinuierlich, haben tolle Ideen und arbeiten inhaltlich gut. Als Leistungsträger im Fach Deutsch sind Franziska, Johanna und Mercedes anzuführen, wobei die letztgenannte vom Gymnasialzweig, genauso wie Clara und Melina, herabgestuft wurde. Diese wie auch einige andere aus der Gruppe erledigen oft ihre Hausaufgaben nicht, weshalb ich auch in Absprache mit den Eltern die Teilnahme zu der mittwochs angebotenen Hausaufgabenbetreuung vereinbart habe. Prinzipiell lässt sich sagen, dass die Lernenden gerne ihre eigenen Meinungen äußern und dass man sie schnell für ein Thema begeistern kann. Das Lernverhalten der Schülerinnen und Schüler ist allerdings unterschiedlich und von der Tagesform und dem Unterrichtsthema abhängig. So hat die Klasse manchmal Schwierigkeiten, sich an die Klassenregeln zu halten. Die Lernenden rufen in die Klasse hinein, schreiben Briefe aneinander oder führen persönliche Gespräche, wobei im Vergleich zum letzten Halbjahr ein gewisser Fortschritt festgestellt werden kann. Die Dominanz der Jungen führt zusätzlich dazu, dass die Gruppe sehr lebhaft und häufig auch unruhig ist. Als wechselhaft ist das Verhalten von Nick (ADHS-Schüler) einzustufen. Er gilt als sehr begabt, zeigt ein rasches Auffassungs- und Denkvermögen und kann den Deutschunterricht enorm bereichern. Infolge mangelnder Konzentrationsfähigkeit gibt er jedoch sehr schnell auf, fängt an, zappelig zu werden und stört somit massiv den Unterricht. Das Klassenklima ist insgesamt als ausgewogen zu bezeichnen. Um die Integration der Schülerinnen und Schüler innerhalb der Klasse zu fördern, werden vom Klassenlehrer Eltern- und Schülergespräche geführt. Spezielle Lernvoraussetzungen Bezüglich der inhaltlichen Vorerfahrungen ist anzumerken, dass die Lernenden bereits erste Einblicke in das Thema Balladen erhalten haben, wobei der Schwerpunkt bis jetzt auf inhaltlicher und formaler Ebene lag. Dabei habe ich festgestellt, dass die Lerngruppe über differenzierte Vorkenntnisse bezüglich der literarischen Textsorten z.B. Gedichte verfügt. Sie haben sich anhand der Ballade John Maynard von Theodor Fontane mit den Merkmalen dieser Textsorte vertraut gemacht und können erklären, mithilfe welcher Mittel die Spannung erzeugt wird. Das spannende Vorlesen wurde ebenfalls geübt, wobei die Lernenden in erster Linie auf das Tempo sowie die Lautstärke ihrer Stimme zu achten hatten. Da während der ersten Unterrichtstunden vor allem der Bereich der inhaltlichen Sicherung sich als 4 schwierig herausstellte und die Verständlichkeit der ungewohnten Sprache einigen Schülerinnen und Schülern Schwierigkeiten bereitete, wurde die äußere Handlung der Ballade Der Zauberlehrling von J.W. Goethe im Unterricht ebenfalls bereits besprochen und die unbekannten Begriffe geklärt. Dies schien mir umso wichtiger, da das laute Vorlesen zusätzlich bei einigen den Verstehensprozess statt fördern noch erschweren könnte.1 Des Weiteren ist im Hinblick auf die Zielsetzung der vorliegenden Stunde eine didaktische Reduktion notwendig. Zu Beginn der Unterrichtseinheit habe ich festgestellt, dass die Lernenden sich über die Gedichte eher negativ geäußert und diese als langweilig bezeichnet haben. Demgegenüber begegneten sie dem Unterrichtsthema Balladen mit großem Interesse. Dies kann sicherlich darauf zurückgeführt werden, dass ich, um ihnen den Zugang zur Sprache und Metrik zu erleichtern, eine vertonte Version der betreffenden Ballade unterrichtsbegleitend vorgespielt habe. Ich konnte sogar feststellen, dass die Schülerinnen und Schüler die Balladen eigeninitiativ sich im Internet angehört haben und diese gar vor sich hin summen. Da die Klasse in diesem Halbjahr keinen Musikunterricht hat, habe ich leider keine Gelegenheit dieses Thema mit diesem Fach zu verknüpfen. Allerdings in Absprache mit der Kunstlehrerin, Frau Ehls, werden die Lernenden eine der im Deutschunterricht durchgenommenen Balladen bebildern. Zu den instrumentellen Vorerfahrungen ist anzuführen, dass die Schülerinnen und Schüler mit dem produktions- und handlungsorientierten Umgang mit literarischen Texten vertraut sind. Kreative Aufgaben, wie z.B. das szenische Spielen, werden von den Lernenden gerne angenommen. Somit sind sie methodisch mit dem Agieren vor der Klasse vertraut. Allerdings reagieren einige auf derartige Arbeitsformen mit Unruhe und Oberflächlichkeit, wobei andere wiederum einen zusätzlichen Anschub benötigen. Wechselnde Sozialformen, wie z.B. das Erarbeiten in Partner- bzw. Gruppenarbeit sind der Klasse zwar bekannt, funktionieren aber nicht immer. Abschließend bleibt abzuwarten, wie konzentriert die Schülerinnen und Schüler außerhalb des gewohnten Unterrichtsumfeldes (Klassenraum) aktiv am Thema mitarbeiten und der beabsichtigte Lernerfolg erzielt werden kann. 3. Sachstrukturanalyse Ursprünglich geht die Bezeichnung Ballade auf das italienische „ballata (Tanzlied) zurück. Dieser Begriff bezeichnete ein kurzes und strophisches Lied mit Refrain, das zu Reihen- und Kettentänzen gesungen wurde. Im Mittelalter gelangte die Ballade von Italien über Frankreich nach Deutschland und entwickelte sich zu einem Erzähllied,2 das meist von einem spektakulären Ereignis oder einer Heldentat handelte. Diese in „Gedichtform gesungenen Texte lassen sich der Volksballade zuordnen und fanden weitere Ausprägung im Bänkelsang und Moritat. 1 Vgl. Baurmann,J., Menzel, W.: Vorlesen-Vortragen. Basisartikel, in: Praxis Deutsch 199, Seelze-Velber 2006, S.6. 2 Vgl. Wilkening, N.: Balladen und Moritaten, Texte lesen- verstehen- erfahren, Müllheim an der Ruhr 2009, S. 5. 5 Erst im 18. Jahrhundert entwickelte sich neben der Volksballade die Kunstballade, die sich vor allem im Sturm und Drang sowie der Romantik großer Beliebtheit erfreute und ihren Höhepunkt im Jahr 1797 erreichte, in dem Goethe und Schiller ihre wohl berühmtesten Balladen schufen. Im 19. Jahrhundert entstanden neben der Kunstballade weitere Balladenarten wie z.B. die Kabarettballade (Tucholsky, Brecht und Kästner). In den 60er Jahren entwickelte sich im musikalischen Bereich daraus der sogenannte Protestsong, bekannt geworden durch Bob Dylan oder auch die Beatles. Auch heute noch finden sich Balladen fast ausschließlich in der Pop-Musik.3 Im Allgemeinen besteht keine verbindliche Form der Ballade. Da diese jedoch in Reimform (Lyrik) eine Geschichte (Epik) erzählt, die mit Dialogen (Drama) versehen ist, bezeichnete Goethe diese Textsorte als „Ur-Ei der Dichtung.4 Der Zauberlehrling wurde von J.W. Goethe 1797 geschrieben und zählt zu den sogenannten numinosen Balladen, die das Magisch-Irrationale beschreiben, auch als Geisterballaden bezeichnet. Der Handlungsablauf der Ballade präsentiert den Zauberlehrling, der in Abwesenheit seines Meisters in seiner Experimentierfreude und mit aller Selbstüberschätzung die Geister in seine Dienste nimmt. Als der zum Leben erwachte Besen immer mehr Eimer mit Wasser vom Fluss in das Haus bringt, stellt der zunächst übermütige Lehrling fest, dass er den benötigten Zauberspruch vergessen hat. Nachdem die Situation für ihn zunehmend auswegs- und aussichtsloser wird, erkennt der Zauberlehrling, dass er sich in seiner Zauberei übernommen und seine Fähigkeiten überschätzt hat. Er ruft verzweifelt nach seinem Meister, der die Mächte wieder unter Kontrolle bringt. Neben der äußeren weist die Ballade einen inneren Handlungsablauf auf, der die innere emotionale Befindlichkeit des Erzählers darstellt, die sich mit jeder Strophe verändert. „Die innere Verfassung des Sprechers, von Übermut und Triumphgefühl über Wut und Angst bis hin zur Verzweiflung, schlägt sich in den Worten nieder, die der Lehrling für das von ihm angerichtete Unheil bzw. Verursacher des Unheils findet.5 So äußert sich seine Hilfslosigkeit beispielsweise in den sich überbietenden Bezeichnungen für Besen und Wasser (Ausgeburt der Hölle, verruchter Besen, entsetzliches Gewässer), was das Bedrohliche zugunsten des heiteren Charakters entkräftet. Verstärkt wird dies aufgrund zahlreicher Kontraste wie z.B. zwischen der magischen Beschwörung des Lehrlings und ihrem belanglosen Zweck, zwischen Verzweiflung und Inkompetenz, dem Willen alleine zu zaubern und Hilferufen nach dem Meister. Damit wird mit der Ballade Zauberlehrling die lehrreiche Absicht verfolgt, die Menschen vor Selbstüberschätzung zu warnen und die Grenzen der menschlichen Natur zu erkennen.6 3 4 5 6 Vgl. Meyers Lexikonredaktion: Meyers Taschenlexikon, Bd. 2, 7. Auflage, Mannheim 2001, S. 28. Vgl. Brauer, R. u.a.: Wortstark 7. Hinweise und Materialien für Lehrerinnen und Lehrer, Hannover 2001, S. 83. Berger, N.: Stundenblätter Balladen, Unterrichtsmodelle für die Klassen 5-11, Stuttgart 2006, S. 28. Vgl. ebd.: S. 27. 6 4. Didaktische Überlegungen In der Jahrgangsstufe 7 sieht der Hessische Lehrplan für den Bildungsgang Realschule im Unterrichtsfach Deutsch den Umgang mit literarischen Texten vor. Hierzu eignen sich besonders die Texte, die in eine „Gegen- Welt versetzen, Brücken zum metaphorischen Verstehen schlagen, das Streben nach Selbstreflexion unterstützen sowie die Fragen persönlicher Verantwortung ansprechen. Sie sollen die Lernenden befähigen, hinter die Fassade einer Figur zu sehen, dem Interesse für die Deutung innerseelischer Vorgänge entgegenkommen, hinter Heiterkeit und Komik einen kritischen Kern verbergen.7 Dabei wird viel Wert darauf gelegt, dass handlungsbezogene Zugänge zu Texten und Möglichkeiten ihrer kreativen Verarbeitung genutzt werden.8 Im Bezug darauf bietet die vorliegende Unterrichtseinheit eine gute Möglichkeit, sich ganzheitlich mit der literarischen Textform Ballade auseinanderzusetzen, deren Inhalte zu durchdringen und für eigene Deutungen handlungs- und/oder textorientiert zu nutzen. Aufgrund ihrer Merkmale (vgl. Kpt.3) eignen sich Balladen besonders dafür, neben dem affektiven Ansatz, der die gesamte Sequenz begleitet, eine Auseinandersetzung mit deren äußeren Form (Reimformen, Stilmittel etc.) einzubeziehen. Im Verlauf der vorliegenden Reihe lernen die Schülerinnen und Schüler einen weiteren lyrischen Text kennen und bauen somit ihre „lyrischen Leseerfahrungen aus. Sie erweitern ihre Kompetenz, die Wirkung lyrischer Texte und deren verdichtete Sprache zu erkennen und darüber zu sprechen. Zwei Wirkungsabsichten werden dabei in der gesamten Unterrichtseinheit verfolgt: die unterhaltende und die mahnende, belehrende Wirkung. Somit wird ein weiteres wichtiges Ziel des Deutschunterrichts verfolgt, die Ausdrucksfähigkeit zu erweitern, den aktiven Umgang mit der Sprache sowie emotionale und ästhetische Sensibilität der Schülerinnen und Schüler zu fördern.9 Darüber hinaus sollen die Lernenden laut Bildungsstandards für das Fach Deutsch im Rahmen des Kompetenzbereiches Sprechen und Zuhören die Möglichkeit erhalten, bestimmte Rede- und Gesprächsstrategien zu entwickeln. Im Bezug auf monologische Formen der Darstellung sollen ihnen entsprechende Techniken vermittelt werden, die sich auf die konkrete Realisierung, die körperliche und stimmliche Ausführung (z.B. Blickkontakt, Mimik, Gestik, Betonung) sowie den Auftritt vor der Gruppe konzentrieren.10 Da die Balladen zu den Texten zählen, die geradezu auf das Sprechen hin organisiert sind und deren Sinn erst wirklich zum Ausdruck kommt, wenn man all die Elemente der Prosodie und noch dazu die der Mimik, Gestik der Sprecher mit erfasst, liegt einer der Schwerpunkte der vorliegenden 7 Vgl. Hessisches Kultusministerium: Lehrplan Deutsch, Bildungsgang Realschule, Jahrgangsstufen 5 bis 10, Wiesbaden 2002, S. 26. 8 Vgl. ebd: S. 8. 9 Vgl. Hessisches Kultusministerium: Bildungsstandards und Inhaltsfelder. Das neue Kerncurriculum für Hessen. Sekundarstufe - Realschule. Entwurf Deutsch, Zugriff: 03.04.201, S. 11. 10 Vgl. ebd.: S. 40. 7 Unterrichtseinheit darauf, das Lesen, das deutende Vorlesen sowie das szenische Vortragen zu fördern.11 Dabei steht im Zentrum zwar die Erfahrung, dass Vorlesen und Vortragen immer ein Akt der Textdeutung ist und sinnlich ästhetische Elemente ermöglicht, notwendig ist hierfür jedoch der Einsatz rhetorischer Möglichkeiten (Akzentuierung, Sprechtempo, Gliederung des Gesprochenen usw.) Da „das eigene laute Lesen [] eine besonders intensive Beschäftigung mit einem Text, mit Sprache, mit der eigenen Stimme12 bewirkt. Nicht zuletzt besitzen Balladen aufgrund ihres Zusammenhangs mit der Musik für die Lernenden einen starken Gegenwartsbezug. Die Schülerinnen und Schüler treffen außerhalb der Schule auf Balladentexte, die sie vielleicht gar nicht hier ansiedeln würden. Dies schafft gleichzeitig ein großes Interesse, da sich aktuelle Pop-, Rock- und Rap-Songs an der Lebenswelt der Lernenden orientieren. Die im vorliegenden Unterricht zu behandelnde Ballade Der Zauberlehrling von J.W. Goethe steht ebenfalls eng mit der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler in Verbindung. Sie befinden sich in einem Stadium zwischen Kindsein und Erwachsenwerden. Somit testen sie genauso wie der Protagonist ihre Grenzen aus und müssen von Zeit zu Zeit einsehen, dass man sich oft überschätzt. Da die Lernenden sich mit dem Zauberlehrling identifizieren können, fällt es ihnen leichter über ihre eigenen „Fehler, das Überschätzen der eigenen Fähigkeiten zu reflektieren, ohne in die IchFunktion gehen zu müssen. Somit ist die Lehre, die mit der Ballade vermittelt wird, sowohl von gegenwärtiger als auch von zukünftiger Bedeutung. „Kein erhobener Finger belehrt, keine Sentenz weist über das Geschehen hinaus auf Gleichnishaftes. Die Sätze des Lehrlings spiegeln seinen Forscherdrang, seine Zuversicht, seine Freude an ersten Erfolgen, seinen Triumph, aber dann seinen Zweifel, seine Panik und schließlich die Erlösung durch den Meister.13 Somit lässt uns „Goethes Ballade [.] durch die Äußerungen des Helden an dessen Gefühlen teilnehmen und versetzt so in die Perspektive des Helden.14 Die Schülerinnen und Schüler werden dadurch sprachlich in eine für sie nachvollziehbare Situation gebracht, was bewirkt, dass der Text als ein einfaches Instrumentarium zur Beschreibung von Sprechgestaltungen erarbeitet werden kann. Demzufolge eignet er sich sehr gut dazu, die Formen des hörenden Lesens zu üben. Dabei geht es nicht nur um Realisierung lautlicher Einheiten und Bezüge, sondern in erster Linie um die Subjektivität im Text.15 Da die sprachliche Besonderheit erst durch lautes Sprechen sichtbar wird, sollte das Ziel des Umgangs mit Goethes Ballade darin liegen, seine lyrische Sprache auszuprobieren und sie neu zu 11 12 13 14 In Anlehnung auf Baumann, J., Menzel, W.: Vorlesen-Vortragen. Baurmann, J., Menzel, W.: Vorlesen-Vortragen, S.6. Berger, N.: Stundenblätter Balladen, S. 29. Matthias, D.: Metamorphosen des Zauberlehrlings. Ein Vergleich von Ballade, Trickfilm und Vertonung, in: Praxis Deutsch 156, Seelze-Velber 1999, S. 32. 15 Vgl. Lösener, H., Siebauer, U.: Sprechgestaltungen in Gedichten entdecken. Eine Unterrichtsanregung zum hörenden Lesen von Gedichten, in: Praxis Deutsch 213, Seelze-Velber, 2009, S. 23. 8 gestalten. „Wenn wir einen Text vorlesen, konstruieren wir eine „Gesamtklanggestalt, die den geschriebenen Text als gesprochenen Äußerungsakt erfahrbar macht.16 Durch das sinnbetonte Vorlesen der Ballade erhalten die Schülerinnnen und Schüler demzufolge die Möglichkeit, in ihrer Sprachgestaltung den Stimmungswechsel des Zauberlehrlings zu erkennen, für sich zu deuten und durch betontes Lesen zu demonstrieren. Da das jeweilige Verständnis des Textes von der Art und Weise abhängt, wie man ihn spricht bzw. innerlich hört, kann den Lernenden bewusst werden, dass es für die gleichen Verse unterschiedliche Möglichkeiten der Realisierung gibt, die jeweils die Wirkung des Textes verändern. „Durch die Arbeit mit Sprachgestaltungen wird die Fähigkeit gefördert, Hör- und Sprechvorstellungen am Text zu entwickeln und zu begründen.17 Das Verlegen des Unterrichts ins Freie verfolgt die Absicht, bei den Lernenden ein besonderes Gefühl zu schaffen und somit die Bedeutung des Vortrags „wie auf einer Bühne hervorzuheben. Außerdem schafft das Verlassen der Enge des Klassenraumes bei 31 Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, sich freier zu entfalten. 5. Methodische Überlegungen Zu Beginn der Stunde werde ich der Lerngruppe kurz erzählen, dass ich gestern bei einem Vorlesewettbewerb war und einen mir bekannten literarischen Text gehört habe. Daraufhin spiele ich der Gruppe eine von mir selbst aufgenommene Hörversion der Ballade Der Zauberlehrling von J.W. Goethe bis zu einer bestimmten Stelle vor und lasse die Lernenden diese zu Ende erzählen. Somit sollen die Lernenden sich den Inhalt der Ballade ins Gedächtnis rufen, wobei der Schwerpunkt auf dem äußeren Handlungsablauf liegt. Dabei habe ich mich zunächst absichtlich für einen eintönigen und emotionslosen Vortrag entschieden, um den Schülerinnen und Schülern ein schlechtes Beispiel vorzuführen. An dieser Stelle erhalten sie die Gelegenheit, sich zu dem Gehörten spontan zu äußern. Nach dieser kurzen Wiederholungsphase werde ich ihnen berichten, dass beim gleichen Wettbewerb ein anderer Teilnehmer die gleiche Ballade vorgetragen hat und werde diesmal eine emotionsgeladene Interpretation vorspielen, die dank der Modulation der Stimme des Sprechers (Udo Wachtveitl) jedes Gefühl des Zauberlehrlings hautnah miterleben lässt. Daraufhin wird den Schülerinnen und Schülern ein Zeitraum für ihre spontanen Bemerkungen gegeben. Ich gehe davon aus, dass die Gruppe selbstständig auf die Idee kommt, dass die beiden Interpretationen sich voneinander unterscheiden und werden die Merkmale benennen können, die einen guten bzw. schlechten Vortrag ausmachen. Angesichts der äußeren Umstände habe ich für die zu erwartenden Antworten bereits einige Kärtchen mit den entsprechenden Kriterien vorbereitet, die von mir an die Rampe angebracht werden. Zusätzlich werde ich noch einige Blankokärtchen parat haben, um eventuelle weitere Schülervorschläge aufschreiben zu können. Damit sollen die von den Lernenden erarbeiteten Kriterien für den heutigen Vortrag für alle sichtbar sein. 16 Ebd.: S.23. 17 Ebd.: S.25. 9 Ich habe mich für diese Form des Einstiegs aus mehreren Gründen entschieden. Zum Einen hat er das Ziel, den Inhalt der bereits im Bezug auf die äußere Handlung besprochene Ballade zu wiederholen und somit an das zu behandelnde Thema heranzuführen. Da die Lernenden sich hauptsächlich mit der inneren Handlung des Werkes beschäftigen werden, soll der Vergleich sie zum Anderen aufmerksam darauf machen, dass man einen Text stimmungsvoll vortragen kann. Des Weiteren soll dieser den Schülerinnen und Schülern den Zugang zu den Gefühlen der Hauptfigur erleichtern und dadurch sie auf die darauf folgende Phase vorbereiten. An dieser Stelle schaffe ich den Übergang in die Erarbeitungsphase, indem ich die Lernenden frage, aus welchem Grund der heutige Unterricht nicht in einem Klassenraum, sondern im Freien stattfindet. Ich erhoffe mir, dass die Lernenden durch die äußeren Umstände und nach dem Einstieg auf den Gedanken kommen, dass sie selbst eine Ballade vortragen sollen. Erforderlichenfalls muss ich das Gespräch in diese Richtung lenken, indem ich sie beispielsweise auf die Rampe hinweise. An dieser Stelle befestige ich ein Plakat mit dem Thema der Stunde Zauberlehrling auf die Rampe! ebenfalls an die Rampe. In der Erarbeitungsphase arbeiten die Schülerinnen und Schüler in Dreiergruppen, wobei ich die Zusammensetzung je nach Leistungsniveau und vor allem Sozialverhalten differenziert festlege (vgl. Kpt.2). Darüber hinaus soll damit ineffiziente Arbeit vermieden werden, zu der die Lernenden neigen, wenn sie in größeren Gruppen arbeiten. In diesem Unterrichtsabschnitt sollen sie, nachdem sie sich mit den Aufgaben vertraut gemacht haben, die Ballade Der Zauberlehrling für einen Vortag auf der Rampe vorbereiten. Im Einzelnen sollen sie für die von mir bereits vorbereiteten Textabschnitte ein Adjektiv finden, das den Gefühlszustand des Lehrlings treffend beschreibt. „Um Formen des hörenden Lesens zu üben, muss zunächst ein einfaches Instrumentarium zur Beschreibung von Sprechgestaltungen erarbeitet werden.18 Sie tauschen sich aus, diskutieren die verschiedenen „Gefühlsadjektive sowie ihre Bedeutung und Ausdrucksstärke. Ich erwarte von den Lernenden, dass sie auf ihren erlernten Wortschatz zurückgreifen und aus verschiedenen möglichen Adjektiven das passendste heraussuchen (verzweifelt, hilfesuchend und nicht: Es geht ihm schlecht). Da diese Aufgabe anspruchsvoll ist und einigen Schülerinnen und Schüler Schwierigkeiten bereiten könnte, werde ich die Blätter mit durcheinander gewürfelten „Gefühlsadjektiven dabei haben. Diese setze ich allerdings je nach Bedarf ein. An dieser Stelle verzichte ich absichtlich auf den Vergleich der Ergebnisse, da ich damit ihre Individualität zu Wort kommen lassen und einheitliche Lösungswege vermeiden will. Als nächster Schritt erhalten die Lernenden den Auftrag, anhand der Ergebnisse ihrer Arbeit die Spannungskurve der Ballade Der Zauberlehrling zu zeichnen, was sie an die Variabilität des Tempos und der Lautstärke der Stimme beim Vorlesens (vgl. Kpt. 2) erinnern soll. In dem sich daran anschließenden Schritt findet die 18 Ebd.: S. 23. 10 Transferleistung der zuvor erbrachten Leistungen statt. Die Lernenden üben in Dreiergruppen den Vortrag der Ballade unter Einbeziehung der erarbeiteten Gefühle und Orientierung an der Spannungskurve, wodurch sie sich ein eigenes Vorstellungsbild schaffen können. Dies und das Hineinfühlen in eine literarische Figur (hier: in die Gefühlswelt des Zauberlehrlings) gilt als Voraussetzung für jeden literarischen Verstehensprozess und fördert zusätzlich die Empathiefähigkeit der Lernenden, die auf diesem Wege dafür sensibilisiert werden sollen, wie sie sich fühlen, wenn ihnen etwas „über den Kopf wächst. Nach einer vorgegebenen Zeit in der Präsentationsphase stellen die Schülerinnen und Schüler ihre Umsetzungsideen dar, indem jeweils ein Team auf die Rampe steigt und seine Interpretation des Textes vorliest. Um jegliche Ablenkung vom Vortrag zu vermeiden, habe ich mich gegen den Einsatz möglicher Requisiten (z.B. Zauberstab) entschieden. Aus zeitlichen Gründen können nicht alle Lernenden ihre Ergebnisse präsentieren. Im Anschluss an jeden Schülertext erfolgt eine Reflexionsphase, während der ein Feedback im Bezug auf die zu Beginn der Stunde erarbeiteten Kriterien geäußert wird. Weil die Rückmeldung zu einer Präsentation in der 7. Klasse häufig noch sehr ungleichgewichtig ausfällt, werde ich die Lernenden darauf hinweisen, dass sie sich an drei Leitfragen orientieren sollen: „Was war gut?, „Was war nicht so gut? und „Verbesserungsvorschläge? Ich bin mir dessen bewusst, dass es nicht für alle Lernenden gleichermaßen motivierend ist, sich auf „einer Bühne zu präsentieren, weshalb ich auch niemanden zwingen werde, dort aufzutreten. Wer dies nicht möchte, darf seine Präsentation auf dem Boden vornehmen. Sollte noch genügend Zeit vorhanden sein, werden die Lernenden abschließend über die verschiedenen Vortragsmöglichkeiten in einem Unterrichtsgespräch reflektieren. Ich erhoffe mir dabei, dass sie auf den Gedanken kommen, dass die gleiche Zeile unterschiedlich gesprochen und je nach Verstehen und eigener Gefühlslage vorgetragen werden kann. Gegebenenfalls muss ich darauf hinwirken, dass sie das gewünschte Ergebnis erzielen. Falls die Zeit nicht ausreicht, werde ich diese Phase auf die nächste Stunde verschieben. Als Hausaufgabe bzw. didaktische Reserve sollen die Lernenden ein Gespräch zwischen dem Zauberlehrling und Meister schreiben, in dem sie die innere Gefühlslage des Erstgenannten berücksichtigen. 6. Angestrebter Kompetenzzuwachs Die Schülerinnen und Schüler vertiefen ihre Deutungskompetenz, indem sie die Empfindungen vom Zauberlehrling (innere Handlung) wahrnehmen und beschreiben. Sie erweitern ihre Lesekompetenz, indem sie ihre individuellen Vorstellungen und Empfindungen, die beim Lesen/Rezipieren entstehen zum Ausdruck bringen und den Text involviert, flüssig und sinnverstehend vorlesen. Sie schlussfolgern, dass es für die gleichen Verse oft verschiedene Möglichkeiten der Realisierung gibt. 11 7. Verlaufsplan Zeit Phase Inhalt Einstieg: ca. 15 Die Lehrperson spielt eine eintönige Hörversion der Ballade Der Min. Zauberlehrling von J.W. Goethe bis zu einer bestimmten Stelle vor. Die Schülerinnen und Schüler erzählen die Ballade weiter. Mögliche Schüleräußerungen: Die Situation gerät ihm leider außer Kontrolle, da er den Zauberspruch vergisst und plötzlich das ganze Zimmer unter Wasser steht. Erst der Meister bereitet dem Spuk sein Ende. Die Lehrperson fragt nach den Eindrücken. Die Schülerinnen und Schüler äußern sich spontan zu dem Gehörten. Mögliche Schüleräußerungen: Der Vortrag war eintönig und langweilig. Die Lehrkraft spielt eine emotionsgeladene Hörversion der Ballade Der Zauberlehrling vor. Die Lernenden äußern sich spontan. Mögliche Schüleräußerungen: Diese Version war anders, etwas lebendiger. Er hat die Ballade mit Gefühlen vorgelesen. Sozialform Methode auditiver Impuls/ Plenum auditiver Impuls/ Plenum Die Zettel mit den von den Lernenden genannten Kriterien werden von der Lehrkraft an der Rampe befestigt. ca. 2 Hinführungsphase: Min. Die Lehrperson fragt nach den Gründen, warum der Unterricht im UnterrichtsFreien stattfindet und klebt das Thema der Stunde an die Rampe. gespräch/ Plenum Erarbeitungsphase: ca. 15 Die Lehrperson teilt die Arbeitsblätter aus. Die Lernenden machen Min. sich mit den Aufgaben vertraut. Sie ordnen zu jedem Textabschnitt Ballade deuten und der Ballade jeweils ein entsprechendes Gefühlsadjektiv zu, zeichnen den Vortrag eine Spannungskurve ein. Sie verteilen sich auf dem Platz und üben vorbereiten/ den Text sinngestaltend vorzutragen. Gruppenarbeit Ergebnissicherung: ca. 10 Die Lernenden steigen auf die Rampe und tragen die Ergebnisse ihrer Min. Arbeit vor. Die Vorträge werden anschließend unter Berücksichtigung Vortrag der Ballade der vorher erarbeiteten Kriterien von den Schülerinnen und Schülern /Reflexion reflektiert. Plenum Medien Stühle CD CD-Player CD CD- Player Zettel, Klebeband, Stift, Rampe, Plakat, Klebeband Rampe Arbeitsblätter vgl. M1/ evtl. Arbeitsblätter mit der Hilfestellung vgl. M2 Arbeitsblätter Rampe Reflexionsphase: ca. 3 Die Lehrperson lässt die Lernenden die Stunde zusammenfassen. Die Min. Schülerinnen und Schüler schlussfolgern, dass die Vortragsweise Unterrichtsgespräch/ eines Textes individuell ist und von bestimmten Faktoren abhängt. Plenum Mögliche Schüleräußerungen: Die Art und Weise, wie wir einen Text (eine Ballade) vortragen hängt davon ab: wie wir uns fühlen, für wen wir den Text vortragen, wie wir ihn verstehen, ob wir das Vortragen geübt haben etc. Hausaufgabe bzw. didaktische Reserve: Zeit (-): Falls die Zeit nicht ausreicht, wird die Reflexionsphase auf die nächste Stunde verschoben. Zeit (): Als didaktische Reserve bzw. Hausaufgabe schreiben die Lernenden ein Gespräch zwischen dem Zauberlehrling und Meister. produktives Schreiben/ Einzelarbeit Deutschheft 12 8. Literaturverzeichnis Baurmann,J., Menzel, W.: Vorlesen-Vortragen. Basisartikel, in: Praxis Deutsch 199, Seelze-Velber 2006, S.6-13. Berger, N.: Stundenblätter Balladen, Unterrichtsmodelle für die Klassen 5-11, Stuttgart 2006. Busse, A. u.a. (Hrsg.): Wortstark 7. Hinweise und Materialien für Lehrerinnen und Lehrer, Hannover 2001. Busse, A. u.a. (Hrsg.): Wortstark 7. Sprach- Lesebuch Deutsch. Differenzierende Ausgabe, Braunschweig 2010. Claussen, C.: Tipps fürs Vorlesen, in: Praxis Deutsch 199, Seelze-Velber 2006, S.14. Hessisches Kultusministerium: Lehrplan Deutsch. Bildungsgang Realschule, Jahrgangsstufen 5 bis 10, Wiesbaden 2002. Hessisches Kultusministerium: Bildungsstandards und Inhaltsfelder. Das neue Kerncurriculum für Hessen. Sekundarstufe - Realschule. Entwurf Deutsch, Zugriff: 03.04.2011. Langbein, E.; Lange,R: Rund um Balladen, Berlin 2009. Lösener, H., Siebauer, U.: Sprechgestaltungen in Gedichten entdecken. Eine Unterrichtsanregung zum hörenden Lesen von Gedichten, in: Praxis Deutsch 213, Seelze-Velber, 2009, S. 23-25. Matthias, D.: Metamorphosen des Zauberlehrlings. Ein Vergleich von Ballade, Trickfilm und Vertonung, in: Praxis Deutsch 156, Seelze-Velber 1999, S.32-35. Meyers Lexikonredaktion: Meyers Taschenlexikon, Bd. 2, 7. Auflage, Mannheim 2001. Schilcher, A.: „Der Zauberlehrling- fünfmal gehört, in: Praxis Deutsch 185, 2004, S. 27-34. Wilkening, N.: Balladen und Moritaten, Texte lesen- verstehen- erfahren, Müllheim an der Ruhr 2009. 13 9. Anhang M1 Zauberlehrling auf die Rampe! Aufgaben: 1. Lest die Ballade durch und überlegt gemeinsam, was der Zauberlehrling empfindet. Schreibt zu jedem Textabschnitt ein passendes „Gefühlsadjektiv (Beispiel: wütend). 2. Stellt die Veränderungen der Gefühle des Zauberlehrlings von Strophe zu Strophe in einem Spannungsbogen dar. etwas lauter schneller!!! etwas leiser langsamer!!! 3. Ab jetzt seid ihr die Zauberlehrlinge! Bestimmt, wer welchen Abschnitt vorliest. Bereitet gemeinsam den Vortrag der Ballade vor. Achtet dabei auf die Gefühle und Spannung!!! Ihr habt etwa 15 Minuten Zeit! 14 Der Zauberlehrling Wie fühlt sich der Zauberlehrling? Hat der alte Hexenmeister Sich doch einmal wegbegeben! Und nun sollen seine Geister Auch nach meinem Willen leben. Seine Wort und Werke Merkt ich und den Brauch, Und mit Geistesstärke Tu ich Wunder auch. Walle! walle Manche Strecke, Dass, zum Zwecke, Wasser fließe Und mit reichem, vollem Schwalle Zu dem Bade sich ergieße. Und nun komm, du alter Besen, Nimm die schlechten Lumpenhüllen! Bist schon lange Knecht gewesen: Nun erfülle meinen Willen! Auf zwei Beinen stehe, Oben sei ein Kopf, Eile nun und gehe Mit dem Wassertopf! Walle! walle Manche Strecke, Dass, zum Zwecke, Wasser fließe Und mit reichem, vollem Schwalle Zu dem Bade sich ergieße. Seht, er läuft zum Ufer nieder! Wahrlich! ist schon an dem Flusse, Und mit Blitzesschnelle wieder Ist er hier mit raschem Gusse. Schon zum zweiten Male! Wie das Becken schwillt! Wie sich jede Schale Voll mit Wasser füllt! Stehe! stehe! Denn wir haben Deiner Gaben Voll gemessen! Ach, ich merk es! Wehe! wehe! Hab ich doch das Wort vergessen! Ach, das Wort, worauf am Ende Er das wird, was er gewesen! Ach, er läuft und bringt behände! Wärst du doch der alte Besen! Immer neue Güsse Bringt er schnell herein, Ach, und hundert Flüsse Stürzen auf mich ein! 15 Nein, nicht länger Kann ichs lassen: Will ihn fassen! Das ist Tücke! Ach, nun wird mir immer bänger! Welche Miene! welche Blicke! O, du Ausgeburt der Hölle! Soll das ganze Haus ersaufen? Seh ich über jede Schwelle Doch schon Wasserströme laufen. Ein verruchter Besen, Der nicht hören will! Stock, der du gewesen, Steh doch wieder still! Willst am Ende Gar nicht lassen? Will dich fassen, Will dich halten Und das alte Holz behände Mit dem scharfen Beile spalten! Seht, da kommt er schleppend wieder! Wie ich mich nur auf dich werfe, Gleich, Kobold, liegst du nieder; Krachend trifft die glatte Schärfe. Wahrlich! brav getroffen! Seht, er ist entzwei! Und nun kann ich hoffen, Und ich atme frei! Wehe! wehe! Beide Teile Stehn in Eile Schon als Knechte Völlig fertig in die Höhe! Helft mir, ach! ihr hohen Mächte! Und sie laufen! Nass und nässer Wirds im Saal und auf den Stufen: Welch entsetzliches Gewässer! Herr und Meister, hör mich rufen! Ach, da kommt der Meister! Herr, die Not ist groß! Die ich rief, die Geister, Werd ich nun nicht los. In die Ecke, Besen! Besen! Seids gewesen! Denn als Geister Ruft euch nur, zu seinem Zwecke, Erst hervor der alte Meister. 16 M2 Wie fühlt sich der Zauberlehrling? Die folgenden Adjektive beschreiben die Gefühle des Zauberlehrlings in den 8 Abschnitten. Jedoch sind sie nicht in der richtigen Reihenfolge sortiert. erleichtert, hoffnungsvoll erschrocken, ängstlich, verzweifelt, hilfesuchend kleinlaut, evtl. erleichtert unternehmenslustig verzweifelt, mutlos, hilferufend übermütig, überheblich, befehlend stolz, freudig wütend, sauer, zornig Wie fühlt sich der Zauberlehrling? Die folgenden Adjektive beschreiben die Gefühle des Zauberlehrlings in den 8 Abschnitten. Jedoch sind sie nicht in der richtigen Reihenfolge sortiert. erleichtert, hoffnungsvoll erschrocken, ängstlich, verzweifelt, hilfesuchend kleinlaut, evtl. erleichtert unternehmenslustig verzweifelt, mutlos, hilferufend übermütig, überheblich, befehlend stolz, freudig wütend, sauer, zornig 17 18