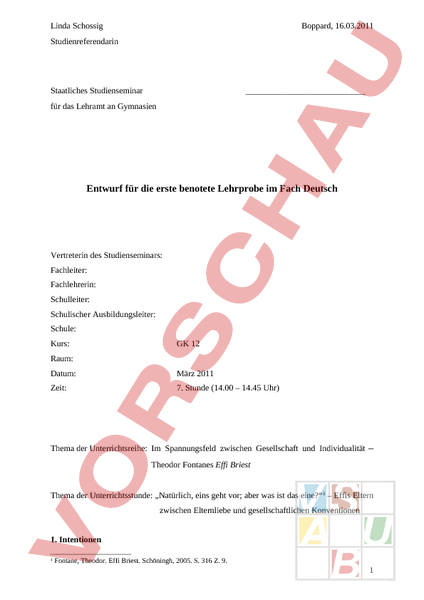Arbeitsblatt: Effi Briest
Material-Details
Effis Eltern im Spannungsfeld von Gesellschaft und Individualität
Deutsch
Textverständnis
12. Schuljahr
17 Seiten
Statistik
80585
1183
8
29.04.2011
Autor/in
Linda Schossig
Land: Deutschland
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Linda Schossig Boppard, 16.03.2011 Studienreferendarin Staatliches Studienseminar für das Lehramt an Gymnasien Entwurf für die erste benotete Lehrprobe im Fach Deutsch Vertreterin des Studienseminars: Fachleiter: Fachlehrerin: Schulleiter: Schulischer Ausbildungsleiter: Schule: Kurs: GK 12 Raum: Datum: März 2011 Zeit: 7. Stunde (14.00 – 14.45 Uhr) Thema der Unterrichtsreihe: Im Spannungsfeld zwischen Gesellschaft und Individualität Theodor Fontanes Effi Briest Thema der Unterrichtsstunde: „Natürlich, eins geht vor; aber was ist das eine?1 – Effis Eltern zwischen Elternliebe und gesellschaftlichen Konventionen 1. Intentionen 1 Fontane, Theodor. Effi Briest. Schöningh, 2005. S. 316 Z. 9. 1 1.1 Hauptintention Die Schüler und Schülerinnen2 analysieren die Position von Effis Eltern innerhalb des Spannungsfeldes Gesellschaft vs. Individualität und erkennen, dass Effis Eltern sich entscheiden, nach humanistischen Idealen zu handeln und welche Folgen die Rückkehr auf Effi und die kreisförmige Dramaturgie des Romans hat. 1.2. Teilintentionen Die Schüler und Schülerinnen (1) orientieren sich im Reihenkontext und entwickeln eine Erarbeitungsperspektive für die Stunde (Positionierung der Eltern im Spannungsfeld Gesellschaft vs. Individuum). (2) äußern sich spontan zum Textauszug (Einordnung in den Romankontext, Inhalt, Verhalten der Eltern, Wirkung der Szenerie, formale Aspekte) und erstellen erste Deutungsansätze (Position der Eltern: Effis Vater verfolgt eher humanistische Ziele, während Effis Mutter stärker an die Normen der Gesellschaft gebunden ist; Symbolik der Szene: Motive der ersten Kapitel werden wieder aufgenommen kreisförmiger Handlungsverlauf). (3) untersuchen, welche Position die Eltern Effis im Spannungsfeld Individuum vs. Gesellschaft einnehmen und was für sie Priorität hat, indem sie relevante Textpassagen herausarbeiten (Ritterschaftsrat Briest: Bereitschaft sich gegen die Gesellschaft zu stellen; kritische Einstellung gegenüber den bestehenden Normen; Elternliebe hat für ihn Priorität, Glaube an eine mögliche Veränderung der Gesellschaft; Möglichkeit eines zufriedenen Lebens außerhalb der Gesellschaft; Werte: Freiheit, Toleranz, der Mensch mit seinen individuellen Bedürfnissen hat höchste Priorität humanistisches Ideal; Luise Briest: Skepsis gegenüber der Entscheidung; Mutterliebe Angst vor den möglichen Konsequenzen; kein Glaube an eine Veränderung der Gesellschaft; bedacht auf die Außenwirkung ihrer Handlungen; Abhängigkeit von der gesellschaftlichen Akzeptanz; letztlich jedoch Zustimmung zu Effis Rückkehr) und erkennen, dass beide letztlich nach humanistischen Idealen handeln. (4) analysieren die Symbolik der Textpassage und setzen sie in Bezug zur Symbolik des ersten Kapitels (Hell-Dunkel-Metaphorik: wilder Wein; Rondell; Sonnenuhr) und erkennen, dass die Naturmetaphorik in dieser Passage wieder aufgegriffen wird, um die Bedeutung Hohen-Cremmens als Rückzugsort von der Gesellschaft zu betonen und auf den Ausgang des Gesprächs der Eltern und Effis Tod vorauszudeuten. (5) präsentieren die Ergebnisse, ergänzen oder modifizieren diese und setzen sie in Bezug zum aufgestellten Deutungsansatz. (6) beurteilen, inwiefern der Ausruf „Effi komm symbolische Bedeutung hat und erkennen, dass er an beiden Stellen seiner Erwähnung im Roman das dramaturgische 2 Im weiteren Verlauf wird der Einfachheit halber der Begriff „Schüler verwendet. 2 Geschehen voranbringt und in dieser Passage als Lockruf fungiert, dessen Befolgung Effi die Chance auf Erlösung bringt. Hiermit wird der kreisförmige Verlauf der Handlung geschlossen. 2. Lernvoraussetzungen 2.2. Interdependenz der Stunde Die Lehrprobenstunde ist die 17. Stunde der Unterrichtsreihe „Im Spannungsfeld zwischen Gesellschaft und Individualität Theodor Fontanes Effi Briest. Die Reihe behandelt den Roman werkimmanent, wobei an verschiedenen Punkten auf textüberschreitende Materialien zurückgegriffen wurde, um den nötigen historischen und gesellschaftlichen Hintergrund mit in den Blick nehmen zu können. Weitere literarische Werke des Realismus wurden aufgrund des begrenzten Stundenumfangs des Grundkurses nicht thematisiert. Der Roman wurde von den Schülern vorbereitend zu Hause gelesen, sodass der gesamte Roman den Schülern zu Beginn der Reihe bekannt war. Erklärungen, die Gründe für diese Herangehensweise liefern, werden in der didaktischen Analyse aufgezeigt. Der Einstieg in die Unterrichtsreihe erfolgte in Form einer Rezeptionsstunde. Die Schüler entwickelten in Gruppen „Lernlandkarten, auf denen sie Aspekte und Themenfelder notierten, die im Verlauf der Unterrichtsreihe thematisiert werden sollten. Dieses Vorgehen ermöglichte es, die Reihe auf die Interessen der Lernenden auszurichten und sie aktiv in die Reihenplanung einzubinden. In Einzelfällen verknüpften die Schüler bestimmte Themenaspekte bereits mit einer gewählten Methode. Im Gesamtverlauf der Reihe hilft die Lernlandkarte, sich im Reihenkontext zu orientieren und die Vernetzungen der verschiedenen Themenaspekte wahrzunehmen. So wird im Verlauf der Einheit immer wieder auf die Lernlandkarte zurückgegriffen; sie wird sukzessiv ergänzt und erweitert. In der darauf folgenden Doppelstunde ging es zunächst darum, die Personenkonstellation des Romans in Form von Standbildern zu verdeutlichen. Ziel dieses Vorgehens war es, die Beziehungsgeflechte der Figuren im Roman zu erschließen. Im Folgenden wurden die Standbilder mittels der Methode des „Hilfs-Ich gedeutet. Die Schüler stellten erste Deutungsansätze bezüglich des Beziehungsdreiecks „Innstetten – Crampas – Effi auf. Um eine Rückbindung an den Text zu gewährleisten, erarbeiteten die Lernenden die Beziehungen dieser drei Figuren in der Folgestunde in arbeitsteiliger Gruppenarbeit, und diskutierten die Ergebnisse im Plenum. In der Form von zwei Kurzreferaten erfolgte eine erste Annährung an die Person Fontanes und grundlegende Merkmale der Epoche des Realismus wurden thematisiert. Dieses Vorgehen erfolgte auf Schülerwunsch hin schon zu diesem Zeitpunkt es wurde im Vorfeld kritisch hinterfragt, inwiefern eine Thematisierung zu Beginn der Unterrichtsreihe den Blick auf den Roman verfälschen könnte. 3 Die nächste Doppelstundeneinheit beschäftigte sich mit den ersten Kapiteln des Romans. Die Schüler erkannten, dass Effi, die in den ersten Kapiteln als „Tochter der Luft beschrieben wird, kindliche und naive Züge aufweist und die bevorstehende Hochzeit als Abenteuer sieht. Die Erwartungen Effis an die Ehe mit Innstetten wurden thematisiert und im Hinblick auf ihre Erfüllung hin beurteilt. Im Zuge dessen untersuchten die Schüler das erste Kapitel des Romans auf seine Metaphorik hin, um festzustellen, inwiefern es schon hier Anzeichen für den weiteren Romanverlauf gibt. Sie erkannten, dass der Konflikt zwischen gesellschaftskonformen Verhalten und der Erfüllung individueller Bedürfnisse sich bereits zu diesem Zeitpunkt ankündigt. Nachdem Effis Naturell und ihr Verhalten vor der Hochzeit analysiert wurde, sollte es nun in den folgenden Stunden darum gehen, Effis zweiten Lebensabschnitt, die Jahre in Kessin, genauer zu untersuchen. Mittelpunkt der Stunde war die Bedeutung des Chinesenspuks für den Roman. Als Ausgangspunkt wurde ein Gespräch zwischen Crampas und Effi gewählt (Kapitel 16), in welchem Crampas Innstetten unterstellt, den Spuk als Erziehungsmittel zu missbrauchen. Nachdem die Schüler diese Behauptung am Roman verifiziert hatten, wurden Innstettens Motive in den Blick gerückt. Da eine Kenntnis des Frauenbildes des 19. Jahrhunderts zu dieser Untersuchung vonnöten ist, wurde auf textüberschreitendes Material zurückgegriffen, um das nötige Hintergrundwissen zu schaffen. Die Lernenden erkannten, dass auch Crampas bestimmte Absichten verfolgt. So gewinnt er Effis Vertrauen und legt damit den Grundstein für die spätere Affäre. Ausgehend von dieser Überlegung wurde die Bedeutung des Chinesenspuks „als Dreh- und Angelpunkt für den gesamten Roman diskutiert. Um die Reihenthematik erneut explizit aufzugreifen, wurde Effis ständiger innerer Konflikt, der Wunsch nach individueller Erfüllung, der mit den gesellschaftlichen Konventionen kollidiert, in den Blick genommen. Hierzu wurde die Unterhaltung mit Roswitha (Kapitel 21) thematisiert, in der Effis Strategie zur Bewältigung der Schuldgefühle deutlich wird. Die Schüler beurteilten, warum Effi die Affäre mit Crampas nicht selbst beenden kann und will. Im Zuge dessen wurden die Defizite der Ehe mit Innstetten thematisiert. Im Anschluss stellten sich die Schüler die Frage, warum der Leser die Schuld nicht bei Effi sieht, obwohl sie gegen gesellschaftliche Normen verstößt. Um dies zu klären, wurde das Erzählverhalten des Romans funktionell eingebunden, indem untersucht wurde, inwieweit Fontanes Erzähltechnik zur Sympathielenkung beiträgt. Als weiterer tragender Aspekt des Romans wurde in der Folgestunde das Duell behandelt. Da die Textpassage, die das Gespräch zwischen Wüllersdorf und Innstetten beinhaltet, Gegenstand der Kursarbeit sein soll, wurde zunächst auf Sekundärmaterial zum Duellwesen im 18. und 19. Jahrhundert zurückgegriffen. Nachdem die Schüler sich mit den rechtlichen Grundlagen des Duells und dem damit verbundenen Ehrbegriff auseinandergesetzt hatten, brachten sie das Erarbeitete mit dem Roman in Verbindung und erkannten, dass Innstetten sich in einem Konflikt befindet: Einerseits liebt er seine Frau und möchte ihr verzeihen, 4 andererseits sieht er sich aufgrund der gesellschaftlichen Konventionen gezwungen, die Tat seiner Frau zu sühnen. Die Schüler verorteten Innstetten innerhalb des beschriebenen Spannungsfelds und erkannten, dass er sich klar auf der Seite der Gesellschaft positioniert, indem er seinen Ehrbegriff über seine emotionalen Bedürfnisse stellt.3 In der Zielstunde soll es nun darum gehen, Effis Eltern ins Blickfeld zu rücken, die bisher nur am Rande thematisiert wurden. Die Schüler sollen erkennen, dass der alte Briest und seine Frau Luise schließlich ihr gesellschaftskonformes Verhalten aufgeben und ihrer Tochter die Rückkehr ins Elternhaus ermöglichen. Im Gegensatz zu Innstetten, der sich einem fragwürdigen Ehrbegriff opfert, sind Effis Eltern schließlich, trotz der zu erwartenden Konsequenzen, gewillt Effi zu verzeihen und sich mit ihrer Entscheidung gegen die Gesellschaft zu stellen. Für Effi bedeutet dies die Möglichkeit, der gesellschaftlichen Isolation zu entkommen, in Hohen-Cremmen zu sich selbst zurückzufinden und im Tod die Erlösung zu finden. Der kreisförmige Verlauf des Romans schließt sich an dieser Stelle. 3. Fachgegenstand Der Gesellschaftsroman Effi Briest von Theodor Fontane erschien im Jahr 1895 und handelt von, der zu Beginn des Romans 17-jährigen, Effi Briest, die auf Anraten ihrer Mutter eine Ehe mit Geert von Innstetten eingeht. Effi beginnt eine Affäre mit Major von Crampas, die Jahre später von Innstetten aufgedeckt wird. Nachdem dieser den ehemaligen Liebhaber im Duell getötet hat, wird Effi von ihrem Mann und ihrer Familie verstoßen. Der zentrale Konflikt des Romans, dem sich alle Figuren stellen müssen, ist das Spannungsfeld zwischen den Erwartungen der Gesellschaft an den Einzelnen und dem Ausleben individueller und emotionaler Bedürfnisse. Der gewählte Textausschnitt thematisiert ein Gespräch zwischen Effis Eltern: dem Ritterschaftsrat Briest und seiner Frau Luise. Anlass für das Gespräch ist ein Brief von Effis Arzt Dr. Rummschüttel, der darum bittet, Effi die Rückkehr ins Elternhaus zu ermöglichen, da dies seiner Ansicht nach die einzige Chance auf Genesung für Effi ist. Die gewählte Passage beginnt mit einer Beschreibung der Szenerie. Die Darstellung Hohen-Cremmens wirkt friedlich und harmonisch. Um diese Wirkung zu erreichen, bedient sich Fontane in diesem einführenden Absatz erneut der Naturmetaphorik, die er bereits im ersten Kapitel eingeführt hat. So findet sich der Gegensatz von Sonne und Schatten, der bereits zu Beginn des Romans den drohenden Konflikt andeutet, auch in dieser Szene wieder („beide saßen auf dem schattigen Steinfließengange, „über dem Wasser standen ein paar Libellen im hellen Sonnenschein4). Die Kombination aus Sonne und Schatten ist Teil der Hell-Dunkel Metaphorik und verdeutlicht auch in dieser Szene den Gegensatz von Glück und Unglück. Es ist bezeichnend, dass in dieser Szene der Teich von der Sonne beleuchtet wird, steht er, als Teil der Natur, doch dafür, was Effi die ersehnte Erlösung aus der gesellschaftlichen Isolation 3 Der Deutungsansatz, dass Innstetten die Werte und Normen der Gesellschaft so sehr internalisiert hat, dass ein Handeln nach individuellen Grundsätzen für ihn unmöglich wird, wurde bisher bewusst ausgespart, soll aber in der Kursarbeit thematisiert werden, indem die Schüler Bezug auf ein Zitat Freuds nehmen. 4 Fontane, Theodor: Effi Briest. Schöningh, 2005. S. 315 Z. 20ff 5 bringen kann. Die darüber kreisenden Libellen weisen darüber hinaus auf die Tochter des Hauses hin, die von Luise Briest selbst als „Tochter der Luft5 charakterisiert wird. Auch das „Rondell mit der Sonnenuhr6 wird erwähnt. Wie im ersten Kapitel bereits angedeutet, kommt der Sonnenuhr eine zweifache Bedeutung zu. Zum einen zeichnet eine Sonnenuhr nur die heiteren Stunden auf, was darauf hindeutet, dass sie für die glücklichen Stunden, die Effi in ihrem Elternhaus verlebt hat, steht. Zum anderen bergen die Erwähnungen der Sonnenuhr und des Rondells eine Vorausdeutung in sich. Die Uhr verweist auf die verstreichende Zeit und die damit verbundene Entwicklung der Hauptfigur. „Die Uhr als mahnendes Symbol des Zeitlichen gewinnt eine erhöhte Aussagekraft durch die Form einer Sonnenuhr, die aufgrund ihrer Konstruktion lediglich die Sonnenstunden anzeigt. 7 Ein weiterer Beleg für diese Aussage lässt sich in der Tatsache finden, dass die Sonnenuhr nach Effis Tod durch eine weiße Marmorplatte in der Mitte des Rondells ausgetauscht wird. Das Rondell selbst kann als Analogie zu Effis Lebensweg betrachtet werden, denn auch dieser verläuft kreisförmig, da die Protagonistin kurz vor ihrem Tod wieder in ihr Elternhaus zurückkehrt. Eine weitere Metapher, die in dieser Passage Erwähnung findet, ist der „wilde Wein8, der sich um die Fenster rankt. Schon das Adjektiv „wild weist darauf hin, dass es sich bei dieser Pflanze um etwas Natürliches handelt, das nur schwer kontrollierbar ist. Das Wachstum einer solchen Pflanze kann auf die Möglichkeit eines Lebens frei von gesellschaftlichen Konventionen hindeuten. Ein Leben außerhalb gesellschaftlicher Zwänge wird hiermit in Hohen-Cremmen angedeutet. Als Gutsbesitzer und Teil des alten Adels eröffnen sich Briest und seiner Familie Freiheitsspielräume. Es ist auffällig, dass der wilde Wein an zwei Stellen im Roman mit dem Ruf „Effi, komm verknüpft wird. Die Bedeutung dieses Ausrufs wird zu einem späteren Zeitpunkt ausführlich diskutiert werden. Insgesamt lässt sich feststellen, dass „[d]ie Chiffren [] einer Hervorhebung des beruhigenden und heilsamen Einflusses, den die Atmosphäre Hohen-Cremmens auf Effi ausübt [dienen].9 Von Beginn des Romans an, wird in den Gesprächen des Ehepaars Briest der Gegensatz zwischen der gesellschaftlich orientierten Lebensweise Luise Briests und der Ausrichtung auf ein ungebundenes, unmittelbares Dasein, die Ritterschaftsrat Briest verkörpert, deutlich. Auch in diesem Textausschnitt, in dem die Eltern darüber diskutieren, ob Effi die Rückkehr ins Elternhaus ermöglicht werden sollte, ist diese Thematik gegenwärtig. So ist Ritterschaftsrat Briest sofort bereit, dem Anliegen des Arztes nachzukommen: „[S]oll ich bis an mein Lebensende den Großinquisitor spielen? Ich kann dir sagen, ich hab es seit lange satt.10 In dem Ausspruch Briests wird deutlich, dass er zwar ursprünglich seiner Frau zustimmte und die Verbannung Effis befürwortete, dennoch hat sich seine Meinung verändert. Die Aussage 5 ebd. S. 9 Z. 10 ebd. S. 315 Z. 22 7 Hamann, Elsbeth. Theodor Fontanes „Effi Briest aus erzähltheoretischer Sicht. Bouvier 1984. S. 116. 8 Fontane, Theodor: Effi Briest. Schöningh, 2005. S. 315 Z. 23. 9 Hamann, Elsbeth. Theodor Fontanes „Effi Briest aus erzähltheoretischer Sicht. Bouvier 1984. S.121. 10 Fontane, Theodor. Effi Briest. Schöningh, 2005. S. 315 Z. 34f. 6 6 „Aber das ist nun schon wieder eine halbe Ewigkeit her11 macht deutlich, dass er, im Gegensatz zu Innstetten, für den es keine Verjährung gibt, bereit ist, Vergangenes ruhen zu lassen und zu verzeihen. Briest macht im weiteren Gespräch deutlich, wie wenig er von der „Gesellschaft und ihren Gesetzen hält. Für ihn können eine Gesellschaft und ein damit verbundener Katechismus, die das Wichtigste, „die Liebe der Eltern zu ihren Kindern 12, unter Sanktion stellen, nicht maßgebend sein. „Briest, der Vater, befreit sich von diesem Zwang zur Rücksichtnahme auf das abstrakte ‚Ganze, von dem der eigenen Entscheidung entzogenen ‚Ich muss.13 Für Briest haben somit die persönlichen Beziehungen und seine individuellen Wünsche höhere Priorität als die gesellschaftlichen Prinzipien. Hinsichtlich der Konsequenzen sind für Briest zwei Alternativen denkbar, die im Gespräch mit seiner Frau angedeutet werden. „Und dann, glaube mir, Luise, die ‚Gesellschaft, wenn sie nur will, kann auch ein Auge zudrücken. Und kommen die Rathenower, so ist es gut, und kommen sie nicht, so ist es auch gut.14 Der erste Teil der Aussage weist darauf hin, dass Briest an eine Möglichkeit zur Veränderung der Gesellschaft glaubt. Jedoch rechnet er auch damit, dass die Gesellschaft sein Handeln nicht akzeptieren wird. Sein Ausspruch macht darüber hinaus deutlich, dass ein Leben außerhalb der Gesellschaft für ihn vorstellbar ist. Ausschlaggebend hierfür ist sicherlich der Fakt, dass er als Gutsbesitzer weitgehend unabhängig von der Gesellschaft ist. Des Weiteren zeichnet sich Lebensqualität für Briest nicht durch gesellschaftliche Beziehungen aus. Der Ausspruch „Ich kanns aushalten. Der Raps steht gut, und im Herbst kann ich einen Hasen hetzen. Und der Rotwein schmeckt mir noch. Und wenn ich das Kind erst wieder im Hause hab, schmeckt er mir noch besser15 zeigt deutlich, was für Effis Vater an erster Stelle steht: Er ist auch ohne die Anerkennung der Gesellschaft zufrieden und zieht ein abgeschottetes Leben in der Natur zusammen mit seiner Familie, einem Leben im gesellschaftlichen Glanz vor. Insgesamt lässt sich sagen, dass Briest in dieser Textstelle als Verfechter des Menschlichen dargestellt wird. „Die Zuneigung des alten Briest zu seinem Kinde kennt keine Einschränkung und kaum Vorbehalte.16 Briests Handeln in der gewählten Passage liegt ein humanistisches Ideal zu Grunde. So handelt er menschlich und hat die Freiheit, sich, zu Gunsten seiner individuellen Bedürfnisse und dem Wohl seiner Tochter, über die Gesellschaft hinwegzusetzen. Richtet man den Fokus allerdings auf den ganzen Roman, muss festgestellt werden, dass auch Briest Fehler gemacht hat. Zwar scheint er in seinem Naturell und seinen Ansichten Effi am ähnlichsten zu sein, dennoch kann ihm vorgeworfen werden, dass er Effi mit seinem nachsichtigen Erziehungsverhalten nicht auf ein Leben außerhalb von Hohen-Cremmen vorbereitet hat. In wichtigen Fragen, wie beispielsweise der Entscheidung zur Hochzeit, beugt er sich den Wünschen seiner Frau. 11 ebd. S. 315 Z. 33. ebd. S. 316 Z. 10. 13 Dieckhoff, Klaus. Romanfiguren Theodor Fontanes in andragogischer Sicht. Peter Lang Verlag, 1994. S. 179. Die Rechtschreibung dieses Zitats wurde der neuen Rechtschreibung angepasst. 14 Fontane, Theodor. Effi Briest. Schöningh, 2005. S. 316 Z. 17f. 15 ebd. S. 316 Z. 27ff. 16 Rösel, Manfred. „Das ist ein weites Feld.Wahrheit und Weisheit in einer Fontaneschen Sentenz. P. Lang Verlag, 1997. S. 62. 12 7 Schon zu einem frühen Zeitpunkt beschäftigt ihn der Gedanke, ob Effi wirklich glücklich ist und ob die Ehe ihre Bedürfnisse nach „Vergnügungssucht befriedigen kann17. Statt zu handeln, verbirgt er seine Bedenken hinter dem Ausspruch „das ist ein zu weites Feld.18 Während der Jahre in Kessin und Berlin nimmt der Ritterschaftsrat kaum Einfluss auf das Leben seiner Tochter. So ist es auch seine Frau, die Effis Verbannung in einem Brief an die Tochter formuliert. Erst in der gewählten Passage setzt Briest sich, trotz der Einwände seiner Frau, durch und telegraphiert, um die Tochter heimzuholen. Die Zeit scheint ihm gezeigt zu haben, dass sein ursprüngliches Handeln nach gesellschaftlichen Prinzipien für ihn nicht länger tragbar ist, da die Impulse seiner Persönlichkeit unterdrückt werden. 19 In seinem Telegramm an Effi verwendet er den Ausspruch „Effi, komm. Dieser verdient besondere Aufmerksamkeit. Insgesamt wird der Ruf im Roman an drei Stellen erwähnt. Schon als er das erste Mal erklingt, wird dem aufmerksamen Leser bewusst, dass er mehr ist als nur die Aufforderung der Zwillinge, Effi zum Spiel zurück zu holen. Vielmehr kann er als die symbolische Aufforderung, ihre gewohnte Umgebung nicht zu verlassen und die Ehe mit Innstetten nicht einzugehen, interpretiert werden.20 Deutlich wird dies an der Tatsache, dass der Erzähler den Ausspruch einige Seiten später erneut erwähnt und den Leser wissen lässt, dass Innstetten selbst die Aussage als eine Art Zeichen deutet.21 Während der erste Warnruf, der Effi vor dem Leben und ihren Erfahrungen in Kessin bewahren sollte, von ihr nicht befolgt wird, kommt sie dem zweiten Lockruf, der Aufforderung des Vaters, nach. Auch diesmal bedeutet er für Effi den Beginn eines neuen Lebensabschnitts. Der Aufenthalt in Hohen-Cremmen vermag sie zwar nicht zu heilen, gibt ihr aber die Möglichkeit, die Vergangenheit zu akzeptieren und schließlich im Tod zu sich selbst zurück zu finden. Hier ist das Befolgen der Aufforderung des Vaters im weitesten Sinne der Weg zu Effis „Erlösung. In beiden Fällen hat der Ruf also entscheidende Auswirkungen auf den weiteren Verlauf der Handlung. Die Erwähnung zu Beginn und am Ende des Romans hat eine verbindende Wirkung, die analog zum kreisförmigen Lebensweg Effis gesehen werden muss. So bedeutet er in dem einen Fall den Abschied vom Elternhaus, während er gegen Ende des Romans die Rückkehr dorthin bewirkt. Im Gegensatz zu ihrem Mann ist Luise Briest nicht ohne Weiteres zu dem von Rummschüttel geforderten Schritt bereit. Sie erwähnt zwar ihre Muttergefühle, doch diese haben „im Prozess gesellschaftlicher Vermittlung ihre Ursprünglichkeit und Bedingungslosigkeit eingebüßt.22 So scheint sie sich zunächst gegen ihre persönlichen Gefühle und für die Prinzipien der Gesellschaft zu entscheiden: „Man lebt doch nicht bloß in der Welt, um schwach und zärtlich zu sein und alles mit Nachsicht zu behandeln, was gegen Gesetz und Gebot ist und was die Menschen verurteilen und, vorläufig wenigstens, auch noch 17 Fontane, Theodor. Effi Briest. Schöningh, 2005. S. 45f. ebd. S. 46 Z. 11. 19 vgl. Dieckhoff, Klaus. Romanfiguren Theodor Fontanes in andragogischer Sicht. Lang Verlag, 1994. S. 179. 20 vgl. Hamann, Elsbeth. Theodor Fontanes „Effi Briest aus erzähltheoretischer Sicht. Bouvier 1984. S. 124. 21 Fontane, Theodor. Effi Briest. Schöningh, 2005. S. 23, Z. 19ff. 22 Rösel, Manfred. S. 62. 18 8 – mit Recht verurteilen.23 Ihre Argumentation an dieser Stelle lässt Parallelen zu Innstettens fatalistischen Beweggründen erkennen. Wie auch er, unterstellt sie ihr Handeln herrschenden gesellschaftlichen Konventionen und ist nicht sofort bereit, sich über diese hinweg zu setzen. Dass sie sich auch um ihren Ruf sorgt, wird deutlich, als sie die anderen Menschen erwähnt. Indem sie etwas Verurteilungswürdiges akzeptiert, könnte sie den Respekt der Umwelt verlieren. Ihr Ausspruch „Es ist schwer, sich ohne Gesellschaft zu behelfen 24 zeigt, dass sie in gewissem Maße von der Gesellschaft abhängig zu sein scheint. Sie willigt zwar letztendlich ein, das Telegramm zu schicken, ist sich aber bewusst, welche Folgen dieser Schritt haben wird.25 Sie sieht, im Gegensatz zu ihrem Mann, nicht die Möglichkeit, dass die Gesellschaft sich verändern wird und kann. 4. Darstellung des Lerngegenstands 4.1. Lehrplanbezug Die Lehrprobenstunde und die gesamte Unterrichtsreihe sprechen verschiedene, im Lehrplan geforderte, Kompetenzen an. Die kulturelle Kompetenz der Lernenden wir gefördert, denn die Schüler „begreifen Verstehen als einen Prozess, an dem sie selbst aktiv beteiligt sind. Sie entwickeln die Bereitschaft und vertiefen die Fähigkeit, sich auf hermeneutische Prozesse einzulassen.26 Voraussetzung hierfür ist ein induktives Vorgehen, das den Schülern die „Freiheit der spontanen und individuellen Reaktion auf den Text zugesteht und „die Gelegenheit zu engagierter Diskussion über ihre Textauffassung27 gibt. Genau an diesem Punkt setzt die Lehrprobenstunde an, da ein offenes Rezeptionsgespräch nach der Lektüre die Basis für erste Deutungsansätze bilden wird. Um jedoch auch zu gewährleisten, dass die Textinterpretation „das Erreichen und die Darlegung eines nachvollziehbaren 28 Gesamtverständnisses beinhaltet müssen die Schüler an geeignete Analyseverfahren herangeführt werden. Dies ist in der Lehrprobenstunde, die auf hermeneutische Verfahren zurückgreift, der Fall. Wie vom Lehrplan gefordert, sollen Schüler neben der Analyse von „poetischen und rhetorischen Mitteln auch die „Funktion von Einzelmotiven innerhalb des Textzusammenhangs29 erkennen. In der Lehrprobenstunde wird dieser Forderung nachgekommen, indem die Schüler die Naturmetaphorik und den Lockruf „Effi, komm im Hinblick auf ihre Wirkung und Funktion für den gesamten Roman untersuchen. Durch die Beschäftigung mit dem Roman Effi Briest gewinnen die Schüler „Einblick in verschiedene Wertesysteme und deren historische und gesellschaftliche Zusammenhänge.30 Das preußische Wertesystem zur Kaiserzeit konfrontiert die Schüler mit einem Wertemodell, das sich vom „Wertekanon der heutigen Gesellschaft in vielerlei Hinsicht unterscheidet. Gerade 23 ebd. S. 316 Z. 2ff. Fontane, Theodor. Effi Briest. Schöningh, 2005. S. 316 Z. 16f. 25 vgl. ebd. S. 316 Z. 25. 26 Lehrplan Deutsch: Grund- und Leistungsfach. Jahrgangsstufen 11-13 der gymnasialen Oberstufe. S. 8. 27 ebd. S. 11. 28 ebd. S. 11. 29 ebd. S. 14. 30 ebd. S. 8. 24 9 diese „Konfrontation mit Modellen verschiedener menschlicher Seins- und Handlungsweisen sowie unterschiedlicher sozialer Rollenbilder31 hilft den Schülern, die „Pluralität möglicher Weltbilder und ihre Bedingtheit durch persönliche, gesellschaftliche und historische Gegebenheiten zu erkennen.32 Die Unterrichtsreihe zu Effi Briest, der die Lehrprobenstunde angehört, thematisiert den Konflikt zwischen den Anforderungen der Gesellschaft und den Wünschen und Bedürfnissen des Individuums. Die Beschäftigung mit den verschiedenen Strategien der Romanfiguren, mit diesem Konflikt umzugehen, kann dazu beitragen, den Schülern die „Traditionen des eigenen Kulturraumes und damit eines Teils ihrer eigenen Identität vor Augen zu führen. 4.2. Bedeutung des Themas für die Schüler Betrachtet man das übergeordnete Reihenthema, das Spannungsfeld zwischen Gesellschaft und Individuum, wird deutlich, dass dieses Thema Relevanz für die Lebenswelt der Schüler hat. Die 17- bis 18-jährigen sind nun in einem Alter, in dem sie sich mehr und mehr mit den Werten, Moralvorstellungen und Gesetzen der Gesellschaft auseinandersetzen müssen. Sicherlich sind den meisten von ihnen aus ihrem Alltag Situationen bekannt, in denen die individuellen Bedürfnisse und Wünsche nicht mit den gesellschaftlichen Konventionen vereinbar sind. So sind sie sicher schon mit Aussprüchen wie „das gehört sich nicht, die Ausdruck dieser gesellschaftlichen Moral- und Wertvorstellungen sind, konfrontiert worden. Die unterschiedlichen Strategien, mit denen die Figuren im Roman Effi Briest mit diesem Spannungsfeld umgehen, kann die Schüler dazu ermutigen, ihre eigene Einstellung gegenüber des Konfliktes kritisch zu reflektieren und die Auseinandersetzung mit dem Werk kann ihnen helfen, ihre eigene Position zu finden. Für die Schüler könnte es interessant sein, zu erkennen, was die Handlungsmotive der einzelnen Figuren sind. Die Lehrprobenstunde bietet durch die divergierende Haltung der Eltern bezüglich Effis Heimkehr die Möglichkeit, das schon erwähnte Spannungsfeld genauer zu beleuchten. Gerade da Fontane kaum explizite Wertungen der verschiedenen Lebensweisen vornimmt, können die Schüler dazu angeregt werden, sich eine eigene Meinung zu bilden. Sicherlich werden sich die Schüler zunächst schockiert über die Haltung Luise Briests zeigen, da es heutzutage, und im kulturellen Umfeld, dem die Schüler entstammen, kaum noch vorstellbar wäre, die gesellschaftliche Akzeptanz über die Liebe zu seinem einzigen Kind zu stellen. In diesem Kontext muss bemerkt werden, dass die Moralvorstellungen zur Kaiserzeit nicht die gleichen sind, die heute vorherrschen. Jedoch können gerade diese divergierenden, möglicherweise überholten, gesellschaftlichen Konventionen dazu beitragen, sich der Wertvorstellungen, die die heutige Gesellschaft prägen und in gewissem Maße bestimmen, bewusst zu werden. Ein weiterer Aspekt, der die Schüler interessieren könnte, ist der Wandel der Struktur der Ehe. Immer wieder im Verlauf der Reihe zeigten sich sowohl männliche als auch weibliche Schüler schockiert über die arrangierte Hochzeit. Es ist für die Schüler, in deren Vorstellung 31 32 ebd. S. 10. ebd. S. 10. 10 Liebe der einzige Grund ist, eine Ehe einzugehen, nicht vorstellbar, dass die Eltern einen Partner auswählen. Möglicherweise verurteilen sie sogar das in der Passage gezeigte Verhalten Luise Briests, da die Lernenden sie für die Hochzeit mit einem Partner, der Effis Bedürfnissen nicht gerecht werden kann, verantwortlich machen. Darüber hinaus kann es für die Schüler bedeutend sein, zu erkennen, welche Stellung der Frau im ausgehenden 19. Jahrhundert zukam. Der Aspekt der Gleichberechtigung ist in der heutigen Gesellschaft immer noch ein Thema, das öffentlich diskutiert wird. Aktuelle Diskussionen über eine „Frauenquote und die Existenz von „Gleichstellungsbeauftragten belegen dies. Auch für die Schüler, die bereits in einem Jahr ins Berufsleben eintreten werden, ist dieses Thema relevant. Der Roman kann dazu anregen, über das Frauenbild des 21. Jahrhunderts nachzudenken und es kritisch zu hinterfragen. 4.3. Didaktische Reduktion Wie bereits in 2.2 angesprochen, basiert die Reihenplanung auf der didaktischen Entscheidung, den Roman vorab lesen zu lassen. Die häusliche Lektüre bietet einige Vorteile. So haben die Schüler von Beginn an die Gesamtentwicklung im Blick, was ein aspektorientiertes Arbeiten ermöglicht. Außerdem können einzelne Szenen im Hinblick auf ihre Funktion für die gesamte Handlung des Romans eingeordnet werden. Auf einen konkreten Leseauftrag wurde bewusst verzichtet, um zu gewährleisten, dass sich die Schüler dem Werk unvoreingenommen nähern konnten. Im Zentrum der Reihe steht das Spannungsfeld Gesellschaft und Individualität, dem sich alle Figuren ausgesetzt sehen. So sind die individuellen Wünsche und Bedürfnisse oft nicht mit den gesellschaftlichen Konventionen in Einklang zu bringen, was den Grundkonflikt des Romans ausmacht. Diese Ausrichtung bietet die Möglichkeit alle Figuren des Dramas zu beleuchten und auf ihre Position innerhalb des Spannungsfelds hin zu betrachten. Die Auswahl der Textpassage für die Lehrprobenstunde ergibt sich aus der Konzeption der Unterrichtsreihe. Nachdem der Fokus sich zu Beginn der Unterrichtsreihe vornehmlich auf die Protagonisten Effi, Crampas und Innstetten richtete, soll das Feld nun um Effis Eltern erweitert werden. Im Hinblick darauf bietet sich die gewählte Passage in doppelter Hinsicht an. Zum einen werden die Positionen der Eltern im schon beschriebenen Spannungsfeld in diesem Gespräch deutlich, zum anderen bietet die Textstelle durch die Wiederaufnahme der Symbolik der ersten Kapitel die Möglichkeit, sie in Zusammenhang mit dem gesamten Roman zu bringen und ihre dramaturgische Bedeutung zu erschließen. Ziel der Stunde ist es, zu erarbeiten, dass Effis Eltern letztendlich ihr gesellschaftskonformes Verhalten aufgeben und menschlich handeln. Des Weiteren gilt es zu erkennen, dass diese Entscheidung der Eltern ausschlaggebend für die Dramaturgie des Romans ist, was durch den symbolischen Lockruf „Effi, komm und die Naturmetaphorik angedeutet wird. Ein Aspekt, der in der Lehrprobenstunde ausgeklammert werden muss, ist der, dass das Verhalten des Ritterschaftsrates konträr zum Handeln Innstettens ist. Der Vergleich der 11 beiden Weltanschauungen, der humanistischen und der fatalistischen, kann erst geleistet werden, wenn die Duell-Szene von den Schülern eingehend analysiert wurde. Dies wird erst nach der Kursarbeit, die in der Folgestunde stattfindet, der Fall sein. Im Anschluss kann dann noch einmal auf die Ergebnisse der Lehrprobenstunde zurückgegriffen werden. Die in der Szene enthaltene Naturmetaphorik wird von den Schülern erwähnt werden. Ihr Blick wurde dafür im Verlauf der Reihe bereits geschärft. Darüber hinaus ist zu erwarten, dass die Schüler erkennen, dass die verwendete Symbolik des ersten Kapitels hier wieder aufgenommen wird. Diese Erkenntnis kann genutzt werden, um auf den kreisförmigen Verlauf des Romans einzugehen. Des Weiteren kann eine Entschlüsselung der teilweise vorausdeutenden Symbole dazu beitragen, die Bedeutung und die Konsequenzen der Heimkehr für Effi in den Blick zu nehmen. 5. Darstellung des Lehr-Lern-Prozesses Der gewählte Einstieg sieht einen Rückbezug auf die von den Schülern erarbeitete Lernlandkarte vor. Dieses Medium wurde gewählt, um den Schülern zu verdeutlichen, wo sie im Reihenverlauf stehen. Mit Hilfe der Lernlandkarte, die den Schülern bereits bekannt ist, können bereits erarbeitete Aspekte vergegenwärtigt werden, so dass die Schüler im Lernkontext ankommen. Außerdem dient das Medium dazu, den Fokus für die Lehrprobenstunde festzulegen. Es ist davon auszugehen, dass die Schüler auch auf Aspekte hinweisen werden, die bisher nicht thematisiert wurden. So soll das Medium neben der rein orientierenden Funktion dazu beitragen, eine Erarbeitungsperspektive für die Stunde (siehe TI 1) festzulegen. In der ersten Erarbeitungsphase folgt die Textrezeption im Stillen. So ist gewährleistet, dass die individuellen Lesetempi der Schüler berücksichtigt werden. Des Weiteren wird sichergestellt, dass die Schüler sich dem Text unvoreingenommen nähern und ihre Wahrnehmung nicht durch eine bereits wertende und auf wichtige Aspekte lenkende Präsentation verfälscht wird. Im anschließenden Rezeptionsgespräch sollen sich die Schüler frei zum Textmaterial äußern (TI 2). Da sie den gesamten Roman bereits kennen, kann es sein, dass die Schüler zunächst eine Einordnung in den Romankontext vornehmen werden. Durch die Reihenkonzeption kann davon ausgegangen werden, dass die Lernenden Bezug auf die Position der Eltern im Spannungsfeld Gesellschaft vs. Individuum nehmen und versuchen, erste Deutungsansätze diesbezüglich aufzustellen. Diese Ansätze sollen gegebenenfalls auf Folie fixiert werden, sodass im weiteren Verlauf auf sie zurückgegriffen werden kann. Somit wird auch die Transparenz für die Schüler erhöht. Sollten die Lernenden wider Erwarten nicht auf den Konflikt zwischen gesellschaftlichen Konventionen und individuellen Wünschen eingehen, wird mit einem verbalen Zusatzimpuls seitens der Lehrkraft nachgesteuert. Es ist darüber hinaus wahrscheinlich, dass die Naturmetaphorik im Rezeptionsgespräch angesprochen wird, da sie im Verlauf der Reihe bereits thematisiert wurde. Dies kann zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgegriffen werden, um die Bedeutung der Szene im 12 Romanverlauf zu beurteilen. Sollten die Schüler hier schon genauer auf die Bedeutung der einzelnen Symbole eingehen, wird dieser Aspekte in der Erarbeitungsphase funktional eingebunden. Es kann nicht erwartet werden, dass die Schüler bereits hier Bezug auf den Ausruf „Effi, komm nehmen, da dieser bisher nicht thematisiert wurde, sollte dies dennoch der Fall sein, wird dies in der Erarbeitungsphase II berücksichtigt werden. Die folgende Erarbeitungsphase II soll dazu beitragen, die aufgestellten Deutungsansätze zu verifizieren oder zu widerlegen. So sollen die Positionen der Eltern innerhalb des Spannungsfeldes und ihre Wertvorstellungen erarbeitet werden, indem der Dialog auf die Argumente und Beweggründe der Eltern hin untersucht wird (TI 3). Für den Fall, dass die Schüler schon genauer auf die Symbolik der Passage eingegangen sind, wird der Arbeitsauftrag um die Frage erweitert, welche Funktion die Symbole an dieser Stelle erfüllen. Die Arbeit findet in Kleingruppen statt. Da die Textstelle sehr gehaltvoll ist, ist eine Sozialform, die den Austausch der Schüler untereinander fördert, hier sinnvoll. So dient die gemeinsame Arbeit und Diskussion der Erweiterung der eigenen Perspektive und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der Textausschnitt in seiner Gesamtheit erfasst wird. Um zu gewährleisten, dass alle Gruppenmitglieder sich aktiv an der Erarbeitung beteiligen, sollte die Gruppengröße nicht mehr als maximal vier Schüler betragen. Jede Gruppe wird zu Beginn der Erarbeitungsphase mit einer Folie ausgestattet, auf die bei der anschließenden Präsentation zurückgegriffen wird. Dadurch, dass alle Gruppen ihre Ergebnisse schriftlich fixiert haben, kann in der Auswertungsphase flexibel entschieden werden, welche Gruppe ihre Ergebnisse präsentiert. Eine mögliche Alternative wäre in dieser Phase eine kooperative Lernform, bei der nach einer kurzen Einzelarbeit, die Ergebnisse mit dem Partner ausgetauscht werden, bevor sie in Gruppen diskutiert werden. Hierauf wurde aus Zeitgründen verzichtet. In der anschließenden Auswertungsphase sollen ein bis zwei Gruppen ihre Ergebnisse präsentieren. Alle Schüler der Gruppe präsentieren die Ergebnisse gemeinsam, sodass sie sich untereinander ergänzen können. Um die Zuhörenden mit einzubinden, agieren diese als Kontrollgruppe und ergänzen und korrigieren das Gehörte. Anschließend verhandeln und diskutieren die Lernenden die vorgestellten Ergebnisse im Plenum. Ist der Erkenntnisstand noch sehr oberflächlich, wird es Aufgabe der Lehrkraft sein, nachzusteuern und den Blick noch einmal gezielt auf bestimmte Passagen der Textstelle zu lenken. Die Naturmetaphorik der Passage kann hier als vorausdeutendes Element sinnvoll mit eingebunden werden. Nach der Auswertungsphase soll noch einmal auf die aufgestellten Deutungsansätze der Schüler zurückverwiesen werden, um diese auszuschärfen oder zu korrigieren. Dieser Rückbezug eignet sich, um ein vorläufiges Fazit zu ziehen. Hier ergibt sich folglich eine mögliche Bruchstelle falls die Stunde zeitlich bereits weit vorangeschritten ist. In der Vertiefungsphase bewerten die Schüler anhand des Ausrufs „Effi, komm, inwiefern die Szene dramaturgische Bedeutung für den Romanverlauf hat. Möglicherweise haben die Schüler diesen Aspekt bereits im Rezeptionsgespräch erwähnt. In diesem Fall kann dies an dieser Stelle als Überleitung genutzt werden. Sollte dies nicht der Fall sein, wird ein 13 Zusatzimpuls vonnöten sein. Es ist möglich, dass die Lernenden sich nicht von selbst auf den ersten Warnruf dieser Art beziehen. Für diesen Fall ist ein weiterer Zusatzimpuls auf Folie geplant, der die Textstelle des zweiten Kapitels noch einmal ins Blickfeld der Schüler ruft. Hier kann die Naturmetaphorik erneut sinnvoll integriert werden, da auch sie ein Indiz dafür ist, dass der Kreis der Romanhandlung sich schließt. Falls die Zeit es erlaubt, könnte die Bedeutung der Ausrufe in einem Schaubild dargestellt werden. 6. Geplanter Stundenverlauf TI U.-Phase U.-Gegenstand Methode/ Sozialform Medium (1) Einstieg Impuls: Lernlandkarte Verorten des Stundenthemas im Reihenkontext oUG OHFolie (2) Erarbeitung Zwischensicherung: (3) Erarbeitung II Handlungsoption A: SuS entwickeln eine Erarbeitungsperspektive für die Stunde. (Stellung der Eltern im Spannungsfeld Individuum vs. Gesellschaft) Textrezeption: Kapitel 34, S. 315 („Frau von Briest hatte den Brief) – S. 316 („Telegramm schicken) Buch SuS lesen den Text im Stillen EA Rezeptionsgespräch: SuS äußern sich in Bezug auf: Einordnung in den Romankontext Inhalt Wirkung Deutung: Gesellschaft vs. Individuum, Symbolik, oUG Bündelung mit Rasterbegriffen evtl. Sicherung der Deutungsansätze auf Folie (wenn die SuS noch nicht auf die Symbolik eingegangen GA sind) AA: Analysiert die folgende Textstelle im Hinblick auf die Positionen der Eltern innerhalb des Spannungsfelds Individuum vs. Gesellschaft. Wie begründen sie ihre Positionen und was hat für sie Priorität? OH-Folie (3) (4) Handlungsoption B: (wenn die SuS bereits auf die Einstellung der Eltern und GA die Symbolik eingegangen sind) AA: Analysiert die folgende Textstelle im Hinblick auf die Positionen der Eltern innerhalb des Spannungsfelds. Wie begründen sie ihre Positionen und was hat für sie Priorität? Untersucht auch die Funktion der Symbole, die in diesem Abschnitt erwähnt werden. OH-Folie (4) (5) Auswertung Vorstellen der Ergebnisse (1-2 Gruppen) OH-Folie SB/UG Die anderen SuS agieren als Kontrollgruppe, die Ergänzungen und Kommentare liefern kann. 14 (6) Vertiefung HA: keine Rückbezug auf die Deutungsansätze SuS beurteilen, inwieweit der Ausruf „Effi komm UG symbolisch gemeint ist und welche Bedeutung er für die Dramaturgie des Romans hat. Zusatzimpuls siehe Anhang 8.2. (optional) AA: Fertigt ein Schaubild an, dass die Bedeutung der beiden Rufe „Effi, komm! für den weiteren Romanverlauf deutlich macht. Der Unterricht wird in der 8. Stunde fortgesetzt. OH-Folie 7. Literatur Aust, Hugo. Theodor Fontane: Ein Studienbuch. Tübingen, Basel: Francke, 1998. Dieckhoff, Klaus: Romanfiguren Theodor Fontanes in andragogischer Sicht. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 1994. Dieterle, Regina: Vater und Tochter: Erkundung einer erotisierten Beziehung in Leben und Werk Theodor Fontanes. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 1996. Fontane, Theodor. Effi Briest. Paderborn: Schöningh, 2005. Hamann, Elsbeth: Theodor Fontanes „Effi Briest aus erzähltheoretischer Sicht unter besonderer Berücksichtigung der Interdependenzen zwischen Autor, Erzählwerk und Leser. Bonn: Bouvier, 1984. Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung, Mainz (Hg.): Lehrplan Deutsch. Grund- und Leistungsfach Jahrgangsstufen 11-13 der gymnasialen Oberstufe. Mainz, 1998. Müller-Seidel, Walter: Theodor Fontane: soziale Romankunst in Deutschland. Stuttgart: Metzler, 1980. Rösel, Manfred: „Das ist ein weites Feld.: Wahrheit und Weisheit in einer Fontaneschen Sentenz. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 1997. Schuster, Peter-Klaus: Theodor Fontane: Effi Briest- Ein Leben nach christlichen Bildern. Tübingen: Niemeyer Verlag, 1978. 15 8. Anhang 8.1. Textauszug (S. 315, Z. 20 – S. 316 Z. 31) Frau von Briest hatte den Brief ihrem Manne vorgelesen; beide saßen auf dem schattigen Steinfließengange, den Gartensaal im Rücken, das Rondell mit der Sonnenuhr vor sich. Der um die Fenster sich rankende wilde Wein bewegte sich leis in dem Luftzuge, der ging, und über dem Wasser standen ein paar Libellen im hellen Sonnenschein. Briest schwieg und trommelte mit dem Finger auf dem Teebrett. „Bitte trommle nicht; sprich lieber. „Ach, Luise, was soll ich sagen. Dass ich trommle, sagt gerade genug. Du weißt seit Jahr und Tag, wie ich darüber denke. Damals, als Innstettens Brief kam, ein Blitz aus heiterem Himmel, damals war ich deiner Meinung. Aber das ist nun schon wieder eine halbe Ewigkeit her; soll ich hier bis an mein Lebensende den Großinquisitor spielen? Ich kann dir sagen, ich hab es seit lange satt . „Mache mir keine Vorwürfe, Briest; ich liebe sie so wie du, vielleicht noch mehr; jeder hat seine Art. Aber man lebt doch nicht bloß in der Welt, um schwach und zärtlich zu sein und alles mit Nachsicht zu behandeln, was gegen Gesetz und Gebot ist und was die Menschen verurteilen und, vorläufig wenigsten, auch noch – mit Recht verurteilen. „Ach was. Eins geht vor. „Natürlich, eins geht vor; aber was ist das eine? „Liebe der Eltern zu ihren Kindern. Und wenn man gar bloß eines hat . „Dann ist es vorbei mit Katechismus und Moral und mit dem Anspruch der ‚Gesellschaft‘. „Ach, Luise, komme mir mit Katechismus, soviel du willst; aber komme mir nicht mit ‚Gesellschaft‘. „Es ist schwer, sich ohne Gesellschaft zu behelfen. „Ohne Kind auch. Und dann glaube mir, Luise, die ‚Gesellschaft‘, wenn sie nur will, kann auch ein Auge zudrücken. Und ich stehe so zu der Sache: kommen die Rathenower, so ist es gut, und kommen sie nicht, so ist es auch gut. Ich werde ganz einfach telegraphieren: ‚Effi, komm.‘ Bist du einverstanden? Sie stand auf und gab ihm einen Kuss auf die Stirn. „Natürlich bin ichs. Du solltest mir nur keinen Vorwurf machen. Ein leichter Schritt ist es nicht. Und unser Leben wird von Stund an ein anderes. „Ich kanns aushalten. Der Raps steht gut, und im Herbst kann ich einen Hasen hetzen. Und der Rotwein schmeckt mir noch. Und wenn ich das Kind erst wieder im Hause habe, dann schmeckt er 16 mir noch besser . Und nun will ich das Telegramm schicken. 8.2. Vertiefung Mögliche Zusatzimpulse: Brief Fontanes an Spielhagen vom 21. Februar 1896 „Die ganze Geschichte ist eine Ehebruchsgeschichte wie hundert andere mehr und hätte [] weiter keinen großen Eindruck auf mich gemacht, wenn nicht die Szene, beziehungsweise die Worte, „Effi, komm darin vorgekommen wären. Das Auftauchen der Mädchen an den mit Wein überwachsenen Fenstern, die Rotköpfe, der Zuruf und dann das Niederducken und Verschwinden machten solchen Eindruck auf mich, dass aus dieser Szene die ganze Geschichte entstanden ist. Textstelle S. 20, Z. 9- 16 „Effi als sie seiner ansichtig wurde, kam in ein nervöses Zittern; aber nicht auf lange, denn im selben Augenblicke fast, wo sich Innstetten unter freundlicher Verneigung ihr näherte, wurden an dem mittleren der weit offen stehenden und von wildem Wein halb überwachsenen Fenster die rotblonden Zöpfe der Zwillinge sichtbar, und Hertha, die Ausgelassenste, rief in den Saal hinein: „Effi, komm. (S. 20) Textstelle S. 23, Z. 26- 31 „Er glaubte nicht an Zeichen und Ähnliches, im Gegenteil, wies alles Abergläubische weit zurück. Aber er konnte trotzdem von den zwei Worten nicht los, und während Briest immer weiter perorierte, war es ihm beständig, als wäre der kleine Hergang doch mehr als ein bloßer Zufall gewesen. (S. 23) 17