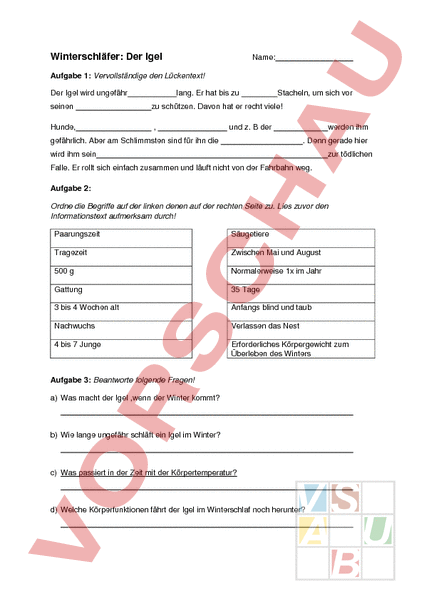Arbeitsblatt: Tiere im Winter
Material-Details
Arbeitsblätter
Biologie
Tiere
6. Schuljahr
16 Seiten
Statistik
81244
2520
60
13.05.2011
Autor/in
Michèle Mülhauser
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Winterschläfer: Der Igel Name: Aufgabe 1: Vervollständige den Lückentext! Der Igel wird ungefähr lang. Er hat bis zu Stacheln, um sich vor seinen zu schützen. Davon hat er recht viele! Hunde, und z. der gefährlich. Aber am Schlimmsten sind für ihn die werden ihm Denn gerade hier wird ihm sein zur tödlichen Falle. Er rollt sich einfach zusammen und läuft nicht von der Fahrbahn weg. Aufgabe 2: Ordne die Begriffe auf der linken denen auf der rechten Seite zu. Lies zuvor den Informationstext aufmerksam durch! Paarungszeit Säugetiere Tragezeit Zwischen Mai und August 500 Normalerweise 1x im Jahr Gattung 35 Tage 3 bis 4 Wochen alt Anfangs blind und taub Nachwuchs Verlassen das Nest 4 bis 7 Junge Erforderliches Körpergewicht zum Überleben des Winters Aufgabe 3: Beantworte folgende Fragen! a) Was macht der Igel ,wenn der Winter kommt? b) Wie lange ungefähr schläft ein Igel im Winter? c) Was passiert in der Zeit mit der Körpertemperatur? d) Welche Körperfunktionen fährt der Igel im Winterschlaf noch herunter? e) Warum frisst sich der Igel im Sommer ein Fettpolster an? Die Aufgaben 1-3 kannst du selber kontrollieren! Aufgabe 4: Überlege dir Antworten auf diese Fragen. Mach dir Notizen! Erkläre, was passiert, wenn ein Igel seine Fettpolster vor dem Ende des Winters aufgebraucht hat! Was kannst du tun, damit sich ein Igel in deinem Garten wohlfühlt? Was kannst du tun, wenn du im Winter einen Igel findest? Winterruher: Das Eichhörnchen Name: Aufgabe 1: Fülle das Rätsel aus! Findest du das richtige Lösungswort? a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Was ist das auffälligste Merkmal des Eichhörnchens? Wozu dient der Schwanz beim Klettern? An welchem Körperteil ist das Eichhörnchen sehr muskulös? Deshalb ist das Eichhörnchen eine flinker, guter Durch das seitliche Sehen kann das Eichhörnchen herannahende früher sehen. Deshalb liegen die Augen des Eichhörnchens weit Feinde am Boden sind Füchse und Welche Greifvögel sind seine Feinde? Eichhörnchen sind Um seinen Feinden zu entkommen, klettert ein Eichhörnchen den Bauch hoch und runter. a) b) c) d) e) f) g) 1) 2) i) j) Aufgabe 2: Wie nennt man die Behausung des Eichhörnchens? Wo und wie wird es gebaut? Besitzt ein Eichhörnchen eine Wohnung? Aufgabe 3: Mach dir Notizen zu folgenden Fragen. a) Wo lagert das Eichhörnchen seine Wintervorräte? b) Wie findet das Eichhörnchen seine Wintervorräte wieder? c) Warum verändert sich das Fell des Eichhörnchens, sobald es kälter wird? d) Wie verhält sich ein Eichhörnchen im Winter? Winterstarre: Eidechse und Frosch Name: Aufgabe 1: a) Was bedeutet der Begriff „wechselwarm? Erkläre! b) Was können diese Tiere gegen das Erfrieren bei Minusgraden im Winter unternehmen (denn diese würden zum Tod führen), wie können sie sich schützen? Was bedeuten die Begriffe „Reptilien und „Amphibien? Erkläre! Reptilien: Amphibien: Aufgabe 2: Bringe Ordnung in den Ablauf der Winterstarre! Ich grabe mich ein und senke meinen Herzschlag so weit ab, dass ich kaum noch Energie brauche. Ich halte im Wasser Winterstarre, deshalb kann ich auch über meine Haut atmen. Im Teich muss genug Sauerstoff sein, weil ich sonst ersticken müsste. Guten Tag, ich bin ein Grasfrosch. Wenn es Winter wird, begebe ich mich in 1 Winterstarre. Weil es im Winter sehr kalt wird, begebe ich mich im Herbst in den Schlamm unseres Teiches, um nicht zu erfrieren. Weil ich kaum noch Energie brauche, benötige ich auch weniger Sauerstoff. Darum hole ich nur ganz selten Luft, manchmal eine Minute lang gar nicht! Ich suche mir eine nette Froschdame für meinen Nachwuchs. Das heisst, dass ich meine Körpertemperatur den äusseren Temperaturen anpasse. Deshalb nennt man mich auch ein „wechselwarmes Tier. In der Winterstarre geht bei mir alles etwas langsamer. Erst im März oder April erwache ich langsam wieder aus meiner Winterstarre. Aufgabe 3: Die nachfolgende Tabelle zeigt, wie sich das Verhalten der Frösche mit den Aussentemperaturen verändert. Je niedriger die Temperaturen, desto herabgesetzter die Körperfunktionen. Ab etwa 3 Grad fallen sie in die Winterstarre. Versuche zu erklären, was die Werte in der Tabelle bedeuten. Mache dir Notizen! Atemzüge pro Minute Aussentemperaturen Keiner 3ºC Keiner 5ºC 1 10 º 5 15 º Winteraktive Tiere: Fuchs und Reh Name: Aufgabe 1: Kreuze die richtigen Antworten an!(Vielleicht sind auch mehrere Antworten richtig!) a) Der Fuchs ist ca. 3 Meter gross ca. 7 kg schwer ein Stalltier b) Füchse leben in geschlossenen Waldgebieten Hochhäusern Wald-, Feld- oder Parkanlagen c) Der Fuchs ist ein Zugtier tagaktives Raubtier nachtaktives Raubtier d) Füchse fressen Weizen und Getreide Beeren und Früchte Kaninchen, Mäuse und Vögel e) Feinde des Fuchses sind Kühe Menschen Wespen f) Überträger der Tollwut Säugetiere Winterschläfer Füchse sind g) Füchse paaren sich im Sommer legen Eier werden nach 4 Monaten selbständig Aufgabe 2: Kreuze an, was „winteraktives Tier bedeutet! a) b) c) d) e) Das Tier zieht sich im Winter in einen Unterschlupf zurück. Das Tier zieht weiter auf der Suche nach Nahrung. Wenn der Winter sehr hart und schneereich ist, greifen sie auf ihre Vorräte zurück. Manchmal werden Rehe in harten Wintern von Menschen gefüttert. Rehe sind im Winter häufig in Rudeln unterwegs, da sie so grössere Chancen haben, Futter zu finden. f) Rudel sind auch ein guter Schutz vor Feinden. g) Füchse sind Tiere, die im Winter zum Fressen aufstehen. h) Winteraktive Tiere zehren den ganzen Winter von ihren Fettreserven, die sie sich im Herbst angefressen haben. i) Die Körpertemperatur von Füchsen und Rehen passt sich immer der jeweiligen Aussentemperatur an. Aufgabe 3: Bauernregeln stehen oft im Zusammenhang mit dem Verhalten von Tieren. Versuche eine Erklärung für die folgenden Bauernregeln zu finden! „Ein glattes Fell bei Fuchs und Reh, dann wird der Winter mild hergeh. „Glatter Pelz beim Wilde, dann wird der Winter milde. „Tummelt sich im November die Haselmaus, bleibt der Winter noch sehr lange aus. „Kommt die Feldmaus in das Dorf, so kümm re dich um Holz und Torf. Winterreise/Winterwanderung Winterfell/Winterkleid Winterschlaf Beispiele: Beispiele: Beispiele: Überwinterung im Tierreich Winterstarre Beispiele: Winteraktive Tiere Beispiele: Winterruhe Beispiele: Vögel im Winter Nahrungsgrundlage im Winter Selbst in der kargen Winterszeit gibt es vielerlei natürliche Nahrungsquellen, die den Vögeln das Überleben ermöglichen. Meisen suchen in den Rindenspalten und unter der Baumrinde nach Beute: Insekten, die dort Winterschlaf halten, Insektenpuppen und Eier, Spinnen und Tausendfüssler werden aus dem Verborgenen hervorgeholt. Wenn wir ein Stück Rinde abreissen, sehen wir, wie reichhaltig der Speisezettel sein kann. Unter den bei uns überwinternden Greifvogel- und Eulenarten haben die Mäusefresser wie Mäusebussard, Turmfalke, Rotmilan und Schleiereule gelegentlich Nahrungsprobleme. Sobald nämlich eine hohe, geschlossene Schneedecke liegt, zeigen sich die Mäuse nicht mehr an der Oberfläche. Leben im eiskalten Wasser Bei Wasservögeln und insbesondere bei Tauchenten besteht fast das ganze Jahr hindurch die Gefahr, dass sie unterkühlen. Sie schwimmen und tauchen bei allen Wassertemperaturen, sogar bei Minusgraden, da Salzwasser auf eine Temperatur von -2C abkühlen kann! Frieren die Seen zu, stehen Enten mit nackten Füssen auf dem Eis. Unter solchen Bedingungen hält der Körper die Kerntemperatur in den lebenswichtigen Organen aufrecht, in den äusseren Körperbereichen und in der Haut senkt er hingegen die Temperatur ab. Durch diese Absenkung verringert sich der Temperaturunterschied zwischen Haut und Umgebung und es wird verhindert, dass das warme Blut an der Körperoberfläche abkühlt. Schutz vor der Kälte Bei Kälte und Schnee gilt es, möglichst viel Energie zu sparen. Die Vögel plustern sich auf und bewegen sich wenig. Je kälter es wird, desto mehr plustern sich Vögel auf. Die Luftschicht zwischen den aufgerichteten Federn dämmt die Wärmeverluste ein. Der wichtigste Schutz der Vögel ist das Federkleid, das ihren Körper isoliert und sie im Winter vor zu grossem Wärmeverlust schützt. Da die normale Körpertemperatur der Vögel über 40 Grad liegt, ist dieser Schutz im Winter besonders wichtig. Schlafen bei Kälte und Schnee Die meisten Vögel verbringen die Nacht schlafend. Sie verbrauchen dabei – wie wir Menschen auch – wenig Energie, da sie sich nicht bewegen und der gesamte Stoffwechsel reduziert ist. Manche Vögel suchen über Nacht windgeschützte Orte in dichter, immergrüner Vegetation auf. Andere wählen zum Schlafen Höhlen, Spalten und alte Nester. Viele Raufusshühner graben täglich eine Höhle in den Schnee. Durch die windgeschützte Lage und die höhere Umgebungstemperatur kommt der Vogel in den Genuss des IgluEffekts. Eine weitere Methode, sich nachts zu wärmen, bietet das Schlafen in einer Gruppe mit Körperkontakt. Von Zaunkönigen, Tannenmeisen und Gartenbaumläufern ist bekannt, dass sie sich nachts bei grosser Kälte zu einem solchen Kontaktschlaf zusammenfinden. Zugvögel Als Vogelzug bezeichnet man den alljährlichen Flug der Zugvögel von ihren Brutgebieten zu ihren Winterquartieren und wieder zurück. Vogelpopulationen, bei denen nur ein Teil zieht, bezeichnet man als Teilzieher. Populationen, die nicht ziehen, bezeichnet man als Standvögel. Vogelzug und Stoffwechsel Um auch große Distanzen ohne Nahrungsaufnahme zurücklegen zu können, aktivieren die Zugvögel nicht nur ihre vor Beginn des Vogelzugs angelegten Fettvorräte. Sie greifen sogar auf die Eiweiße ihrer inneren Organe zurück, so dass auch diese zumindest teilweise dem Stoffwechsel zwecks Energiegewinn zugeführt werden. Bei diesem auch Verbrennung genannten Vorgang von Fett und Eiweiß wird Wasser freigesetzt, das in erheblichem Maße dazu beiträgt, die Aufnahme von Trinkwasser zu verringern. Die Dauer de Aufenthaltes an Zwischenstationen ist nachweislich von den Fettreserven abhängig. Gut genährte Tiere halten sich dort kürzer auf als weniger gut genährte. Mit wenig Futter versorgte Tiere zeigten eine geringere Zugunruhe als jene Artgenossen, die sich reichlich Fett anfressen konnten. Radar-Vogelzugbeobachtung Da der größte Teil des Vogelzugs nachts geschieht, entzieht er sich einer vollständigen visuellen Beobachtung. Auch der Umstand, dass Vögel zum Teil in sehr großen Höhen, und zwar über 9100 Meter und damit oft über den Wolken ziehen, macht eine visuelle Erfassung ohne technische Hilfsmittel unmöglich. Radargeräte geben dagegen weitestgehend unabhängig von Sichtverhältnissen Auskunft über die Intensität des Vogelzugs. Damit kann auch die Sicherheit im Flugverkehr zu Zugzeiten überwacht werden. Langstreckenzieher, auch Fernzieher oder Weitstreckenzieher genannt, sind Zugvögel, deren Brutgebiete sehr weit (in der Regel über 4000 km) von den Überwinterungsgebieten entfernt sind. Langstreckenzieher sind genetisch auf ihr Zugverhalten programmiert. Die europäischen Langstreckenzieher sind sogenannte obligate Zugvögel (sie müssen wegziehen), die auf verschiedenen Routen die Alpen, das Mittelmeer und die Sahara überqueren. Ihre Überwinterungsgebiete liegen daher südlich der Sahara und reichen bis in die gemäßigten Zonen Südafrikas. Die meisten Langstreckenzieher ziehen in der Nacht. Kurzstreckenzieher Unter Kurzstreckenzieher versteht man in der Vogelkunde Arten, deren Winterquartiere selten weiter als 2000 Kilometer vom Brutgebiet entfernt liegen. So überwintern nordeuropäische Brutvögel häufig an der Atlantikküste, in Großbritannien oder in Mitteleuropa, mitteleuropäische dagegen meist im Mittelmeerraum. Das Mittelmeer wird nur selten überflogen. Die Sahara wird von Kurzstreckenziehern in der Regel nicht überquert. Viele Kurzstreckenzieher sind keine obligaten Zugvögel, sondern Teilzieher, deren Wegzug auch von klimatischen Ereignissen ausgelöst wird. Häufig werden von einer Art mehrere Zugstrategien angewandt. In Mitteleuropa ist vielleicht das Rotkehlchen der bekannteste Kurzstreckenzieher, das heißt, die Rotkehlchen, die wir im Winter beobachten, stammen aus Nord- beziehungsweise Nordosteuropa, während die Rotkehlchen, die in Mitteleuropa brüten, den Winter im Mittelmeerraum verbringen. Einige Arten sind in der Lage, Mehrfachstrategien anzuwenden: So kann zum Beispiel die Mönchsgrasmücke sowohl Standvogel, Kurzstreckenzieher als auch Langstreckenzieher sein. Vögel im Winter Name: Löse das Kreuzworträtsel und korrigiere mit dem Lösungsblatt. Waagerecht: 1. Vögel am Wasser müssen aufpassen, dass sie nicht. 3. Während der Reise ernähren sich Zugvögel von. 7. Greifvögel und Eulen fressen im Winter auch. 10. Das tun Standvögel um sich vor der Kälte zu schützen. 12. Der wichtigste Schutz der Vögel gegen die Kälte. 13. Hier finden Standvögel Insekten etc. 14. Damit kann man die Reise der Zugvögel verfolgen. 15. Sie beträgt normalerweise etwa 40 Grad. 16. Zugvögel fliegen meistens. 17. Die Reise von Vögeln in ihre Winterquartiere bezeichnet man als. Senkrecht: 2. Diese Vögel fliegen bis ans Mittelmeer. 4. Im Winter müssen Vögel.sparen. 5. Diese Vögel verlassen die Schweiz im Winter. 6. Um sich warm zu halten suchen Vögel oft. 8. Das Gegenteil eines Zugvogels. 9. Diese Vögel fliegen bis nach Afrika. 11. Langstreckenzieher überfliegen die. Schreibe zu folgenden Fragen deine Vermutungen auf: Wir tauschen anschliessend zusammen aus. 1. Warum fliegen Zugvögel überhaupt weg? Was sind Ursachen des Vogelzugs? 2. Wie wissen die Vögel wohin sie fliegen müssen? Wie orientieren sie sich? 3. Welche Gefahren drohen ihnen auf ihrer Reise? 4. Wie und womit soll man Standvögel im Winter füttern? 5. Kennst du Regeln für die Winterfütterung von Vögeln? Schreibe sie auf. Grundsätze für die sachgemässe Fütterung: (www.vogelwarte.ch) Wann soll man füttern? Bei Dauerfrost, bei Eisregen oder wenn eine geschlossene Schneedecke liegt, kann die Fütterung eine Überlebenshilfe sein. Tageszeit: Der Futterbedarf ist morgens am grössten, weil die Vögel nach der langen Nacht hungrig sind. Allenfalls füllen wir im Verlauf des Nachmittags das Futter erneut auf, weil die Vögel gegen Abend nochmals auftanken, um für die Nacht vorzusorgen. Achten Sie grundsätzlich auf naturnahes, qualitativ einwandfreies Futter. Dieses sollte weder gesalzen noch aufbereitet sein und auch keine chemischen Zusatzstoffe enthalten. Brot ist nicht empfehlenswert. Aus ökologischen Gründen verzichten wir auf die Verwendung von Futterbestandteilen, die aus weit entfernten Ländern stammen, namentlich auf Palmöl, Kokosfett und Erdnüsse. Futtermischungen, die viele Getreidekörner enthalten, werden fast nur von Tauben und Sperlingen gefressen. Deshalb ist es ratsam, Mischungen zu verwenden, die ganz oder grösstenteils aus Sonnenblumenkernen und Hanfsamen bestehen. Dunkle Sonnenblumenkerne haben eine weichere Schale und können von den Vögeln besser geöffnet werden. Körnerfresser (Vögel mit dickem, kräftigem Schnabel: Finken, Sperlinge, Ammern) bevorzugen Sonnenblumenkerne und Hanfsamen. Sie halten sich zusätzlich an das für Weichfresser empfohlene Futter. Weich- und Insektenfresser (Vögel mit spitzem, schlankem Schnabel) fressen v.a. tierische Kost und feine Sämereien. Nur wenige Arten wie Amsel, Rotkehlchen und Star sind häufige und mehr oder weniger regelmässige Besucher am Futterbrett. Sie fressen gerne Haferflocken, Rosinen und Obst, das bereits etwas angefault sein darf, zerhackte Baum- und Haselnüsse, Fett und Quark. Zugvögel kommen seltener ans Futterbrett. Sie können jedoch vor allem im Vorfrühling durch späten Schneefall in ihrer Nahrungssuche stark behindert werden. In solchen Situationen kann es für sie hilfreich sein, wenn wir Komposthaufen oder Miststöcke abdecken und unter Bäumen und Sträuchern oder auf einem Vorplatz den Schnee entfernen. Dort streuen wir etwas Haferflocken, Rosinen oder verteilen einzelne alte Äpfel. Wie soll man füttern? Futter so darbieten, dass es nicht nass wird und vereist (Häuschen mit witterungsgeschütztem Futtervorrat oder Futtersäckchen. In der Nähe des Futterhauses sollten Bäume und Gebüsche stehen, die bei Gefahr als Zufluchtsort dienen. Die unmittelbare Umgebung der Futterstelle mindestens im Umkreis von 2 - sollte überschaubar sein, damit nicht Feinde, wie Katzen, den Vögeln auflauern können. Die Übertragung und Ausbreitung seuchenartiger Erkrankungen stellen mit Abstand die grösste Gefahr an winterlichen Futterstellen dar. Zu ihnen gehört die Salmonellose, eine tödliche bakterielle Darminfektion. Kotverunreinigungen am Futterbrett müssen möglichst vermieden werden. Die Vögel sollten also nicht ins Futter sitzen können. Allfällige Verunreinigungen mit heissem Wasser beseitigen. Sollten Sie tote Vögel um das Futterhaus finden, so muss dieses sofort entfernt und gründlich gereinigt werden. Die Fütterung darf dann erst 2-3 Tage nach der Reinigung wieder aufgenommen werden. Vögel baden auch im Winter gerne und stillen ihren Durst an einer Wasserstelle. Hier besteht jedoch eine erhöhte Gefahr, dass Krankheiten verbreitet werden. Deshalb empfehlen wir, nur dann eine Wasserstelle anzubieten, wenn streng auf die hygienischen Verhältnisse geachtet und das Wasser täglich mindestens einmal gewechselt werden kann. Noch besser sind Vogelbäder, bei denen dauernd etwas Wasser fliesst. Auf katzensichere Platzierung achten!