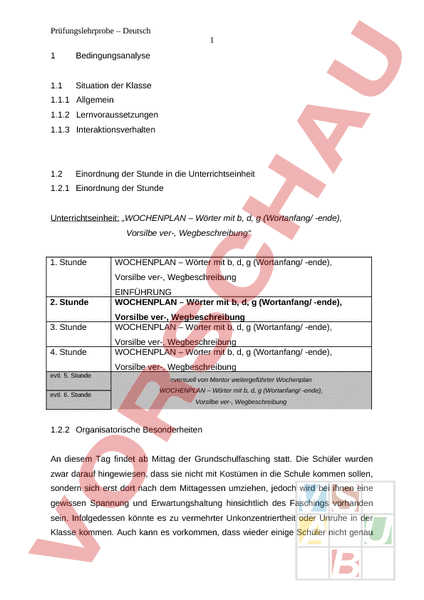Arbeitsblatt: Unterrichtsentwurf Auslautverhärtung
Material-Details
Unterrichtsentwurf zu einem WOchenplan zur Auslautverhärtung
3.Stunde
Deutsch
Rechtschreibung
4. Schuljahr
10 Seiten
Statistik
81645
1872
14
18.05.2011
Autor/in
Y. Klaubert
Land: Deutschland
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Prüfungslehrprobe – Deutsch 1 1 Bedingungsanalyse 1.1 Situation der Klasse 1.1.1 Allgemein 1.1.2 Lernvoraussetzungen 1.1.3 Interaktionsverhalten 1.2 Einordnung der Stunde in die Unterrichtseinheit 1.2.1 Einordnung der Stunde Unterrichtseinheit: „WOCHENPLAN – Wörter mit b, d, (Wortanfang/ -ende), Vorsilbe ver-, Wegbeschreibung 1. Stunde WOCHENPLAN – Wörter mit b, d, (Wortanfang/ -ende), Vorsilbe ver-, Wegbeschreibung 2. Stunde EINFÜHRUNG WOCHENPLAN – Wörter mit b, d, (Wortanfang/ -ende), 3. Stunde Vorsilbe ver-, Wegbeschreibung WOCHENPLAN – Wörter mit b, d, (Wortanfang/ -ende), 4. Stunde Vorsilbe ver-, Wegbeschreibung WOCHENPLAN – Wörter mit b, d, (Wortanfang/ -ende), Vorsilbe ver-, Wegbeschreibung evtl. 5. Stunde evtl. 6. Stunde eventuell von Mentor weitergeführter Wochenplan WOCHENPLAN – Wörter mit b, d, (Wortanfang/ -ende), Vorsilbe ver-, Wegbeschreibung 1.2.2 Organisatorische Besonderheiten An diesem Tag findet ab Mittag der Grundschulfasching statt. Die Schüler wurden zwar darauf hingewiesen, dass sie nicht mit Kostümen in die Schule kommen sollen, sondern sich erst dort nach dem Mittagessen umziehen, jedoch wird bei ihnen eine gewissen Spannung und Erwartungshaltung hinsichtlich des Faschings vorhanden sein. Infolgedessen könnte es zu vermehrter Unkonzentriertheit oder Unruhe in der Klasse kommen. Auch kann es vorkommen, dass wieder einige Schüler nicht genau Prüfungslehrprobe – Deutsch 2 zugehört haben, beziehungsweise es vergessen haben und mit Kostümen in die Schule kommen, wodurch weitere Unruhe in der Klasse entstehen könnte. 2 Fachwissenschaftliche Grundlegung Die deutsche Sprache wird in zwei Gruppen von Sprachlauten unterschieden, die Vokale und die Konsonanten. Die deutsche Sprache beinhaltet 21 Konsonanten, dies sind Laute bei deren Artikulation eine Verengung des Stimmtraktes auftritt, infolgedessen der Atemluftstrom ganz oder teilweise blockiert wird. Zu unterscheiden sind Plosive, Frikative, Affrikaten, Liquide/Laterale, nasale und der Halbvokal /j/. Die Kriterien zur Unterscheidung umfassen die Stimmhaftigkeit (stimmhaft oder stimmlos ), die Artikulationsart und den Artikulationsort.1 Die Auslautverhärtung ist ein Phänomen der deutschen Sprache (und weniger anderer), welches die stimmhaften Konsonanten betrifft. Stimmhaft bedeutet, dass „die Stimmlippen sich verschließen und dann vom Luftstrom aus der Lunge „aufgesprengt werden und das so schnell hintereinander, dass sie schwingen 2, z.B. m, n, r, l, j, w, v, und auch b, d, g. Im Deutschen werden b, d, g, und am Wortende stimmlos ausgesprochen, also p, t, k, und s. Diese Artikulation findet jedoch keine Berücksichtigung in der Schrift. Zum Beispiel das Wort Kind, steht hier am Ende der Silbe und wird stimmlos ausgesprochen [t], schaut man sich die Wortverlängerung, hier Mehrzahlbildung an, Kinder steht am Ende der ersten Silbe und wird stimmhaft ausgesprochen [d].3 In der Schrift kommt Konsonantenbuchstabe für in den allen Formen stimmhaften desjeweiligen Konsonanten Wortes vor. Dies der ist zurückzuführen auf das morphologische Stammprinzip, welches besagt, dass die Wortstämme in allen Formen des Wortes die gleiche Schriftform haben. Um die richtige Schreibung des Wortes zu ermitteln, muss man es Verlängern. Bei Substantiven bildet man die Mehrzahl (Kind Kinder), bei Verben die Grundform (lebst leben) und bei Adjektiven die Steigerungsform (klug klüger). Präfixe sind Verbbildungselemente, da sie die Wortform nicht verändern aber zum Ausbau des Grundverbbestandes beitragen. Durch Verbindung von Wörtern mit 1 vgl. 04.03.2011 21:49Uhr 04.03.2011 22:05Uhr 3 vgl. Wahrig, 2007, S.20 2 Prüfungslehrprobe – Deutsch 3 Vorsilben entstehen oft Bedeutungsunterschiede der Wörter (an-kaufen – ver-kaufen ). Das Präfix ver- ist eines der am häufigsten vorkommenden in der deutschen Sprache.4 Die Verwendung von ver- überschneidet sich mit der von: be(verdecken/bedecken), er- (verlöschen/erlöschen), zer- (verfallen/zerfallen), miss(verachten/missachten), ab- (verändern/abändern), auf- (verschieben/aufschieben), aus- (verklingen/ausklingen), zu- (verbauen/zubauen), ein- (vertrocknen/eintrocknen ), durch- (verschwitzen/durchschwitzen). Es stellt aber auch einen Gegensatz zu: er(verblühen/erblühen), miss- (vertrauen/misstrauen), ent- (verhüllen/enthüllen), auf(verschließen/aufschließen).5 Es werden mit diesem Präfix ver- besonders viele Verben gebildet, die ein Verarbeiten, Verbrauchen und Verderben oder Entfernen bezeichnen.6 Die Wegbeschreibung ist ein Sachtext, wie zum Beispiel auch die Vorgangsbeschreibung, Spielanleitungen, Rezepte etc Es geht in ihnen darum, dass jemand der den Vorgang, Weg, Ablauf etc. nicht kennt, ihn mit dem Text nachvollziehen und verstehen kann. Sie sind informierend, adressatengerichtet und unterscheiden sich somit zu Erzählungen dadurch, dass sie ohne Ausschmückungen, Meinungen und Gefühle auskommen. Wichtig bei Sachtexten ist die richtige Reihenfolge und Vollständigkeit sowie die Verständlichkeit für den Adressaten. Die Beschreibung wird immer im Präsens verfasst. Damit die Beschreibung des Weges möglichst effektiv ist, sollten markante Punkte (z.B. Gebäude, Plätze) als Orientierungshilfen angeführt werden; Raum- oder Zeitangaben sollten nicht fehlen. 3 Didaktische Strukturierung und methodische Überlegungen 3.1 Didaktische Analyse Bezug zum Lehrplan Das Unterrichtsthema „WOCHENPLAN – Wörter mit b, d, (Wortanfang/ -ende), Vorsilbe ver-, Wegbeschreibung ist angesiedelt im Lernbereich Richtig schreiben und Für sich und andere schreiben. 4 vgl. DUDEN, Grammatik, 1998, S.452 vgl. DUDEN, Grammatik, 1998, S.455 6 vgl. DUDEN, Grammatik, 1998, S.459 5 Prüfungslehrprobe – Deutsch 4 Der Lernbereich Richtig schreiben hat für die Klasse 4 das Ziel, dass sie in der Lage sind rechtschreibliche Regelmäßigkeiten zu erfassen und Regeln anwenden können. Auch sollten sie fähig sein ihre eigenen Schwierigkeitsfelder zu erkennen und für sich individuelle Lernstrategien nutzen können, um richtig zu schreiben. Im Lernbereich Für sich und andere schreiben ist für die vierte Klasse das Ziel angegeben, dass sie Texte verfassen können, wobei sie die Ansicht, den Adressat und Verwendungszweck sowie formale Aspekte beachten. 7 Bedeutung für die Schüler Das richtige rechtschreibliche Schreiben ist wichtig für die weitere Lebenswelt der Schüler, sowohl zeitnah in der Schule als auch weitergehend in Ausbildung und Beruf. Sie werden dadurch befähigt Texte normgerecht zu verfassen, was wichtig ist um für alle lesbar zu sein. Zu wissen, dass Wörter anders geschrieben werden, als gesprochen ist für die Schüler schwer zu fassen und mit Übung und Anwendung besser zugänglich. Die falsche Schreibweise kann zu Bedeutungsänderungen führen, z.B. Rad-Rat, bzw. Unklarheiten beim Leser hervorrufen. Regeln und Tipps zur richtigen Schreibung müssen von den Schülern trainiert werden, damit sie anwendbar sind. Die Wegbeschreibung ist für alle sowohl als Adressat als auch als der Wegbeschreibende wichtig, da dies eine Alltagssituation darstellt. Didaktische Reduktion Die Auslautverhärtung bezieht sich in diesem Wochenplan nur auf b, d, und und lässt und außen vor. 3.2 Lernziele Die Schüler sollen in dieser Unterrichtsstunde ihr Wissen über rechtschreibliche Regelmäßigkeiten der Auslautverhärtung und dem Gebrauch von Vorsilben anwenden. die Rechtschreibstrategie des Verlängerns anwenden. das bekannte Textmuster des Beschreibens anwenden. 7 vgl. Lehrplan Deutsch Grundschule Sachsen, 2009, S.28 Prüfungslehrprobe – Deutsch 5 ihre Arbeit im Wochenplan organisieren. selbstständig mit Material umgehen. Aufgabenstellungen selbstständig erfassen und umsetzen. 3.3 Unterrichtsschritte Unterrichtsschritte Motivation Herausforderung der Aktivität, Zentrierung der Arbeitszielsetzung Arbeitsphase Aufmerksamkeit, Anstoß zum Denken Erkennen des Vorhabens Umgehen mit Material, Auseinandersetzung mit der Lernsache, Bildung von Erkenntnissen, Ausbildung des Könnens Anregungen zur Weiterarbeit, Stärkung von Haltungen Reflexion und Bewertungen, Nachdenken über die Arbeitsweise, Selbsteinschätzung Sozialformen und Medien Sozialformen: Frontalunterricht Einzelarbeit Lehrervortrag Schüler-Schüler-Interaktion Partnerarbeit Medien: Sprachbuch „Sprachfreunde 4 Arbeitsheft „Sprachfreunde 4 Wochenpläne Arbeitsblätter Wissensspeicher Deutsch Freiarbeitsmaterial (LÜK, Arbeitsblätter, Rechtschreibkarteien, vers. Sprachbücher, vers. Lesebücher) Prüfungslehrprobe Deutsch 3.4 6 Geplanter Stundenverlauf Thema der Unterrichtseinheit: WOCHENPLAN – Wörter mit b, d, (Wortanfang/ -ende), Vorsilbe ver-, Wegbeschreibung Thema der Unterrichtsstunde: WOCHENPLAN – Wörter mit b, d, (Wortanfang/ -ende), Vorsilbe ver-, Wegbeschreibung ZEIT PHASE LEHRERAKTION erwartetes SCHÜLERVERHALTEN 08:00 Begrüßung S. begrüßen L. und Besuch 08:01 Motivation L. begrüßt S. und stellt Besuch vor L. teilt S. mit, dass sie mit ihnen ein paar Runden ‚Stille Post‘ spielen will L. spielt mit S. ‚Stille Post‘ L. vermittelt S. den weiteren Verlauf der Unterrichtsstunde „Ihr habt jetzt die Aufgabe weiter euren Wochenplan zu bearbeiten. L. gibt noch Hinweise und Erläuterungen bei eventuellen Fragen L. nennt S. die Zeit bis wann sie arbeiten sollen, wenn Musik beginnt sollen die S. die angefangene Aufgabe, Wort oder Satz beenden, bis Musik zu Ende ist L. fordert S. auf mit ihrer Arbeit zu beginnen L. gibt Hilfestellungen, 08:06 08.10 Arbeitszielsetzung Arbeitsphase SOZIALFORM MEDIEN und BEMERKUNGEN FU S. verfolgen LV und stimmen FU motiviert mit ein S. spielen mit L. ‚Stille Post‘ S. verfolgen LV SSI/LSI,Spiel FU, LV S. stellen eventuell Fragen zum FU, SLG Bearbeiten des Wochenplanes oder einzelnen Aufgaben S. beginnen mit Wochenplan ST arbeiten allein oder mit Partner EA, PA stellen evtl. Fragen und benötigen Wochenpläne Sprachbuch Arbeitsheft Arbeitsblätter Freiarbeitsmateri al Wochenpläne Sprachbuch Arbeitsheft Prüfungslehrprobe Deutsch 7 beantwortet Fragen, beobachtet Hilfestellungen S. bei ihrer Arbeit und dem Umgang mit dem Material 08.38 Uhr 08.40 08.45 Reflexionsphase Abschluss L. gibt Zeit bis Musik beendet ist zum beenden der Aufgabe L. fordert eventuell S. auf Stifte wegzulegen und Zuhörbereitschaft zu signalisieren, lobt S. die Musikphase zum Beenden genutzt haben und zuhörbereit sind L. fordert S. auf ihre Arbeit zu reflektieren, Probleme die auftraten, evtl. gefundene Lösungsmöglichkeiten erläutern etc. L. reflektiert seine Beobachtungen, gibt Hinweis zum weiteren Arbeiten in der nächsten Stunde Arbeitsblätter Freiarbeitsmateri al S. beenden Arbeit einige S. legen noch den Stift hin S. sind zuhörbereit ST S. reflektieren ihre Arbeit, nennen SSG/SLG Probleme, Lösungsmöglichkeiten etc. S. nehmen Lehrerreflexion auf, LSG beachten gegebene Hinweise zur Weiterarbeit in den kommenden Stunden S. wählen eine Aufgabe die sie ST zur Lehrerkontrolle abgeben L. fordert S. auf eine von ihnen gewählte bearbeitete Aufgabe zur Lehrerkontrolle abzugeben L. schließt Stunde und fordert S. räumen auf und gehen in die ST zum Aufräumen und Frühstücken Frühstückspause auf Wochenpläne Sprachbuch Arbeitsheft Arbeitsblätter Freiarbeitsmateri al Prüfungslehrprobe Deutsch 8 FUFrontalunterricht; LVLehrervortrag; MKMeldekette; STSchülertätigkeit; EAEinzelarbeit; PAPartnerarbeit, SSISchüler SchülerInteraktion; LSILehrerSchülerInteraktion; SSGSchülerSchülerGespräch; SLGSchülerLehrerGespräch; LSGLehrerSchülerGespräch Prüfungslehrprobe Deutsch 9 4 Anhang 4.1 Literaturverzeichnis Bausteine 4. Sprachbuch. Bildungshaus Schulbuchverlage Westermann Schroedel Diesterweg Schöningh Winklers GmbH. Braunschweig. 2005 DUDEN. Die Grammatik – Unentbehrlich für richtiges Deutsch, 7., völlig neu erarbeitete und erweiterte Auflage (Band 4 – Der Duden in 12 Bänden). Hrsg. Dudenredaktion. Dudenverlag. Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich. 2005 DUDEN Förderkartei mit Rechtschreibstrategien Deutsch Klasse 4. Duden Paetec GmbH. Berlin. 2010 DUDEN Sprachbuch 4.Duden Paetec GmbH. Berlin.2007 JoJo Sprachbuch . Richtig schreiben. Differenzierungs- und Fördermaterial. Cornelsen Verlag. Berlin. 2009 JoJo Lesebuch 4. Cornelsen Verlag. Berlin. 2004 Mentor Übungsbuch Deutsch Klasse 4. In 33 Tagen durch das Land Fehlerlos. Hrsg. Hans Gärtner, Dieter Marenbach. Mentor Verlag GmbH. München. 2006 LÜK. Rechtschreiben 2. Westermann Lernspiel GmbH. Braunschweig. 1997 LÜK. Richtig schreiben 1. Westermann Lernspielverlag GmbH. Braunschweig. 1987 LÜK. Rechtschreib-Station 4.Klasse. Westermann Lernspielverlag GmbH. Braunschweig. 2003 Papiertieger 4. Sprachbuch. Bildungshaus Schulbuchverlage Westermann Schroedel Diesterweg Schöningh Winklers GmbH. Braunschweig. 2007 Pusteblume Lesebuch 4. Bildungshaus Schulbuchverlage Westermann Schroedel Diesterweg Schöningh Winklers GmbH. Braunschweig. 2008 Sächsisches Staatsministerium für Kultus. Lehrplan Deutsch Grundschule. Dresden. 2009 Sprachfreunde 4. Ausgabe Süd. Volk und Wissen. Cornelsen Verlag. Berlin. 2004 (Arbeitsheft und Sprachbuch) Ossner, Jakob. Sprachdidaktik Deutsch. Verlag Ferdinand Schöningh. Paderborn. 2006 Unsere Muttersprache 4. Sprachbuch. Volk und Wissen Verlag GmbH. Berlin. 1991 Prüfungslehrprobe Deutsch 10 verschiedene Kopiervorlagen aus dem Fundus des Lehrerkollegiums, Klett Verleag, Diesterweg, Cornelsen und andere Prüfungslehrprobe Deutsch 11 4.2 Sitzplan Tafel Lehrertisch Theo Ole Arthur Cosima Philipp Matthias Timm Benjamin Quang Anh Robert Afrodite Julié Katrin Erik Fabian Caroline Luis Duc Anh Karl 4.3 Materialien Wochenpläne Arbeitsblätter Florian