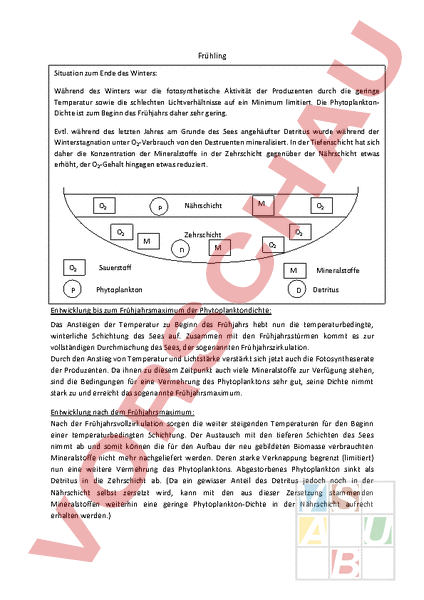Arbeitsblatt: Ökosystem See
Material-Details
Schüler können sich arbeitsteilig den See im Laufe des Jahres erarbeiten.
Biologie
Oekologie
12. Schuljahr
8 Seiten
Statistik
81874
1997
22
22.05.2011
Autor/in
Anna Hennig
Land: Deutschland
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Frühling Situation zum Ende des Winters: Während des Winters war die fotosynthetische Aktivität der Produzenten durch die geringe Temperatur sowie die schlechten Lichtverhältnisse auf ein Minimum limitiert. Die PhytoplanktonDichte ist zum Beginn des Frühjahrs daher sehr gering. Evtl. während des letzten Jahres am Grunde des Sees angehäufter Detritus wurde während der Winterstagnation unter O2-Verbrauch von den Destruenten mineralisiert. In der Tiefenschicht hat sich daher die Konzentration der Mineralstoffe in der Zehrschicht gegenüber der Nährschicht etwas erhöht, der O2-Gehalt hingegen etwas reduziert. O2 Nährschicht O2 O2 O2 Zehrschicht O2 O2 Sauerstoff Phytoplankton D Mineralstoffe Detritus Entwicklung bis zum Frühjahrsmaximum der Phytoplanktondichte: Das Ansteigen der Temperatur zu Beginn des Frühjahrs hebt nun die temperaturbedingte, winterliche Schichtung des Sees auf. Zusammen mit den Frühjahrsstürmen kommt es zur vollständigen Durchmischung des Sees, der sogenannten Frühjahrszirkulation. Durch den Anstieg von Temperatur und Lichtstärke verstärkt sich jetzt auch die Fotosyntheserate der Produzenten. Da ihnen zu diesem Zeitpunkt auch viele Mineralstoffe zur Verfügung stehen, sind die Bedingungen für eine Vermehrung des Phytoplanktons sehr gut, seine Dichte nimmt stark zu und erreicht das sogenannte Frühjahrsmaximum. Entwicklung nach dem Frühjahrsmaximum: Nach der Frühjahrsvollzirkulation sorgen die weiter steigenden Temperaturen für den Beginn einer temperaturbedingten Schichtung. Der Austausch mit den tieferen Schichten des Sees nimmt ab und somit können die für den Aufbau der neu gebildeten Biomasse verbrauchten Mineralstoffe nicht mehr nachgeliefert werden. Deren starke Verknappung begrenzt (limitiert) nun eine weitere Vermehrung des Phytoplanktons. Abgestorbenes Phytoplankton sinkt als Detritus in die Zehrschicht ab. (Da ein gewisser Anteil des Detritus jedoch noch in der Nährschicht selbst zersetzt wird, kann mit den aus dieser Zersetzung stammenden Mineralstoffen weiterhin eine geringe Phytoplankton-Dichte in der Nährschicht aufrecht erhalten werden.) Obwohl also Temperatur und Lichtverhältnisse sich zum Sommer hin für die Fotosyntheserate positiv entwickeln, sinkt die Phytoplankton-Dichte aufgrund der begrenzten Mineralstoffversorgung. In der Zehrschicht wird der hierhin abgesunkene Teil des Detritus von den Destruenten unter 2Verbrauch im Laufe von Frühling und Sommer mehr und mehr zersetzt und mineralisiert, die Mineralstoffkonzentration in der Zehrschicht wird dadurch erhöht. Durch die Atmung von Konsumenten und Destruenten in der Zehrschicht wird der 2-Gehalt um einen gewissen Anteil reduziert. Aufgabe 1: Verdeutlicht euch in der Gruppe die Verteilung von Mineralstoffen, Sauerstoff, Detritus und die Menge an Phytoplankton während des Dichtemaximums sowie zum Ende des Frühlings mit Hilfe des ausgegeben Materials. Aufgabe 2: Stellt stichpunktartig dar, woraus die Veränderung zum jeweils vorher betrachten Zeitpunkt resultiert. Beachtet hierbei Faktoren wie Phytoplankton-Dichte, Mineralstoffkonzentrationen in Nähr- und Zehrschicht, die Menge an Detritus sowie Temperatur und Lichtverhältnisse in der Nährschicht. Aufgabe 3: Bereitet einen kurzen Vortrag über die Abläufe und Veränderungen im See während des Frühlings im Vergleich zur Situation Ende des Winters vor, um eure Mitschüler zu informieren. Dichtemaximum im Frühling Nährschicht Zehrschicht O2 Sauerstoff Phytoplankton Mineralstoffe Detritus Mineralstoffe Ende des Frühjahrs Nährschicht Zehrschicht O2 Sauerstoff Phytoplankton Detritus Sommer Situation zum Ende des Frühjahrs: Zum Ende des Frühjahrs ist die Phytoplankton-Dichte nach ihrem zwischenzeitlichen Dichtemaximum wieder auf einen geringen Wert herabgesunken, da die zu Beginn des Frühjahrs reichlich vorhandenen Mineralstoffe inzwischen in der Nährschicht aufgebraucht sind. Mit dem absinkenden Detritus und dessen beginnender Zersetzung durch die Destruenten steigt die Mineralstoffkonzentration in der Zehrschicht im Vergleich zum Frühjahr langsam an. O2 Nährschicht Zehrschicht O2 Sauerstoff O2 O2 O2 M O2 Mineralstoffe Phytoplankton Detritus Während des Sommers bleibt die Situation in der Nährschicht weitestgehend gleich, da wegen der Sommerstagnation die Mineralstoffe nicht aus der Tiefe zurück in die Nährschicht gelangen. In der Zehrschicht hingegen arbeiten die Destruenten unter O2-Verbrauch weiter an der Zersetzung des Detritus, der aus dem Frühjahr noch übrig ist bzw. während der Sommerstagnation hinzukommt (zusätzliches Plankton, Tierleichen, Pflanzenreste, Kot). In der Zehrschicht steigt also im Laufe des Sommers die Mineralstoffkonzentration weiter an, während die O2-Konzentration gleichzeitig sinkt. Aufgabe 1: Verdeutlicht euch in der Gruppe die Verteilung von Mineralstoffen, Sauerstoff, Detritus und die Menge an Phytoplankton zum Ende des Sommers mit Hilfe des ausgegeben Materials. Aufgabe 2: Stellt stichpunktartig dar, woraus die Veränderung zum vorher betrachten Zeitpunkt resultiert. Beachtet hierbei Faktoren wie Phytoplankton-Dichte, Mineralstoffkonzentrationen in Nähr- und Zehrschicht, die Menge an Detritus sowie Temperatur und Lichtverhältnisse in der Nährschicht. Aufgabe 3: Bereitet einen kurzen Vortrag über die Abläufe und Veränderungen im See während des Sommers im Vergleich zur Situation Ende des Frühjahrs vor, um eure Mitschüler zu informieren. Ende des Sommers Nährschicht Zehrschicht O2 Sauerstoff Phytoplankton D Mineralstoffe Detritus Herbst Situation zum Ende des Sommers: Während des Sommers haben sich die Ungleichgewichte zwischen Nähr- und Zehrschicht verstärkt, ein Austausch von Stoffen war aufgrund der Sommerstagnation nicht möglich. In der Nährschicht des Sees finden sich wenige Mineralstoffe aber aufgrund der Tätigkeit der verbliebenen Produzenten sowie des Austausches mit der Luft viel O2. In der Zehrschicht ist es aufgrund der Arbeit der Destruenten genau anders herum. Hier finden sich nach dem fast vollständigen Abbau des Detritus viele Mineralstoffe und weniger O2. Die Phytoplankton-Dichte ist durch den Mangel an Mineralstoffen in der Nährschicht relativ gering. O2 Nährschicht Zehrschicht Sauerstoff O2 O2 O2 M O2 M Mineralstoffe Phytoplankton Detritus Entwicklung bis zum Herbstmaximum der Phytoplanktondichte: Mit dem Abkühlen des warmen Oberflächenwassers durch die sinkenden Außentemperaturen sowie den typischen Stürmen im Herbst verändert sich die Situation im See nun grundlegend. Die temperaturbedingte Schichtung der Sommerstagnation wird langsam aufgehoben. Es erfolgt eine immer tiefer voranschreitende Durchmischung des Sees, die in der Tiefe des Sees vorhandene Mineralstoffe in die Nährschicht trägt. Dies bietet dem Phytoplankton die Möglichkeit, sich erneut stark zu vermehren, da die Mineralstoffkonzentration nicht länger das Wachstum begrenzt (limitiert). Temperatur- und Lichtverhältnisse sind Anfang Herbst noch in einem Bereich, der eine gute Fotosyntheserate ermöglicht. Die Phytoplankton-Dichte erreicht daher ihr sogenanntes Herbstmaximum. Entwicklung nach dem Herbstmaximum der Phytoplanktondichte: Mit dem Abnehmen von Lichtstärke und Temperatur im weiteren Verlauf des Herbstes geht die Fotosyntheserate ihrem winterlichen Minimum entgegen, was zu einem starken Rückgang der Phytoplankton-Dichte führt. Ab jetzt und bis ins Frühjahr hinein stellen Licht und Temperatur die begrenzenden Faktoren für die Dichte des Phytoplanktons dar und nicht mehr die Konzentration der Mineralstoffe, wie es seit dem Ende des Frühjahrsmaximums der Phytoplanktondichte und über den Sommer hinweg der Fall war. Das Plankton des Herbstmaximums sinkt als Detritus an den Grund und wird hier von den Destruenten im Herbst und über den Winter unter O2-Verbrauch mineralisiert. Gegen Ende des Herbstes findet sich aufgrund der über das Dichtemaximum des Phytoplanktons hinaus gehenden Vollzirkulation eine gleichmäßige Verteilung von Mineralstoffen und Gasen im ganzen See. Aufgabe 1: Verdeutlicht euch in der Gruppe die Verteilung von Mineralstoffen, Sauerstoff, Detritus und die Menge an Phytoplankton während des Dichtemaximums sowie zum Ende des Herbstes mit Hilfe des ausgegeben Materials. Aufgabe 2: Stellt stichpunktartig dar, woraus die Veränderung zum jeweils vorher betrachten Zeitpunkt resultiert. Beachtet hierbei Faktoren wie Phytoplankton-Dichte, Mineralstoffkonzentrationen in Nähr- und Zehrschicht, die Menge an Detritus sowie Temperatur und Lichtverhältnisse in der Nährschicht. Aufgabe 3: Bereitet einen kurzen Vortrag über die Abläufe und Veränderungen im See während des Herbstes im Vergleich zur Situation Ende des Sommers vor, um eure Mitschüler zu informieren. Dichtemaximum im Herbst Nährschicht Zehrschicht O2 Sauerstoff Phytoplankton Mineralstoffe Detritus Ende des Herbstes Nährschicht Zehrschicht O2 Sauerstoff Phytoplankton D Mineralstoffe Detritus Winter Situation zum Ende des Herbstes: Durch die Herbstvollzirkulation sind alle Stoffe (Mineralstoffe, Gase) gleichmäßig im See verteilt worden. Die Phytoplankton-Dichte ist gering, da mit dem Absinken von Temperatur und Lichtstärke die Fotosyntheserate auf ein Minimum abgesunken ist. Am Grunde des Sees findet sich noch nicht zersetzter Detritus, der als Folge des Herbstmaximums der Phytoplankton-Dichte verstärkt angefallen war. O2 O2 Sauerstoff Nährschicht O2 Zehrschicht D M Mineralstoffe Phytoplankton Detritus Während des Winters ist aufgrund der niedrigen Temperatur und Lichtstärke die Photosyntheserate gering und daher auch die Phytoplankton-Dichte auf ein Minimum reduziert. Nach wie vor aktiv sind aber die Destruenten am Grunde des Sees, die hier den im Herbst noch nicht zersetzten Detritus nun unter O2-Verbrauch mineralisieren. Infolgedessen kommt es während der Winterstagnation zu einer Anhäufung von Mineralstoffen in der Zehrschicht des Sees. Gleichzeitig sinkt hier im Gegenzug die O2-Konzentration durch die Atmung der Konsumenten und Destruenten. Wegen der für die Winterstagnation typischen temperaturbedingten Wasserschichtung ist ein Ausgleich der Konzentrationen von Mineralstoffen und O2 zwischen Nähr- und Zehrschicht nicht möglich. Aufgabe 1: Verdeutlicht euch in der Gruppe die Verteilung von Mineralstoffen, Sauerstoff, Detritus und die Menge an Phytoplankton zum Ende des Winters mit Hilfe des ausgegeben Materials. Aufgabe 2: Stellt stichpunktartig dar, woraus die Veränderung zum vorher betrachten Zeitpunkt resultiert. Beachtet hierbei Faktoren wie Phytoplankton-Dichte, Mineralstoffkonzentrationen in Nähr- und Zehrschicht, die Menge an Detritus sowie Temperatur und Lichtverhältnisse in der Nährschicht. Aufgabe 3: Bereitet einen kurzen Vortrag über die Abläufe und Veränderungen im See während des Winters im Vergleich zur Situation Ende des Herbstes vor, um eure Mitschüler zu informieren. Ende des Winters Nährschicht Zehrschicht O2 Sauerstoff Phytoplankton D Mineralstoffe Detritus