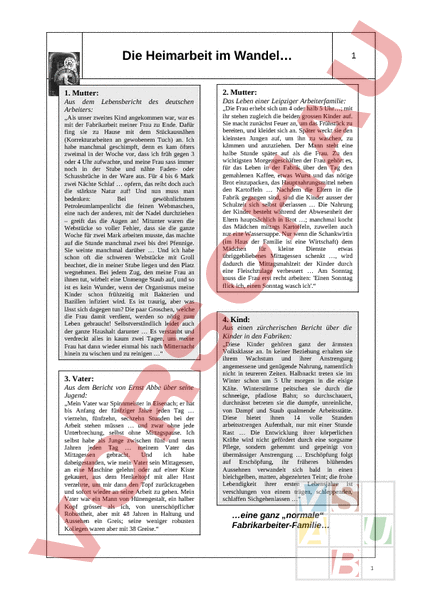Arbeitsblatt: Heimarbeit
Material-Details
Industrialisierung: Heimarbeit im Wandel
Geschichte
Neuzeit
8. Schuljahr
4 Seiten
Statistik
81979
987
9
26.05.2011
Autor/in
Marc Hefti
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Die Heimarbeit im Wandel 2. Mutter: 1. Mutter: Aus dem Arbeiters: 1 Lebensbericht des deutschen „Als unser zweites Kind angekommen war, war es mit der Fabrikarbeit meiner Frau zu Ende. Dafür fing sie zu Hause mit dem Stückausnähen (Korrekturarbeiten an gewobenem Tuch) an. Ich habe manchmal geschimpft, denn es kam öfters zweimal in der Woche vor, dass ich früh gegen 3 oder 4 Uhr aufwachte, und meine Frau sass immer noch in der Stube und nähte Faden- oder Schussbrüche in der Ware aus. Für 4 bis 6 Mark zwei Nächte Schlaf opfern, das reibt doch auch die stärkste Natur auf! Und nun muss man bedenken: Bei gewöhnlichstem Petroleumlampenlicht die feinen Webmaschen, eine nach der anderen, mit der Nadel durchziehen – greift das die Augen an! Mitunter waren die Webstücke so voller Fehler, dass sie die ganze Woche für zwei Mark arbeiten musste, das machte auf die Stunde manchmal zwei bis drei Pfennige. Sie weinte manchmal darüber Und ich habe schon oft die schweren Webstücke mit Groll beachtet, die in meiner Stube liegen und den Platz wegnehmen. Bei jedem Zug, den meine Frau an ihnen tut, wirbelt eine Unmenge Staub auf, und so ist es kein Wunder, wenn der Organismus meine Kinder schon frühzeitig mit Bakterien und Bazillen infiziert wird. Es ist traurig, aber was lässt sich dagegen tun? Die paar Groschen, welche die Frau damit verdient, werden so nötig zum Leben gebraucht! Selbstverständlich leidet auch der ganze Haushalt darunter Es verstaubt und verdreckt alles in kaum zwei Tagen, um meine Frau hat dann wieder einmal bis nach Mitternacht hinein zu wischen und zu reinigen 3. Vater: Aus dem Bericht von Ernst Abbe über seine Jugend: „Mein Vater war Spinnmeister in Eisenach; er hat bis Anfang der fünfziger Jahre jeden Tag vierzehn, fünfzehn, sechzehn Stunden bei der Arbeit stehen müssen und zwar ohne jede Unterbrechung, selbst ohne Mittagspause. Ich selbst habe als Junge zwischen fünf und neun Jahren jeden Tag meinem Vater das Mittagessen gebracht. Und ich habe dabeigestanden, wie mein Vater sein Mittagessen, an eine Maschine gelehnt oder auf einer Kiste gekauert, aus dem Henkeltopf mit aller Hast verzehrte, um mir dann den Topf zurückzugeben und sofort wieder an seine Arbeit zu gehen. Mein Vater war ein Mann von Hünengestalt, ein halber Kopf grösser als ich, von unerschöpflicher Robustheit, aber mit 48 Jahren in Haltung und Aussehen ein Greis; seine weniger robusten Kollegen waren aber mit 38 Greise. Das Leben einer Leipziger Arbeiterfamilie: „Die Frau erhebt sich um 4 oder halb 5 Uhr; mit ihr stehen zugleich die beiden grossen Kinder auf. Sie macht zunächst Feuer an, um das Frühstück zu bereiten, und kleidet sich an. Später weckt sie den kleinsten Jungen auf, um ihn zu waschen, zu kämmen und anzuziehen. Der Mann steht eine halbe Stunde später auf als die Frau. Zu den wichtigsten Morgengeschäften der Frau gehört es, für das Leben in der Fabrik über den Tag den gemahlenen Kaffee, etwas Wurst und das nötige Brot einzupacken, das Hauptnahrungsmittel neben den Kartoffeln Nachdem die Eltern in die Fabrik gegangen sind, sind die Kinder ausser der Schulzeit sich selbst überlassen Die Nahrung der Kinder besteht während der Abwesenheit der Eltern hauptsächlich in Brot ; manchmal kocht das Mädchen mittags Kartoffeln, zuweilen auch nur eine Wassersuppe. Nur wenn die Schankwirtin (im Haus der Familie ist eine Wirtschaft) dem Mädchen für kleine Dienste etwas übriggebliebenes Mittagessen schenkt , wird dadurch die Mittagsmahlzeit der Kinder durch eine Fleischzulage verbessert Am Sonntag muss die Frau erst recht arbeiten: Einen Sonntag flick ich, einen Sonntag wasch ich. 4. Kind: Aus einen zürcherischen Bericht über die Kinder in den Fabriken: „Diese Kinder gehören ganz der ärmsten Volksklasse an. In keiner Beziehung erhalten sie ihrem Wachstum und ihrer Anstrengung angemessene und genügende Nahrung, namentlich nicht in teureren Zeiten. Halbnackt treten sie im Winter schon um 5 Uhr morgen in die eisige Kälte. Winterstürme peitschen sie durch die schneeige, pfadlose Bahn; so durchschauert, durchnässt betreten sie die dumpfe, unreinliche, von Dampf und Staub qualmende Arbeitsstätte. Diese bietet ihnen 14 volle Stunden arbeitsstrengen Aufenthalt, nur mit einer Stunde Rast Die Entwicklung ihrer körperlichen Kräfte wird nicht gefördert durch eine sorgsame Pflege, sondern gehemmt und gepeinigt von übermässiger Anstrengung Erschöpfung folgt auf Erschöpfung, ihr früheres blühendes Aussehnen verwandelt sich bald in einen bleichgelben, matten, abgezehrten Teint; die frohe Lebendigkeit ihrer ersten Lebensjahre ist verschlungen von einem trägen, schleppenden, schlaffen Sichgehenlassen eine ganz „normale Fabrikarbeiter-Familie 1 Auftrag 1 (EA): Lies die zugeteilte Quelle durch. Fasse den Tagesablauf und die Sorgen der Person so in Stichworten zusammen, dass du darüber am „Familientisch berichten kannst! Montagehalle der Firma Escher-Wyss um 1875 Auftrag 2 (GA): Stellt euch gegenseitig eure Tagesabläufe vor. Was bemerkt ihr? Schreibt eure Erkenntnisse aus dem Austausch gemeinsam auf! 2 Auftrag 3 (EA): Betrachte die Karte und notiere dir Regionen mit Heimarbeit! Beschrifte auch die einzelnen Handelszentren (•) direkt in der Abbildung! Lies den folgenden Text und markiere dir das Wichtigste. Bearbeite anschliessend die untenstehenden Aufträge: Die Heimarbeit setzte sich vor allem in Gebieten durch, die für die Landwirtschaft nicht sehr günstig waren. In der Nähe musste eine Stadt mit Handelsbeziehungen zum Ausland sein, denn die Produkte der Heimarbeiter mussten ja irgendwohin verkauft werden. Neben der Schweiz kam die Heimarbeit vor allem in Teilen Deutschlands, Grossbritanniens und Frankreichs auf. Weitaus am verbreitetsten waren das Spinnen und das Weben von Flachs (Leinen), Baumwolle und Seide. Die Heimarbeiter bezogen von einem Unternehmen in der Stadt das Rohmaterial, verarbeiteten es und lieferten das Produkt wieder ab. Der Unternehmer bezahlte sie je nach der Menge und der Qualität ihrer Arbeit. Da die Bevölkerung zunahm, war der Bedarf an Stoffen für Kleider gross, so dass den Heimarbeitern die Arbeit im Allgemeinen nicht ausging. Die Bezahlung war jedoch niedrig, so dass eine Familie nur durchkam, wenn alle Angehörigen mitarbeiteten. Im Unterschied zu den Bauern besassen die Heimarbeiter kaum Vorräte oder Ersparnisse. Wenn die Lebensmittelpreise in die Höhe steigen, herrschte unter den Heimarbeitern sogleich grösste Not. Im Teuerungsjahr 1770/71 waren allein im Kanton Zürich 42�00 Menschen völlig mittellos, in ausgesprochenen Heimarbeiterdörfern oft über die Hälfte der Bevölkerung. In dieser Zeit verbreitete sich der Anbau von Kartoffeln. Diese waren billiger als Getreide und konnten zum Teil von den Heimarbeitern im eigenen Garten angepflanzt werden. Bald wurde die Kartoffel zum üblichen Brot des armen Mannes. Als Besonderheit entwickelte ich in der Westschweiz die Uhrenherstellung in Heimarbeit. Im 18. Jahrhundert stammten neunzig Prozent der Wanduhren und der Taschenuhren der Welt aus der Westschweiz. Im Kanton Neuenburg war jeder zehnte Einwohner ein Uhrmacher. Als Spezialisten hatten sie ein höheres Einkommen als die Spinner und die Weber in der deutschsprachigen Schweiz. 3 Wo war die Heimarbeit vor allem verbreitet? Zeichne in einem Schema die Organisation bzw. den Ablauf der Heimarbeit! Dieses Organisationsprinzip wird auch VERLAGSSYSTEM genannt. Webkeller im Appenzellerland (um 1840) Zusatz: Was für ein Wirtschaftszweig entwickelte sich speziell in der Westschweiz? Und wieso waren diese Heimarbeiter besser entlöhnt? Wie sieht die Situation heute aus? 4 5