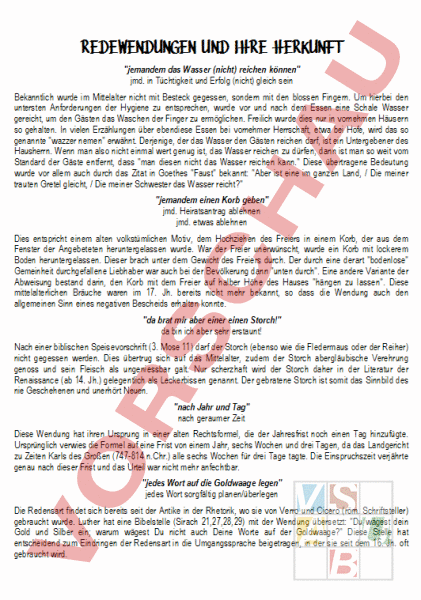Arbeitsblatt: Redewendungen
Material-Details
Hier ein paar bekannte Redewendungen und ihre Herkunft
Deutsch
Anderes Thema
5. Schuljahr
8 Seiten
Statistik
8273
1382
35
22.07.2007
Autor/in
Remo Di Monaco
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
REDEWENDUNGEN UND IHRE HERKUNFT jemandem das Wasser (nicht) reichen können jmd. in Tüchtigkeit und Erfolg (nicht) gleich sein Bekanntlich wurde im Mittelalter nicht mit Besteck gegessen, sondern mit den blossen Fingern. Um hierbei den untersten Anforderungen der Hygiene zu entsprechen, wurde vor und nach dem Essen eine Schale Wasser gereicht, um den Gästen das Waschen der Finger zu ermöglichen. Freilich wurde dies nur in vornehmen Häusern so gehalten. In vielen Erzählungen über ebendiese Essen bei vornehmer Herrschaft, etwa bei Hofe, wird das so genannte wazzer nemen erwähnt. Derjenige, der das Wasser den Gästen reichen darf, ist ein Untergebener des Hausherrn. Wenn man also nicht einmal wert genug ist, das Wasser reichen zu dürfen, dann ist man so weit vom Standard der Gäste entfernt, dass man diesen nicht das Wasser reichen kann. Diese übertragene Bedeutung wurde vor allem auch durch das Zitat in Goethes Faust bekannt: Aber ist eine im ganzen Land, Die meiner trauten Gretel gleicht, Die meiner Schwester das Wasser reicht? jemandem einen Korb geben jmd. Heiratsantrag ablehnen jmd. etwas ablehnen Dies entspricht einem alten volkstümlichen Motiv, dem Hochziehen des Freiers in einem Korb, der aus dem Fenster der Angebeteten heruntergelassen wurde. War der Freier unerwünscht, wurde ein Korb mit lockerem Boden heruntergelassen. Dieser brach unter dem Gewicht des Freiers durch. Der durch eine derart bodenlose Gemeinheit durchgefallene Liebhaber war auch bei der Bevölkerung dann unten durch. Eine andere Variante der Abweisung bestand darin, den Korb mit dem Freier auf halber Höhe des Hauses hängen zu lassen. Diese mittelalterlichen Bräuche waren im 17. Jh. bereits nicht mehr bekannt, so dass die Wendung auch den allgemeinen Sinn eines negativen Bescheids erhalten konnte. da brat mir aber einer einen Storch! da bin ich aber sehr erstaunt! Nach einer biblischen Speisevorschrift (3. Mose 11) darf der Storch (ebenso wie die Fledermaus oder der Reiher) nicht gegessen werden. Dies übertrug sich auf das Mittelalter, zudem der Storch abergläubische Verehrung genoss und sein Fleisch als ungeniessbar galt. Nur scherzhaft wird der Storch daher in der Literatur der Renaissance (ab 14. Jh.) gelegentlich als Leckerbissen genannt. Der gebratene Storch ist somit das Sinnbild des nie Geschehenen und unerhört Neuen. nach Jahr und Tag nach geraumer Zeit Diese Wendung hat ihren Ursprung in einer alten Rechtsformel, die der Jahresfrist noch einen Tag hinzufügte. Ursprünglich verwies die Formel auf eine Frist von einem Jahr, sechs Wochen und drei Tagen, da das Landgericht zu Zeiten Karls des Großen (747-814 n.Chr.) alle sechs Wochen für drei Tage tagte. Die Einspruchszeit verjährte genau nach dieser Frist und das Urteil war nicht mehr anfechtbar. jedes Wort auf die Goldwaage legen jedes Wort sorgfältig planen/überlegen Die Redensart findet sich bereits seit der Antike in der Rhetorik, wo sie von Verro und Cicero (röm. Schriftsteller) gebraucht wurde. Luther hat eine Bibelstelle (Sirach 21,27,28,29) mit der Wendung übersetzt: Du wägest dein Gold und Silber ein; warum wägest Du nicht auch Deine Worte auf der Goldwaage? Diese Stelle hat entscheidend zum Eindringen der Redensart in die Umgangssprache beigetragen, in der sie seit dem 16. Jh. oft gebraucht wird. jemanden matt setzen jmd. ungefährlich machen ausschalten Matt ist ein Ausdruck aus dem Schachspiel und geht auf den persischen Ausspruch schah mate (der König ist tot) zurück. Zusammen mit dem Spiel ist der Ausdruck im 12. Jh. in die romanischen Sprachen und in das Deutsche gekommen. Seit dem 13. Jh. existieren einige Bedeutungserweiterungen, die sich alle auf Erschöpfung des Geistes oder des Körpers beziehen. Im visuellen Bereich wird der Mangel an Glanz als matt bezeichnet. das Wort der Bissen bleibt jmd. im Halse stecken 1. verstummen vor Schreck 2. vor Schreck nicht mehr weiteressen Im altgermanischen Recht gab es ein Gottesurteil, das darin bestand, dass dem Verurteilten ein trockener Bissen in den Mund gelegt wurde, den er schlucken musste. Blieb der Bissen im Hals stecken, dann war der Angeklagte schuldig. Gottesurteile dieser Art sind bis ins 14. Jh. hinein belegt. das Zeitliche segnen sterben Das Zeitliche und die Zeitlichkeit sind schon sehr alte Begriffe für die vergängliche Welt. Von ihr nimmt der Sterbende Abschied, indem er Gottes Segen für sich herbeiwünscht. Der letzte Wunsch eines Sterbenden wird für sehr wirkungsvoll gehalten, und so ist der Segen, den er ausspricht, das Beste, was er für seine Hinterbliebenen und die Welt tun kann. Einige dafür früher verwendete Segenssprüche sind noch erhalten, wie der folgende, der aus dem 17. Jh. überliefert ist: Nun sieht mich kein Mensch nimmermehr, Gott gesegn euch alle, wo ihr seyt! Gott gesegn mit alle Wollustbarkeit! Gott gesegn mein Herren und Gemahl! Gott gesegn euch, Berg und Tal! in den sauren Apfel beissen müssen etwas Unangenehmes tun müssen Die erste Erwähnung dieser Wendung beziehungsweise dieses Bildes findet sich bei Luther, aber man kann davon ausgehen, dass es sich hierbei um eine wesentlich ältere Redewendung handelt. Katz und Maus spielen mit jemandem jmd. im Unklaren lassen Dies bezieht sich auf das Spiel der Katze mit der Maus. Die Katze ist natürlich viel stärker, aber trotzdem lässt sie ihr Opfer, die Maus, noch scheinbar entkommen, um sie schliesslich doch zu töten. Auch Luther verwendet eine verwandte Wendung: Der Katze Spiel ist der Mäuse Tod. mit Engelszungen reden eindringlich und betörend reden In der Bibelübersetzung Luthers heisst es im ersten Korintherbrief (13, 1): Wenn ich mit Menschen und Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönend Erz oder eine klingende Schelle. Übrigens: der „Sachsenspiegel, der im Zusammenhang mit einigen Redewendungen erwähnt wird, ist das älteste und bedeutendste deutsche Rechtsbuch. Es wurde in den zwanziger Jahren des 13. Jh. geschrieben. mit Haut und Haar ganz und gar Es handelt sich wie bei vielen anderen Stabreimen um eine sehr alte Wendung. Sie ist zum ersten Mal im „Sachsenspiegel belegt und wurde dort als juristische Formel verwendet. Im Sachsenspiegel wurde die Formel auch als Synonym für „Leben verwendet. es ist hohe höchste Zeit wir müssen uns sehr beeilen Die Wendung verwendet das Bild eines räumlichen Extrempunktes (im Sinne von Gipfel), um damit eine „Anhäufung bereits verstrichener Zeit zu versinnbildlichen. Da aber das Adjektiv „hoch auch eine Wertung im Rang eines Vorgangs oder einer Person ausdrückt, unterschied man im Mittelalter vier „hohe Zeiten im Jahr: Weihnachten, Ostern, Pfingsten und Allerheiligen. Erst im 15. Jh. ist der Begriff „Hochzeit Hohe Zeit im Sinne von Vermählung entstanden. einer Sache ein Mäntelchen umhängen etwas Negatives als harmlos/einwandfrei darstellen Der Mantel als Symbol des Verhüllenden und Beschützenden hat sich auch in der alten Rechtsauffassung niedergeschlagen. Nach den Rechtsvorschriften des Sachsenspiegels konnten uneheliche Kinder nachträglich dadurch legitimiert werden, dass sie während der Trauung unter dem Mantel der Braut getragen wurden. Sie wurden dadurch den ehelichen Kindern völlig gleichgestellt. unter Zähneklappern 1. zittern vor Angst 2. zittern vor Kälte Die Übersetzung „Zähneklappern für „Furcht wurde von Luther verwendet, als er schrieb: „In der Hölle wird Heulen und Zähneklappern sein (Matth. 8, 12). Heute findet man in den Übersetzungen das weniger passende „Zähneknirschen, das eigentlich die Bedeutung „Unwilligkeit hat. ein notwendiges Übel eine unvermeidbare negative Sache Angelegenheit Die Wendung ist seit der Antike belegt und bezieht sich meist auf die Frau oder das Heiraten. Schon der griechische Komödiendichter Menander (342 – 293 v. Chr.) schrieb: „Heiraten ist, wenn man es bei Licht besieht, ein Übel, aber ein notwendiges Übel. Auch bei Luther finden wir die Bemerkung: „Ein Weib sei ein nötiges Übel und kein Haus ohne solch Übel., die unter anderem von Lessing aufgegriffen wurde. Fersengeld geben fliehen, davonrennen Fersengeld ist seit dem 13. Jh. belegt und wird gelegentlich mit dem alten Wort „Färse in Verbindung gebracht (Färse junge Kuh). Der Sachsenspiegel kennt „versen penninge als Abgabe bei der Ehescheidung. Im allgemeineren Sinn ist die Wendung seit dem Mittelalter bekannt. etwas nicht aus dem Boden stampfen können etwas nicht schaffen können Das feste Aufstampfen ist ein uralter magischer Brauch, der noch heute bei magischen Ritualen üblich ist. Die dabei angeblich bestehende Möglichkeit, Dinge herbeizaubern zu können, hat schon in der Antike zu Redensarten wie der obigen geführt (vgl.: Plutarch, Pompeius, Kap. 57). das Heft in der Hand haben die Macht haben, die Leitung haben Das Heft war ursprünglich die Halterung oder der Griff eines Gerätes. Im engeren Sinne bezeichnet es den Griff eines Schwertes, woraus sich allgemein ein Begriff für Gewalt und Macht im Sinne der Redensart durchsetzte. Über den Aspekt der Halterung bildete sich im 18. Jh. die heute gebräuchlichste Bedeutung des Wortes eine Anzahl gebundener Papierbögen aus, die mit der Redensart nichts mehr zu tun hat. Moos haben Geld haben, reich sein Moos für Geld geht auf das hebräische Wort für Münze (maoth) zurück. Ursprünglich wurde es nur im Rotwelsch, einer Gaunersprache ab dem 13. Jh., verwendet. Erst später wurde es dann in die Studentensprache übernommen. etwas aus dem Stegreif sprechen vortragen dichten unvorbereitet sein, etwas spontan machen Steg-reif, nicht Steh-greif, ist die ältere Bezeichnung für den Steigbügel und bedeutet eigentlich Reif/Ring zum besteigen des Pferdes. Die Redensart bezieht sich auf den eiligen Reiter, der schnell etwas erledigt oder zu sich nimmt, ohne abzusteigen. Die Stegreifdichtung war seit der Antike verbreitet und auch in der Skalden- und Spielmannsepik (Skaldenepik altnordische Dichtkunst) gepflegt worden. Besonders in Volksdichtung wurden Spielformen bevorzugt, in denen der Schauspieler den Text seiner eigenen oder der Stimmung des Publikums entsprechend variieren konnte. Die allmählich als Verwilderung der Theatersitten empfundene Stegreifdichtung wurde durch die Theaterreform Gottscheds im 18. Jh. abgeschafft und in Österreich aus Gründen der Zensur 1752 sogar verboten. Die freie Improvisation als Kunstform ist seither mehr oder weniger auf das Kasperltheater und das Kabarett beschränkt. Auch die Stegreifrede, eine alte rhetorische Kunst, wird nicht mehr gelehrt, sondern den mehr oder weniger ausgeprägten rhetorischen Begabungen des Einzelnen überlassen. einen Zahn zulegen etwas schneller tun In den Burgküchen hingen die großen Töpfe an gezackten, einem Sägeblatt ähnliche Eisenschienen, mit denen man die Höhe der Töpfe über dem Feuer regulieren konnte. Wenn man also früher einen Zahn zulegte, hieß das, den Topf näher ans Feuer hängen, um die Speisen schneller zu garen. etwas auf die Hohe Kante legen Geld sparen Die wohlhabenden Burgbewohner hatten meist ein Bett mit einem Himmel, also einem Dach aus Stoff. Dieser Himmel sollte eigentlich verhindern, daß herabfallendes Ungeziefer im Bett landet, doch dieses Dach wurde auch als Ablage für die Wertsachen vor dem Schlafengehen genutzt. jemanden in die Schranken weisen jmd. zurecht weisen Als Schranke wurde im Mittelalter bei Turnieren die Bahn bezeichnet, in der ein Ritter beim Lanzengestech zu reiten hatte. Die einzelnen Bahnen wurden durch eine Absperrung voneinander getrennt, um einen Zusammenstoß der Pferde zu verhindern. Wenn ein Ritter in die Schranken gewiesen wurde, so hat man ihm lediglich seine Kampfbahn zugeteilt, die er aber unter keinen Umständen verlassen durfte. Sobald heute jemand seine Bahn verläßt, d. h. sich daneben benimmt, so wird er von anderen in die Schranken gewiesen. sich verzetteln seine Kräfte gleichzeitig zu vielen Dingen widmen und deshalb nicht vorankommen Im Althochdeutschen bedeutete zetten so viel wie ausbreiten, verstreuen. Daraus entstand verzetteln im Sinne von nutzlos ausbreiten. Zette(l)n war auch ein Fachwort aus der Weberei, so daß sich das heute verwendete anzetteln erklären läßt als: beginnen, ein Gewebe zu weben. Beide Verben haben also nichts mit dem Zettel zu tun, den wir verwenden, um darauf Notizen zu machen. Dieses Wort kommt vielmehr von dem mittellateinischen cedula. Es gelangte als Zeddel Anfang des 14. Jh. ins Deutsche und ist daher weit jünger als die Wurzel von verzetteln. Glück haben ein unerwartetes günstiges Ereignis erleben Das erst seit dem 12. Jh. nachweisbare Wort Glück hängt über Lücke und Loch mit der Idee des offenen Ausgangs zusammen. Über die neutralen Elemente Schicksal und Zufall hat es sich erst später zur heutigen Dominanz eines günstigen Ausgangs verdichtet. Neben dem Zufall sind dann auch der persönliche Erfolg, die Fähigkeit, das Können getreten, so daß jemand, der sein Glück macht, persönlich verantwortenden Erfolg verbuchen kann. platzen vor Neid außerordentlich neidisch sein Diese Redensart war schon in der Antike gebräuchlich und geht zurück auf eine Fabel des Phaedrus (röm. Fabeldichter, 1. Jh. n. Chr., freigelassener Sklave), in welcher sich der eitle Frosch mit dem Ochsen messen will. Dazu bläst er sich auf, bis er platzt. jemanden auf frischer Tat ertappen jemanden bei einem verbotenen Tun ertappen Das von tun abgeleitete Substantiv Tat beschreibt alles das, was wirklich geschieht. Tat steht damit im Gegensatz zu Wort, Wille, Vorsatz oder Rat. Frisch bedeutet im Sinne dieser Redensart neu, gerade erst geschehen oder in einem Bild: noch brennend, analog zu dem lateinischen Lehnausdruck in flagranti (von flagrantia Glut). Die Wendung ist bereits im 12. Jh. belegt, wobei übrigens zunächst der Ehebruch gemeint war. die Katze im Sack kaufen etwas kaufen, ohne es gesehen zu haben Bereits im Volksbuch Till Eulenspiegel (soll um 1300-1350 n. Chr. gelebt haben) wird der Schwank erzählt, daß die Katze im Sack, als angeblicher Hase, gekauft wurde. Da die Schwänke des Till Eulenspiegel ihre Pointe meistens aus der wortwörtlichen Befolgung von Redensarten beziehen, muß diese Wendung bereits wesentlich älter sein. sich Asche auf Haupt streuen etwas bereuen Im frühesten Altertum gab es den Brauch, sich in Trauerzeiten die Asche der verstorbenen Verwandten auf Kopf und Gewänder zu streuen, im so seiner Trauer entsprechenden Ausdruck zu verleihen. Diese Tradition hat sich im heutigen Aschenkreuz erhalten, jenes Kreuz, das der Priester in der römisch-katholischen Kirche an Aschermittwoch austeilt. Aber schon im Buch Hiob (Altes Testament) wird die Wendung als Ausdruck für Reue zeigen verwendet. von Tuten und Blasen keine Ahnung haben nicht das Geringste von etwas verstehen Tuten und Blasen waren die Hauptaufgaben des Nachtwächters, eine der untersten Berufsgruppen im Mittelalter. Wer nicht einmal für diese Aufgaben befähigt war, mußte besonders dumm sein. Die Redensart ist seit dem 16. Jh. belegt, aber wohl wesentlich älter. wo drückt der Schuh?(umgangssprachlich) welchen Kummer hast du? Das redensartliche Bild wird schon im Altertum gebraucht. Plutarch (griech. Philosoph, 1. Jh. n. Chr.) erzählt in seiner Beschreibung des Lebens von Paulus Aemilius, daß dieser von seinen Freunden vorwurfsvoll gefragt worden sei, warum er sich von seiner schönen und treuen Frau habe scheiden lassen. Aemilius antwortete, indem er auf seinen neuen Schuh zeigte, mit den Worten: „Auch dieser Schuh ist schön und neu, aber niemand sieht, wo er mich drückt. Perlen vor die Säue werfen(umgangssprachlich) wertvolle Dinge an Menschen verschwenden, die sie nicht zu schätzen wissen Diese Redewendung ist biblischen Ursprungs und geht auf Matthäus 7,6 zurück: „Ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben, und eure Perlen nicht vor die Säue werfen. die Fahne nach dem Wind drehen wankelmütig in seinen Entscheidungen sein Vorläufer der seit dem 16. Jh. belegten Wendung ist die Redensart den Mantel nach dem Winde kehren. Sie taucht bereits in der mittelalterlichen Spruchsammlung auf, die unter dem Namen Spervogels überliefert ist (um 1200): man sol den Mantel keren als das weter gat. In Gottfrieds Tristan und Isolde (um 1210) heißt es ganz ähnlich: Man sol den mantel kehren als die winde sint gewant. jemand die Hölle heiß machen jemand streng ermahnen, zur Arbeit anhalten, jemand zusetzen Die Hölle wird als Ort des Feuers beschrieben, wo Pech und Schwefel brennen. Auch die Hitze, Flammen und die Glut sind sprichwörtlich weit verbreitet. Schon bei Luther findet sich der Ausdruck jemand die Hölle heiß machen, allerdings mit einem starken theologischen Bezug. Erst Goethe verwendet dann die Wendung in der Bedeutung von Bedrängung. Stein und Bein schwören besonders nachdrücklich schwören Die Wendung ist seit dem frühen 16. Jh. belegt, und zwar bei Hans Sachs. Sie ist vielfach auf alte Rechtsbräuche zurückgeführt worden. So soll der Stein, den man beim Schwur berührt, einem heidnischen heiligen Stein und später dem Altarstein entsprechen, Bein (Gebein) den Reliquien eines Heiligen. Letzteres ist seit dem 6. Jh. im Lex Allemannorum und auch im Parzival (um 1200) belegt. Die Kombination von Stein und Bein beim Schwur hätte dann durch die Berücksichtigung heidnischer und christlicher Schwurbräuche eine verdoppelnde Intensivierung bedeutet. Diese Deutung ist aber wegen des späten Erscheinens der Redewendung und durch das Fehlen der Präposition (bei oder auf Stein und Bein schwören, ähnlich wie in der Formel beim Barte des Propheten) umstritten. Stein und Bein tauchen nämlich schon weit früher formelhaft verbunden auf, etwa in der ersten Hälfte des 13. Jh. bei dem schwäbischen Dichter Freidank: Die Zunge hat kein Bein und bricht doch Stein und Bein. Diese Wendung tadelt die böse Zunge und geht auf ein lateinisches Vorbild zurück (osse caret lingua, secat os tamen ipsa maligna). Stein und Bein stammen also wahrscheinlich nicht aus dem Bereich des Rechtswesens, sondern sind als Sinnbilder der Härte und Bruchfestigkeit allgemein zur Verstärkung einer Aussage oder eines sprachlichen Bildes genutzt worden. mit jemand deutsch reden jemand klar und offen die Meinung sagen Diese Redensart ist seit dem 15. Jh. bekannt und verwendet das Wort deutsch noch in seiner ursprünglichen Bedeutung, nämlich verständlich oder besser volkstümlich. Damit war zur Zeit Karls des Großen bereits eine Abgrenzung gegenüber den romanischen Sprachen, besonders aber gegenüber dem Lateinischen verknüpft. Dies gilt auch für das späte Mittelalter und die frühe Neuzeit, in der Latein als Gelehrtensprache weitergelebt hat und dem Volk unverständlich war. Diese Abgrenzung lebt auch in den Ausdrücken Angler- und Jägerlatein weiter. vor jemand den Hut ziehen große Achtung vor jemand haben Das Abnehmen des Hutes ist seit dem 13. Jh. als Grußgebärde gelegt. Damals war es eine Rangfrage, wer vor wem den Hut zog. Heutzutage ist es eine reine Grußformalität, die nicht mehr auf die Rangunterschiede verweist. jemand gewogen sein jemandem Freund sein Die Waage ist das Sinnbild für gerechten Ausgleich und die Unparteilichkeit. Wenn sich diese Waage, bildlich gesprochen, auf die Seite einer Person neigt, dann bedeutet dies, daß diese Person zusätzliche positive Aspekte in die Waagschale werfen kann. Eine andere Deutung der Wendung geht in die Richtung, daß man sich vorstellt, gefühlsmäßig ausgeglichen zu sein, das heißt nicht für die eine oder die andere Person auszuschlagen. Dieses übermittelte Bild der charakterlichen und moralischen Bewertung ist uralt. Man kann es auch schon im Alten Testament, in Menetekel finden Buch Daniel 5, 25 – 27): Eine geheimnisvolle Hand hatte an die Wand des Palastes des Königs Belsazar die Worte Mene Tekel geschrieben. Keiner der Weisen des Königs konnte diese deuten, bis auf Daniel. Seine Deutung war: Mene, das ist: Gott hat dein Reich gezählt und vollendet, Tekel, das ist: man hat dich in einer Waage gewogen und zu leicht gefunden. in den Wind reden sprechen jmd. versuchen zu überreden, aber ohne Erfolg Diese Wendung ist eine alte rhetorische und poetische Formel, die schon bei Ovid (röm. Dichter, 43 v. Chr. 18 n. Chr.) und Lukrez (röm. Dichter, 97 v. Chr. 55 n. Chr.) zu finden ist. Luther hat die antike Formel wieder entdeckt und sie verwendet, um eine Stelle des ersten Korintherbriefes zu übersetzen. Dadurch wurde die Formel auch wieder populär. Überhaupt hat die Wendung in den Wind dieselbe Bedeutung wie ein Schlag ins Wasser, nämlich die Sinn- und Nutzlosigkeit. das Gras wachsen hören sehr sensibel sein gut informiert sein Die Redensart ist seit dem 15. Jh. nachweisbar und wird seit einiger Zeit abschätzig auf überkluge Personen bezogen. Der Aspekt der Weisheit und der Informiertheit taucht erst Mitte des 17. Jh. auf. wie Pech und Schwefel zusammenhalten in einer Meinung unzertrennlich sein, zusammenhalten Pech und Schwefel stellen eine Verbindung dar, die besonders lange und intensiv brennt. Vor allem in der Bibelsprache und in mittelalterlichen Vorstellungen von der Hölle spielen die beiden Stoffe daher eine große Rolle. etwas an die große Glocke hängen eine vertrauliche Information öffentlich verbreiten, eine Sache aufbauschen Die Glocke rief im Mittelalter zu Gerichtsversammlungen. Dort wurden private Fehden dann öffentlich ausgetragen und gelegentlich auch aufgebauscht. Wer die große Glocke läutet, wusste um diese Konsequenz und nahm sie in Kauf. Berge versetzen fast Unmögliches erreichen Die Wendung tritt in vielen Bibelstellen zu Tage und bezieht sich stets darauf, dass man mit Glauben Berge versetzen kann (Matth. 17, 20; Mark. 11, 23). Im deutschen Sprachraum wurde die Wendung erst durch Luthers Bibelübersetzung bekannt. aus einer Mücke einen Elefanten machen etwas sehr stark übertreiben, etwas aufbauschen Diese Wendung stammt bereits aus der griechischen Antike und wurde im Anschluss daran von Erasmus von Rotterdam (um 1466 1536) latinisiert. Das rhetorisch-stilistische Mittel, das der Wendung zugrunde liegt, ist der extreme Kontrast. etwas an den Tag bringen offen legen, bekannt machen, enthüllen Das Unbekannte wird immer mit dem im Dunkeln Liegenden verglichen bzw. dargestellt, wo hingegen das Bekannte als das am Licht (des Tages, der Sonne) Befindliche gesehen wird. Bekannt ist vor allem die Variante die Sonne bringt es an den Tag, die als Kehrreim in einem Gedicht von Adalbert von Chamisso (1781 1838) wiederkehrt: Ein Meister Nikolas wird durch die Strahlen der Sonne an ein Verbrechen erinnert, das er einst beging. Er beichtet die Tat seiner neugierigen Frau, die das Geheimnis aber preisgibt. Das Gedicht endet mit den Strophen: Die Raben ziehen krächzend zumal nach dem Hochgericht, zu halten ihr Mahl. Wen flechten sie auf das Rad zur Stund? Was hat er getan? Wie ward es kund? Die Sonne bracht es an den Tag. Das vermittelte Bild ist aber wesentlich älter und schon in der Bibel (Lukas 12, 3) und anderen antiken Aussprüchen angelegt.