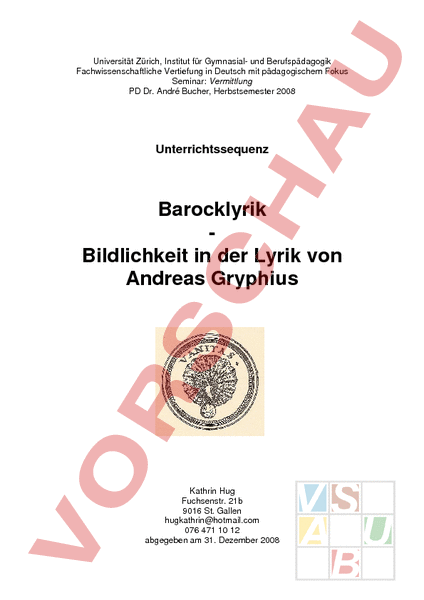Arbeitsblatt: Bildlichkeit in der Barocklyrik von Gryphius
Material-Details
Es handelt sich um eine ausgearbeitete Unterrichtssequenz zur Barocklyrik von Andreas Gyphius mit Arbeitsblättern und Erläuterungen.
Deutsch
Leseförderung / Literatur
11. Schuljahr
27 Seiten
Statistik
82734
2100
23
10.06.2011
Autor/in
Kathrin Hug
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Universität Zürich, Institut für Gymnasial- und Berufspädagogik Fachwissenschaftliche Vertiefung in Deutsch mit pädagogischem Fokus Seminar: Vermittlung PD Dr. André Bucher, Herbstsemester 2008 Unterrichtssequenz Barocklyrik Bildlichkeit in der Lyrik von Andreas Gryphius Kathrin Hug Fuchsenstr. 21b 9016 St. Gallen 076 471 10 12 abgegeben am 31. Dezember 2008 Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung 2 2. Barocklyrik – Bildlichkeit in der Lyrik von Andreas Gryphius . 3 2.1. Lernvoraussetzungen und Lernziele 3 2.1.1. Kompetenzanalyse . 4 2.2. Unterrichtssequenz 6 2.2.1. Einstiegsaufgabe – Vanitas, Memento mori, Carpe diem 6 2.2.2. Instruktionsphase – Einführung Metapher, Allegorie, Emblem 9 2.2.3. Hausaufgabe – Biografie: Andreas Gryphius 13 2.2.4. Kooperative Lernphase – Gedichtinterpretationen 13 2.2.5. Abschlussdiskussion – Sinn und Zweck der Bildlichkeit . 15 3. Schlusswort . 16 Literaturverzeichnis . 17 Anhang: Arbeitsblätter . 18 -1- 1. Einleitung Die Literatur des Barocks eröffnet Ausblicke auf ein turbulentes Jahrhundert. Der 30-jährige Krieg, der Absolutismus, die Pest, die Inquisition, die beginnende Säkularisierung und die neuen technischen Innovationen prägen die Texte dieser Zeit. Ihre Inhalte geben den Blick frei auf Kriegsgreuel, Friedenssehnsucht, fürstlichen Glanz und Bauernelend, die sich in Gegensätzen wie Lieben und Hassen, Glauben und Zweifeln, Leben und Sterben, etc. widerspiegeln. In der vorliegenden Arbeit beschäftige ich mich mit der barocken Lyrik von Andreas Gryphius, in der Momentaufnahmen dieser Zeit wiedergegeben werden. Die Schüler und Schülerinnen sollen sich intensiv mit ausgewählten Gedichten auseinandersetzen. Im Vordergrund steht der Aspekt der Bildlichkeit. In einem ersten Schritt werden in dieser Arbeit die Lernvoraussetzungen und Lernziele dargelegt und eine Kompetenzanalyse erarbeitet. In einem zweiten Schritt wird die Unterrichtssequenz erläutert. Sie gliedert sich in fünf Teile: In der Einstiegsaufgabe befassen sich die Lernenden mit dem Vanitas-, Memento mori- und Carpe diem-Begriff. In der Instruktionsphase wird von der Lehrperson eine Einführung in die Metapher, die Allegorie und das Emblem gegeben. Als Hausaufgabe beschäftigen sich die Lernenden mit der Biografie von Gryphius und in der darauffolgenden kooperativen Lernphase setzen sie sich mit den ausgewählten Gedichten auseinander. Die abschliessende Diskussion soll Sinn und Zweck der Bildlichkeit deutlich machen. Die Arbeit wird durch ein Schlusswort abgerundet. -2- 2. Barocklyrik – Bildlichkeit in der Lyrik von Andreas Gryphius 2.1. Lernvoraussetzungen und Lernziele Die Unterrichtssequenz ist für eine 5. Klasse eines Langzeitgymnasiums konzipiert (11. Schuljahr). Je nach Lehrplan der jeweiligen Schulen kann die Sequenz auch bereits schon im 9. oder 10. Schuljahr durchgeführt werden. Vorausgesetzt wird, dass die Schüler und Schülerinnen bereits in die Lyrik eingeführt wurden, so dass sie mit der Metrik und den Reimschemata vertraut sind. Zudem wissen die Lernenden, wie bei einer Gedichtinterpretation vorgegangen wird. Eine weitere Lernvoraussetzung ist die grobe Kenntnis des historischen Hintergrundes der Epoche des Barocks. Auf Seite 19 bis 201 findet sich ein Auftrag zum Dreissigjährigen Krieg, der – falls keine Vorkenntnisse vorhanden sind – vor dem Beginn der Unterrichtssequenz durchgeführt werden kann. In der vorliegenden Unterrichtssequenz geht es darum, dass die Lernenden sich mit der Barocklyrik von Andreas Gryphius intensiv auseinandersetzen und die Stilfiguren der Bildlichkeit, die Gryphius benutzt, kennenlernen. Im Folgenden sind die Lernziele einzeln aufgelistet: Lernziele: Barocklyrik von Gryphius kennen lernen: Form • Sonett • Versmass des Alexandriners Thematik • Vanitas-Motiv • Barocke Lebenssicht: Memento mori – Carpe diem Stilfiguren der Bildlichkeit • 1 Bild Die Seitenzahlen beziehen sich auf die jeweiligen Arbeitsblätter im Anhang dieser Arbeit. -3- • Symbol • Vergleich • Metapher • Allegorie • Personifikation Strukturprinzipien • Antithetik • Steigerung • häufig emblematische Struktur Ziel der Unterrichtssequenz ist einerseits deutlich zu machen, dass in der Barocklyrik die Bildlichkeit eines der hervorstechendsten Merkmale ist und andererseits aufzuzeigen, welchen Sinn und Zweck diese Bildlichkeit hatte. 2.1.1. Kompetenzanalyse Im Folgenden werden die Aspekte der Kompetenz für diese Unterrichtssequenz aufgelistet: Kognitive Kompetenzen Lesen Vorstellungsvermögen Denken in Zusammenhängen Sich auf ein Betrachtung sprachlicher Bilder einlassen Abstraktionsvermögen Barocklyrik von Gryphius kennen lernen und erkennen, dass die Bildlichkeit darin eine wichtige Rolle spielt (siehe Lernziele unter 2.1.) Motivationale Kompetenzen Motivation fördern, in dem sie auf bereits vorhandenes Wissen zurückgreifen können (z.B. Gedichtinterpretation, Reimschema/Metrik, etc.) -4- Ethische Kompetenzen Die Orientierungskraft sprachlicher Bilder erkennen Reflexion darüber, welchen Stellenwert die Vergänglichkeit in der heutigen Gesellschaft hat (Tabu?, etc.) Soziale Kompetenzen Zusammenarbeit an den Gedichten in der Gruppe Gemeinsame Diskussion über die Gedichte Sich in die Perspektive und in die Bildwelt anderer Menschen einer anderen Epoche hineinversetzen -5- 2.2. Unterrichtssequenz Bevor die einzelnen Lernphasen der Unterrichtssequenz vorgestellt werden, möchte ich einen groben Zeitplan aufstellen, der etwa 6-8 Lektionen umfasst (je nach dem, in welcher Form die Ergebnissicherung der kooperativen Lernphase erfolgt): Zeitrahmen Einstiegsaufgabe 30-40 Minuten Instruktionsphase 1 Lektion Hausaufgabe ca. 30 Minuten 3 Lektionen Kooperative Lernphase evtl. noch zusätzliche Zeit für die Präsentationen der Gruppen einplanen Abschlussdiskussion 20-30 Minuten 2.2.1. Einstiegsaufgabe – Vanitas, Memento mori, Carpe diem In der Einstiegsaufgabe sollen „Vanitas-Symbole in der Kunst besprochen werden. Die Lernenden bearbeiten die Aufträge auf dem Arbeitsblatt ( S. 21). Anschliessend werden die Ergebnisse im Plenum besprochen. Bild 1: Vanitas von Harmen Steenwijck, um 1640. Bild 2: All is Vanity von Charles Allan Gilbert, 1892. -6- Bild 1: Vanitas-Symbole In Zeiten von grassierenden Pestseuchen, Kriegsgräueln und bombastischer Pracht- und Machtentfaltung war die Vergänglichkeit auch in der Kunst ein zentrales Thema. Vanitas-Symbole sollen, meist in moralisierender Absicht, an die Vergänglichkeit des Lebens und der irdischen Güter erinnern. Zu den Vanitas-Symbolen gehören auch Gegenstände, die heute eher als Zeichen der selbstzufriedenen und sinnvollen Betätigung oder der Geselligkeit gesehen werden wie Bücher, Sammelobjekte oder Spiele. Sie führen nach damaliger Auffassung zu Melancholie. Sehr beliebt waren Vanitas-Stillleben, Arrangements scheinbar beliebiger Gegenstände, die alle symbolisch mit dem Begriff Vanitas verknüpft sind. Diese Symbole waren den zeitgenössischen Betrachtern geläufig. Leere Formen Totenschädel: So wie das Bild nur noch eine Form des einst Lebendigen darstellt, ist der Schädel nur noch eine Form des lebendigen Kopfs. Er zeigt, dass Schönheit vergänglich ist und versinnbildlicht am deutlichsten die Vergänglichkeit unserer Existenz. Muschel: Überbleibsel einst lebendiger Tiere, die für den Tod und die Vergänglichkeit stehen. Luxusgüter Ein ambivalentes Symbol sind Luxusgüter. Luxus ist ein Zeichen für das Auserwähltsein, jedoch ist der gedankenlose Genuss von Luxus und das Streben nach Reichtum sündhaft. Mit Hilfe der Vanitas-Symbole konnte der Reichtum einerseits stolz vorgezeigt werden, andererseits konnte er als etwas Vergängliches und Nichtiges heruntergespielt werden. Glasbehälter: stellt die Zerbrechlichkeit dar, zudem steht ein leeres Glas für den Tod. Schwert: erinnert mit seiner Schärfe und Gefährlichkeit an die Verletzlichkeit der Menschen. Pflanzen Blumen/Zweige: stehen für Vitalität und Lebenskraft. Blühendes Gezweig ist jedoch zum Verwelken verurteilt. Schnittblumen sind dem Tod ge- -7- weiht. Um den Aspekt der Vergänglichkeit zu betonen, werden oft schon angewelkte Blumen/Zweige dargestellt. Haushaltsgeräte Kerze: Die brennende Kerze ist ein Sinnbild für Materie und Geist, die Flamme steht für die menschliche Seele, ihr Verlöschen für den Tod. Oft wird der Rauch der verloschenen Kerze dargestellt. Krug: er kann das Laster der Trunksucht symbolisieren. Ebenso kann er ein Sinnbild der Jungfräulichkeit sein. Zeitvertreib Musikinstrument (Flöte): Musik galt als einzigartig und unwiederholbar. Instrumente sind ein Zeichen für den fehlenden Menschen. Der Klang ist vergänglich. Tabakpfeife: ist ein Symbol für den momentanen flüchtigen Genuss Wissenschaft/Bücher: Irdisches Wissen und Streben ist vergänglich Bild 2: Das zweite Bild stammt aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert und soll zeigen, dass die Thematik auch damals noch aktuell war. Es stellt eine Allegorie auf die Vergänglichkeit der Eitelkeit und Schönheit dar. In Bild 1 und 2 wird die Gegenüberstellung von Leben und Tod deutlich: Auf der einen Seite waren die Menschen lebenshungrig, andererseits war der Tod eine ständige Bedrohung. Barocke Lebenssicht: Memento mori – Carpe diem Anschliessend sollen folgende Fragen im Plenum diskutiert werden: Gibt es moderne Symbole der Vergänglichkeit? Wie wird heute mit diesem Thema umgegangen? Der damalige Betrachter war es gewohnt, symbolisch zu denken und nach Doppeldeutigkeiten und Sinnzusammenhängen zu forschen. Wie ist das heute? Zeitschrift „Vanity Fair („Jahrmarkt der Eitelkeit)? Plastische Chirurgie? Tabu? -8- 2.2.2. Instruktionsphase – Einführung: Metapher, Allegorie, Emblem In der folgenden Sequenz, in der die Lehrperson Wissen vermittelt, geht es um eine Einführung in die Metapher, die Allegorie und das Emblem und deren Abgrenzungen. Zunächst wird das ausgeteilte Arbeitsblatt ( S. 22) von der Lehrperson erläutert und eventuell ergänzt. Danach wird das Gedicht Menschliches Elende von Gryphius ( S. 24) gemeinsam besprochen. Die Metapher, die Allegorie und das Emblem können so am Gedicht festgemacht werden. Ergänzungen zur Metapher: Das „eigentliche Wort wird also durch ein „fremdes ersetzt. Zwischen dem eigentlichen und dem fremden Wort besteht Ähnlichkeit oder Analogie (z.B. Text: die Bedeutung des Wortes Text war ursprünglich eine metaphorische: lat. textus bedeutet Gewebe, Geflecht2 oder z.B. Abend des Lebens für das Alter, da sich das Alter zum Leben wie der Abend zum Tag verhält). Die Metapher kann auch eine lexikalische Leerstelle ausfüllen, wie zum Beispiel „Tischbein, Wolkenkratzer. Diese lexikalisierten Metaphern werden jedoch wie ein normales Wort behandelt und verschwinden als Metaphern. Die Metapher „stellt etwas vor Augen. Deswegen wird die Metapher auch ein „sprachliches Bild genannt: „Ein Bild hielt uns gefangen, Und heraus konnten wir nicht, denn es lang in unserer Sprache. (Wittgenstein) Bauprinzip einer Metapher: Eine Metapher kann beispielsweise bestimmte Eigenschaften einer Person, eines Gegenstandes oder eines Abstraktums durch einen bildlichen Ausdruck, z.B. „er ist ein Fuchs ( listiger Mensch). Von einem Bildspender (der als listig geltender Fuchs aus den Fabeln) wird eine Eigenschaft auf einen Bildempfänger (Menschen) übertragen, hier die Schläue. Bildspender: Fuchs in der Fabel Bildempfänger: Mensch „Er ist ein Fuchs. 2 Vgl. Kurz, Metapher, Allegorie, Symbol, S. 28. -9- Suggerierte Gemeinsamkeit: Schläue Listigkeit Metapher im Gedicht Menschliches Elende: Auftrag an die Lernenden: Notiere dir auffällige Figuren der Bildlichkeit aus dem ersten Quartett und bestimme nach folgendem Schema Bildspender- und Bildempfängerbereiche. Fasse die Ergebnisse anschliessend kurz zusammen. Beispiel: Bildspenderbereich „Wohnhaus grimmer Schmertzen Haus: Wohnung, Lebensalltag „Ball des falschen Glücks Bildvorstellung der Glücksgöttin Fortuna, die auf einer Kugel balanciert „Irrlicht diser Zeit Unheimliche Naturerscheinungen, die im Volksglauben Menschen vom rechten Wege weglockt „Schauplatz herber Angst Theater: Vorstellung der Welt und des Lebens als Trauerspiel Bildempfänger Menschliche Empfindung, Gefühl Menschliches Schicksal, Glück, Unglück Gegenwärtige Welt- und Lebenserfahrung Menschliche Empfindung Bildspender sind vorwiegend konkret-anschauliche Dinge, Bildempfänger sind hier menschliche Wahrnehmungen und Gefühle, abstrakte Begriffe. Wirkung: Gefühle oder Wahrnehmungen wie Angst und Schmerzen, Glück oder Unglück gewinnen eine vorstellbare Gestalt. Sie werden greifbarer, verständlicher. Ergänzungen zur Allegorie: Allegorie kann eine erweiterte Metapher sein. In der Lyrik ist dann das Gedicht zweigeteilt: Der eine Teil schildert meist die Welt, die Landschaft und der zweite Teil deutet den ersten allegorisch. Es wird von einer Naturschilderung zu einem geistlichen Thema übergegangen, so dass die Eingangsschilderung eine allegorische Bedeutung erhält. 10 Da wo Gryphius von der Welt, z.B. von der Natur zu sprechen scheint, geht es um ihre heilsgeschichtliche Bedeutung und um das Seelenheil des einzelnen. So sind die Tageszeiten-Sonette keine Natur- oder Landschaftsgedichte, sondern die Betrachtung der Dinge dieser Welt lenkt die Gedanken auf den Menschen und seine heilsgeschichtliche Bestimmung. Die Naturgegenstände und -elemente haben verweisenden Charakter, sind „Sinnenbilder, deren Bedeutung häufig in der Tradition der christlich-allegorischen Naturauslegung zu suchen ist. Ergänzungen zum Emblem: Nachdem die Definition des Emblems auf dem Arbeitsblatt besprochen wurde, wird den Lernenden das Arbeitsblatt auf Seite 23 ausgeteilt oder als Folie aufgelegt und erläutert: 1. Emblem: Im Bild ist eine Frau dargestellt, deren Körper durch den Sturm, der aus einer von ihr geöffneten Schale hervorbricht, vom Gewand entblößt wird. Sie steht auf einem Buch als Sinnbild der Wissenschaft und des Studiums. Daneben liegen Ähren und Früchte als Zeichen des Wohlstands. Der Delphin und das nackte Kind illustrieren für sich genommen den deutschen Vers „ich überwind Venus und dazu ihr kind. Die Inscriptio und Subscriptio erläutern die Pictura: Es kommt nicht auf die äussere Schönheit darauf an, sondern es zählen auch innere Werte. 2. Emblem: Das Bild des Frosches, der im Frühling wieder zu neuem Leben erwacht wird in der Subscriptio in einen geistlichen Zusammenhang gestellt und erläutert. Es geht um die Auferstehung des Menschen. Das Emblem als Kunstform ist eine humanistisch-gelehrte Erfindung des 16. Jahrhunderts. Die mittelalterliche Symbolik ist wichtig für die Emblematik: Quellen sind der Physiologus, Schriften der Kirchenväter, etc. Firmenlogos, Signets und auch viele Wappen enthalten oft Sinnbilder mit emblematischem Charakter. 11 Die Abfolge von Überschrift, Bild und deutenden Schlussversen kehrt im Typ des allegorisch-auslegenden Gedichts wieder. Gedicht Menschliches Elende (Titel: Inscriptio, V. 1-4: Pictura, V. 5-14: Subscriptio) Anschliessend wird beim Gedicht Menschliches Elende auch auf die bisher nicht besprochenen Aspekte eingegangen: Form des Gedichts Sonett • 2 Quartette, 2 Terzette, häufig Zäsur nach Quartetten, Alexandriner Versmass des Alexandriners • 6-hebiger Jambus mit einer Zäsur nach der dritten Hebung Thematik: Kernfrage der Vanitas-Dichtung „Was sind wir Menschen doch V. 1 Nichtigkeit, Eitelkeit Nichtigkeit und Bedeutungslosigkeit des Lebens Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft Stilfiguren (Metapher bereits oben besprochen) Personifikation des Lebens: V. 5 viele Vergleiche z.B. Leben/Traum: V. 9 Strukturprinzipien (emblematische Struktur bereits oben besprochen) Steigerung Antithetik • Schein-Sein • Ewigkeit-Zeit • Spiel-Ernst • Diesseits-Jenseits • 12 2.2.3. Hausaufgabe – Biografie: Andreas Gryphius Auftrag an die Lernenden: Informiert euch über den Dichter Andreas Gryphius und stellt eine Visitenkarte mit seinen Lebensdaten, Vorbildern und Ansichten zusammen! Vielleicht findet ihr ja auch ein Passfoto? 2.2.4. Kooperative Lernphase – Gedichtinterpretationen Die Lernenden werden in sechs Gruppen (3-4 Pers./Gruppe) eingeteilt. Alle Gruppen erhalten den Auftrag, eine ausführliche schriftliche Gedichtinterpretation zu den Gedichten An die Welt, An die Sternen und zu den Tageszeitsonetten Morgen, Mittag, Abend, Mitternacht ( S. 24f.) zu machen. Dabei sollen sie nach dem bereits bekannten Interpretationsschema ( S. 26) vorgehen und ihr Augenmerk speziell auf die Bildlichkeit richten. Zudem wird den Schülern und Schülerinnen eine Tabelle ausgeteilt ( S. 27), wo sie alle Metaphern eintragen können. Gegen Ende der Gruppenarbeit wird jeder Gruppe ein Gedicht zugeteilt, deren ausführliche schriftliche Gedichtinterpretation der Lehrperson abgegeben wird. Die Lehrperson kontrolliert diese und stellt sie nachher – falls vorhanden – auf die Lernplattform der Klasse (z.B. Educanet), wo die Lernenden zur eigenen Kontrolle darauf zurückgreifen können, wobei betont werden muss, dass es nicht nur eine „richtige Interpretation gibt. Eine Alternative für die Ergebnissicherung wäre, dass die Gruppen die Interpretation des ihnen zugeteilten Gedichts mit Hilfe einer Folie oder Powerpoint vorstellen und die anderen Gruppen am Schluss ergänzen können. Die Tabelle mit den Metaphern auf dem Arbeitsblatt wird am Schluss dieser Lernphase gemeinsam besprochen. Auf der folgenden Seite wird eine Auflistung der Metaphern, die in den ausgewählten Gedichten vorkommen, gegeben. 13 Metaphern bei Gryphius Natur Licht Gott, göttliche Kraft Sterne haben die Aufgabe auf der Erde als Hinweise auf den Himmel zu dienen, Zeichen der Ewigkeit und der Realität Gottes, Wächter des Himmels Sonne Quelle des Lichts, Zeichen der Hoffnung und Existenz Gottes, Sinnbild Gottes, Reinigung der Seele, ihr täglicher Kreislauf weist zudem auf die Auferstehung hin Sonnenlauf Leben dieser Welt Naturgewalten: Wind, Flut, Blitze, Stürme Krieg, äussere Einflüsse des Lebens, die der Mensch nicht beeinflussen kann, Schicksal, Lebensnot Tageszeiten Schifffahrt Tageszeiten Sinnbild der menschlichen Lebensalter, Leben dieser Welt Meer sturmbewegtes Meer Welt, gegenwärtiges Leben Morgen Das Morgenlicht verweist auf den Tag des Jüngsten Gerichts, an dem Gott ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen war. Der Morgen stellt auch die Güte Gottes und die Ordnung der Natur dar Seefahrt Leben Mittag Alles ist dem Licht der Sonne ausgesetzt, so stehen wir Menschen unverborgen vor dem richtenden Gott, dem Licht, das, wo immer wir sind, uns sieht. Diese Auslegung gründet sich auf die Eigenschaft des Lichtes, alles sichtbar zu machen. Der Mittag bezeichnet die Höhe des Lebens. Abend Sinnbild der Endlichkeit, weist auf den Tod und das Lebensende hin, Alter und Abschluss Nacht Nacht und Dunkelheit widerspiegeln wegen dem Fehlen des Lichts alles Gottferne, wie Sündigkeit, Gnadenlosigkeit, Unerlöstheit. Das Jüngste Gericht naht. Wechsel von Tag und Nacht Stellung des Menschen zwischen Sünde und Gnade 14 Schiff wird auf dem Meer hin und her geschaukelt Leben des Menschen in der Welt, das immer von Gefahren umgeben ist (in der christl. Allegorese Sinnbild der Kirche Noah) Segel Lebensantrieb Hafen/Ufer Ewigkeit, Jenseits, Paradies 2.2.5. Abschlussdiskussion Sinn und Zweck der Bildlichkeit Zum Abschluss dieser Unterrichtssequenz wird eine Plenumsdiskussion über die Rolle der Metapher in der Lyrik von Andreas Gryphius geführt. Bilder und Vergleiche sind notwendig, um die Welt in ihren Erscheinungsformen und Zusammenhängen durchschaubarer zu machen. Bildliche Veranschaulichung fördere das Verständnis. Die Gegenreformation forderte die weltlichen Schriftsteller dazu auf, ihre Dichtung wieder in geistliche Zusammenhänge zu stellen. Der barocke Schriftsteller versucht – in dem er die Metapher benutzt – Unbekanntes durch Bekanntes zu erläutern. Das 17. Jahrhundert kann ein emblematisches oder allegorisches Jahrhundert heissen, da überall, wo im eigentlichen wie im übertragenen Sinne bildlich gesprochen wird, von einem riesigen Fundus fest vorgeprägter Bilder ausgegangen wird. Und zwar im geistlichen wie im täglichen Leben, im privaten und im öffentlichen. Emblematik ist wie eine zweite Sprache die gelernt werden kann, und die damals beherrscht wurde. Die Lehrperson kann im Verlaufe oder am Schluss der Diskussion hinzufügen, dass, wie Martin Opitz es in seinem „Buch der Deutschen Poeterey betont, die Dichtung im Barock ein erzieherisches Anliegen hatte. Dichtung war nicht zur Unterhaltung da, sondern war Menschenbildung schlechthin. Sie verfeinert die Umgangsformen, bildet Geist und Seele und bestimmt das Handeln des Menschen von klein auf. Je nach Zeit, die zur Verfügung steht, würde es sich hier allenfalls anbieten, mit den Schülern und Schülerinnen eine Poetik des Barocks anzuschauen und auf dieses „Maschinerie einzugehen und sie selber aufgrund dieses Materials Sonette verfassen zu lassen. Auch ein Vergleich mit modernen Sonetten, die thematisch von den barocken Sonetten abweichen, wäre spannend. 15 3. Schlusswort Diese Unterrichtssequenz ist ein Vorschlag, oder besser gesagt, ein Entwurf, da ich diese Thematik in dieser Form bisher im Unterricht noch nicht besprochen habe, es aber in naher Zukunft sicher machen werde. Deswegen weiss ich auch nicht, wie die Schüler und Schülerinnen auf die barocke Schreibweise der Texte reagieren werden, beziehungsweise ob sie Verständnisschwierigkeiten haben werden oder nicht und welche Probleme auftauchen könnten. Als weiteres Vorgehen würde es sich im Anschluss an diese Unterrichtssequenz anbieten, einen Roman (z.B. Simplicissimus von Grimmelshausen) oder ein barockes Theaterstück zu lesen und zu besprechen. 16 Literaturverzeichnis Primärliteratur: Gryphius, Andreas: Gedichte. Eine Auswahl. Hrsg. v. Elschenbroich, Adalbert. Stuttgart 1996 ( Reclam 8799). Sekundärliteratur: Bieder, Gertrud: Natur und Landschaft in der deutschen Barocklyrik (Dissertation Zürich). Mulhouse 1927. Fricke, Gerhard: Die Bildlichkeit in der Dichtung des Andreas Gryphius. Materialien und Studien zum Formproblem des deutschen Literaturbarock. Darmstadt 1967 ( Neue Forschung 17). Herzog, Urs: Deutsche Barocklyrik: Eine Einführung. München 1979. Jentzsch, Peter (Hrsg.): Arbeitstexte für den Unterricht: Gedichte des Barock: Mit einer Einführung in die Interpretation (für die Sekundarstufe II). Stuttgart 1993 ( Reclam 15027). Jöns, Dietrich W.: Das „Sinnen-Bild. Studien zur allegorischen Bildlichkeit bei A.G. Stuttgart 1966 ( Germanistische Abhandlungen 13). Kurz, Gerhard: Metapher, Allegorie, Symbol. Vandenhoeck/Ruprecht 1988 ( Kleine Vandenhoeck-Reihe 1486). Meid, Volker: Barocklyrik. Stuttgart 2008 ( Sammlung Metzler 227). Niefanger, Dirk: Barock. Stuttgart/Weimar 2000 ( Lehrbuch Germanstik). Reich-Ranicki, Marcel (Hrsg.): 1400 Deutsche Gedichte und ihre Interpretationen. Von Walther von der Vogelweide bis Matthias Claudius (Bd. 1). Frankfurt am Main 2002. Szyrocki, Marian: Die deutsche Literatur des Barock. Eine Einführung. Stuttgart 1994 ( Reclam 9924). Tenkhoff, Hubert: Barocke Weltmetaphorik am Beispiel von A. Gryphius und H.J.Ch. von Grimmelshausen. Münster 1998 ( Germanstik 12). Trunz, Erich: Weltbild und Dichtung im deutschen Barock. Sechs Studien. München 1992. Weimar, Klaus: Vom barocken Sinn der Metapher. In: MLN (Vol. 105, No. 3, 1990), S. 453-471. 17 Anhang: Arbeitsblätter 18 Martin Opitz Auszug aus: Trostgedichte in Widerwertigkeit des Kriegs 1 10 20 30 40 50 60 Die grosse Sonne hat mit ihren schönen Pferden Gemessen drey mal nun den weiten Kreiß der Erden, Seyt daß der strenge Mars in unser Teutschland kam, Und dieser schwere Krig den ersten Anfang nam. Ich wil den harten Fall, den wir seyther empfunden Und männiglich gefühlt (wiewol man frische Wunden Nicht viel betasten sol) durch keinen blauen Dunst Und Nebel überziehn, wie der Beredten Kunst Zwar sonsten mit sich bringt. Wir haben viel erlitten, Mit andern und mit uns selbst unter uns gestritten. Mein Haar das steigt empor, mein Hertze zittert mir, Nem ich mir diese Zeit in meinen Sinnen für. Das edle teutsche Land, mit unerschöpfften Gaben Von Gott und der Natur auff Erden hoch erhaben, Dem niemand vor der Zeit an Krieges-Thaten gleich, Und das viel Jahre her an Friedens-Künsten reich In voller Blüte stund, ward und ist auch noch heute Sein Widerbart selbselbst und frembder Völcker Beute. Ist noch ein Ort, dahin der Krieg nicht kommen sey, So ist er dennoch nicht gewesen Furchte frey. Das Land hat grausamlich von Reuterey erklungen, Der übergrossen Last zuweichen fast getrungen. Kein Vorgebürge hat sich weit genug erstreckt, Kein weiter Wald die Zahl deß Heeres gantz bedeckt. Waß hilfft es, daß jetzund die Wiesen grüne werden Und daß der weisse Stier entdeckt die Schoß der Erden Mit seiner Hörner Krafft, daß aller Platz der Welt Wie neugeboren wird? Das Feld steht ohne Feld, Der Acker fraget nun nach keinem grossen Bauen, Mit Leichen zugesät; er fragt nach keinem Tauen, Nach keinem Düngen nicht. Was sonst der Regen thut, Wird jetzt genug gethan durch faistes Menschenblut. Wo Tityrus vorhin im Schatten pflag zu singen, Und ließ von Galathee Wald, Thal und Berg erklingen, Wo vor das süsse Lied der schönen Nachtigall, Wo aller Vögel Thon biß in die Lufft erschall, Ach, ach, da hört man jetzt die grausamen Posaunen, Den Donner und den Plitz der feurigen Carthaunen, Das wilde Feldgeschrey; wo vormals Laub unnd Graß Das Land umberönet hat, da ligt ein faules Aaß. Der arme Bauersmann hat alles lassen ligen, Wie, wann die Taube sieht den Habicht auff sich fliegen, Und gibet Fersengelt; er selbst ist in das Land, Sein Gut ist fort geraubt, sein Hof hinweg gebrandt, Sein Vieh hindurch gebracht, die Scheuren umbgeschmissen, Der edle Rebenstock tyrannisch außgerissen, Die Bäume stehn nicht mehr, die Gärten sind verheert; Die Sichel und der Pflug sind jetzt ein scharffes Schwert. Und dieses ist das Dorff. Wer aber wil doch sagen Der Stätte schwere Noth, den Jammer, Weh und Klagen, So männiglich geführt, das unerhörte Leid, Deß Feindes Uebermuth und harte Grausamkeit? Das alte Mauerwerck ist worden auffgesetzet, Die Thore starck verwahrt, die Degen scharff gewetzet, Die Waffen außgebutzt, die Wälle gantz gemacht, Die Pässe weit umbher verhauen und bewacht. Ein jeder ist verzagt. Eh, als der Feind noch kommen, Da hat die Furchte schon viel Oerter eingenommen Und Oberhand gehabt. Mir schüttert Haar und Haut, Wann daß ich dencken wil, was ich nur angeschaut. 19 Das Volck ist hin und her geflohn mit hellem Hauffen, Die Töchter sind bey Nacht auff Berge zugelauffen, Schon halb für Schrecken tod, die Mutter hat die Zeit, In der sie einen Mann erkant, vermaledeyt. Die Männer haben selbst erbärmlich müssen flehen, Wann sie ihr liebes Weib und Kinder angesehen. Die kleinen Kinderlein, gelegen an der Brust, So noch von keinem Krieg und Kriegesmacht gewust, Sind durch der Mutter Leyd auch worden angereget 70 Und haben allesampt durch ihr Geschrey beweget; Der Mann hat seine Frau beweynt, die Frau den Mann, Und was ich weiter nicht auß Wehmuth sagen kan. Viel minder werd ich nun deß Feindes harte Sinnen Und grosse Tyranney genug beschreiben können, Dergleichen nie gehört. Wie manche schöne Statt, Die sonst das gantze Land durch Pracht gezieret hat, Ist jetzund Asch unnd Staub? Die Mauren sind verheeret, Die Kirchen hingelegt, die Häuser umbgekehret. Wie wann ein starcker Fluß, der unvorsehens kömpt, 80 Die frische Saate stürtzt, die Aecker mit sich nimpt, Die Wälder niderreißt, läufft ausser seinen Wegen, So hat man auch den Plitz und schwefelichte Regen Durch der Geschütze Schlund mit grimmiger Gewalt, Daß alles Land umbher erzittert und erschallt, Gesehen mit der Lufft hin in die Stätte fliegen; Deß Rauches Wolcken sind den Wolcken gleich gestiegen, Der Feuerflocken See hat alles überdeckt Und auch den wilden Feind im Lager selbst erschreckt. Das harte Pflaster hat geglüet und gehitzet, 90 Die Thürne selbst gewanckt, das Ertz darauff geschwitzet; Viel Menschen, die der Schaar der Kugeln sind entrannt, Sind mitten in die Glut gerathen und verbrannt, Sind durch den Dampff erstickt, verfallen durch die Wände; Was übrig blieben ist, ist kommen in die Hände Der ärgsten Wüterey, so, seyt die Welt erbaut Von Gott gestanden ist, die Sonne hat geschaut. Der Alten graues Haar, der jungen Leute Weynen, Das Klagen, Ach und Weh der Grossen und der Kleinen, Das Schreyen in gemein von Reich und Arm geführt 100 Hat diese Bestien im minsten nicht gerührt. Hier halff kein Adel nicht, hier ward kein Stand geachtet, Sie musten alle fort, sie wurden hingeschlachtet, Wie wann ein grimmer Wolff, der in den Schaffstall reißt, Ohn allen Unterscheyd die Lämmer nider beißt. Der Mann hat müssen sehn sein Ehebette schwächen, Der Töchter Ehrenblüth in seinen Augen brechen, Und sie, wann die Begier nicht weiter ist entbrandt, Unmenschlich untergehn durch ihres Schänders Hand. Die Schwester ward entleibt in ihres Bruders Armen, 110 Herr, Diener, Frau und Magd erwürget ohn Erbarmen, Ja, die auch nicht geborn, die wurden umbgebracht, Die Kinder, so umbringt gelegen mit der Nacht In ihrer Mutter Schoß; ehe sie zum Leben kommen, Da hat man ihnen schon das Leben hingenommen: Viel sind, auch Weib und Kind, von Felsen abgestürtzt Und haben ihnen selbst die schwere Zeit verkürtzt, Dem Feinde zu entgehn. Was darff ich aber sagen, Was die für Hertzenleyd, so noch gelebt, ertragen? Ihr Heyden reicht nicht zu mit eurer Grausamkeit, 120 Was ihr noch nicht gethan, das thut die Christenheit. Aufträge 1. Welches Bild von Deutschland entsteht bei dir während der Lektüre des Gedichtes? 2. Informiere dich über den Dreißigjährigen Krieg! Liste die wesentlichen Geschehnisse stichwortartig auf! 3. Versuche das Gedicht von Opitz nach den Anfangsversen (Vers 1-3) zu datieren! 4. Liste die Schrecken des Krieges auf, die benannt werden (Verszeilen angeben)! 20 1. Beschreibe in Stichworten deine Eindrücke beim Betrachten dieser beiden Bilder! 2. Was ist deiner Meinung nach das Thema der Bilder? 3. Finde einen Titel! Vanitas von Harmen Steenwijck, um 1640 All is Vanity von Charles Allan Gilbert, 1892 21 Definitionen: Metapher, Allegorie, Emblem Metapher Seit der Antike gehört die Metapher zu den wichtigsten rhetorischen Figuren. Die Metapher (griech. Übertragung) wurde in der Tradition der antiken Rhetorik wie folgt definiert: „Ein jeder Begriff (res) hat ein Wort (verbum), das ihm eigen (proprium) ist. Ein Wort zu trennen von dem Begriff, dem es eignet, und es einem anderen zuzutragen, ist die Operation 3 „Metapher (translatio). Quintilian beschreibt die Metapher als Prozess folgendermassen: „Metapher ist die Übertragung eines Nomens oder Verbs von einem Ort, an dem es ein eigenes ist, auf einen, an dem entweder ein eigenes fehlt oder das übertragene besser ist als das (vor4 handene) eigene. Allegorie Die Allegorie stellt einen Wortlaut dar, der entweder einen anderen oder gar den entgegen gesetzten Sinn (Ironie) hat. Die Allegorie ist also ein Text mit zwei Bedeutungen. Sie sagt etwas direkt und etwas anderes indirekt. Diese beiden Bedeutungen werden als wörtliche und als 5 allegorische Bedeutung bezeichnet. Der Begriff „wörtliche Bedeutung meint die Bedeutung, die ohne weiteres Nachdenken verstanden wird. Vergleich Metapher-Allegorie Der Allegorie kann natürlich eine Metapher zugrunde liegen. Ein allegorischer Text erlaubt zugleich zwei Deutungen. Die erste Bedeutung geht normalerweise der zweiten zeitlich voraus. Beide Bedeutungszusammenhänge bleiben aber voneinander abhebbar. Das heisst, bei der Allegorie geschieht ein Bedeutungssprung, da die Beziehung zwischen dem Bild und der Bedeutung willkürlich gewählt ist, währenddem bei der Metapher eine Bedeutungsverschmelzung stattfindet. Die Allegorie ist zweideutig und bei der Metapher findet eine „Übertragung statt. Zudem gibt es noch ein weiteres Differenzierungsmerkmal: Damit überhaupt zwei Bedeutungszusammenhänge entstehen können, muss die Allegorie einen ganzen Text oder Rede oder zumindest einen Teil eines Textes ausmachen, währendem die Metapher einzeln auftreten 6 kann. Emblem Das Emblem besteht aus drei Elementen: 1. Das Motto (Inscriptio) Überschrift (oft in lateinischer Sprache) 2. Das Bild (Pictura) Das Gemeinte wird bildlich vorgeführt (ein Bild mit einer Darstellung aus der Natur, aus dem menschlichen Leben, aus der Bibel, aus der Geschichte oder der Mythologie) 3. Der Text (Subscriptio) Darin wird in Gedichtform erklärt und verrätselt, was im Einzelnen gemeint ist. Hinter der Verrätselung steht der Gedanke, dass das Weltgeschehen voller Rätsel sei, nach deren verborgenen Sinnbezügen der Mensch suchen müsse. Die Entschlüsselung von Emblemen galt auch als beliebte Denksportaufgabe. Inscriptio und Subscriptio haben die Funktion, das Bild auszulegen, seinen Sinn offenzulegen. 3 Weimar, Vom barocken Sinn der Metapher, S. 453. Quintilian, Inst.or. 8,6,5, zitiert nach: Weimar, Vom barocken Sinn der Metapher, S. 453. Vgl. Kurz, Metapher, Allegorie, Symbol, S. 31f. 6 Vgl. Kurz, Metapher, Allegorie, Symbol, S. 33. 4 5 22 Embleme von Mathias Holtzwart Es ligt nit allein am aussern ansehenn. Mitt meiner schönheit ich überwind Venus und dazu ihr kind Die liechten sternen auch dabey Aller Götter gaaben ich frey Auch hab. Wer aber recht ansicht Was hie auß meiner büchsen fleücht Dem wirt meine schönheit nitt gfallen lang Würt schawen das er von mir gang Drumb urteil nitt nahm gsicht die sach Schaw vor was weitters kom hernach. Aufferstehung des Fleysches Gleich wie eyn Frosch zu Winters zeit Unter der Erd verborgen liegt 1 Gantz tod verwesen aller ab Als ob er nie gelebet hab Im Früling aber wiederumm Gantz frisch und neu herfürher kumpt 2 Schwimmt mit fräuden inn Wasserqual Also wir Menschen allzumal Versterben und werden begraben: Als ob wir alles vollführet haben. Wann dich aber würt Gott der Herr Wider erwecken von der Erd Werden wir durch die Wolcken tringen Gantz frölich Gott dem Schöpffer singen Ja wann wir gelebt hand hie auff Erden Dass uns solch freud zu theyl mag werden. 1 2 tief unten (ganz weit weg) aufhören zu leben Quelle 23 Barocklyrik von Andreas Gryphius Menschliches Elende. 1 WAs sind wir Menschen doch? ein Wohnhaus grimmer Schmertzen Ein Ball des falschen Glücks ein Irrlicht diser Zeit. Ein Schauplatz herber Angst besetzt mit scharffem Leid Ein bald verschmeltzter Schnee und abgebrante Kertzen. 5 Diss Leben fleucht davon wie ein Geschwätz und Schertzen. Die vor uns abgelegt des schwachen Leibes Kleid Und in das Todten-Buch der großen Sterblichkeit Längst eingeschriben sind sind uns aus Sinn und Hertzen. Gleich wie ein eitel Traum leicht aus der Acht hinfällt 10 Und wie ein Strom verscheust den keine Macht auffhält: So muss auch unser Nahm Lob Ehr und Ruhm verschwinden Was itzund Athem holt muss mit der Luft entflihn Was nach uns kommen wird wird uns ins Grab nachzihn. Was sag ich? wir vergehn wie Rauch von starcken Winden. An die Welt. 1 MEin offt bestürmbtes Schiff der grimmen Winde Spil Der frechen Wellen Baal das schir die Flutt getrennet Das über Klip auff Klip und Schaum und Sandt gerennet. Komt vor der Zeit an Port den meine Seele wil. 5 Offt wenn uns schwartze Nacht im Mittag überfil Hat der geschwinde Plitz die Segel schir verbrennet! Wie offt hab ich den Wind und Nord und Sud verkennet! Wie schadhafft ist Spriet Mast Steur Ruder Schwerdt und Kill. Steig aus du müder Geist steig aus! wir sind am Lande! 10 Was graut dir für dem Port itzt wirst du aller Bande Und Angst und herber Pein und schwerer Schmertzen loß. Ade verfluchte Welt: du See voll rauer Stürme! Glück zu mein Vaterland das stette Ruh im Schirme Und Schutz und Friden hält du ewig-lichtes Schloß! An die Sternen. IHr Lichter die ich nicht auff Erden satt kan schauen Ihr Fackeln die ihr Nacht und schwartze Wolcken trennt Als Diamante spilt und ohn Auffhören brennt; Ihr Blumen die ihr schmückt des grossen Himmels Auen: 5 Ihr Wächter die als Gott die Welt auff-wolte-bauen; Sein Wort die Weissheit selbst mit rechten Namen nennt Die Gott allein recht misst die Gott allein recht kennt (Wir blinden Sterblichen! was wollen wir uns trauen!) Ihr Bürgen meiner Lust wie manche schöne Nacht 10 Hab ich in dem ich euch betrachtete gewacht? Herolden diser Zeit wenn wird es doch geschehen Dass ich der euer nicht allhir vergessen kan Euch derer Libe mir steckt Hertz und Geister an Von andern Sorgen frey werd unter mir besehen? 1 24 Tageszeitsonette Morgen Sonnet. 1 DIe ewig-helle Schaar wil nun ihr Licht verschlissen Diane steht erblaßt; die Morgenrötte lacht Den grauen Himmel an der sanffte Wind erwacht Und reitzt das Federvolck den neuen Tag zu grüßen. 5 Das Leben diser Welt eilt schon die Welt zu küssen Und steckt sein Haupt empor man siht der Stralen Pracht Nun blinckern auff der See: dreymal höchste Macht Erleuchte den der sich itzt beugt vor deinen Füssen! Vertreib die dicke Nacht die meine Seel umbgibt 10 Die Schmertzen Finsternüß die Hertz und Geist betrübt/ Erquicke mein Gemütt und stärcke mein Vertrauen. Gib daß ich disen Tag in deinem Dinst allein Zubring: und wenn mein End und jener Tag bricht ein Daß ich dich meine Sonn mein Licht mög ewig schauen. Mittag. 1 AUff Freunde! last uns zu der Taffel eylen In dem die Sonn ins Himmels Mittel hält Und der von Hitz und Arbeit matten Welt Sucht ihren Weg und unsern Tag zu theilen. 5 Der Blumen Zir wird von den flammen Pfeylen Zu hart versehrt das außgedörte Feld Wündscht nach dem Tau der Schnitter nach dem Zelt; Kein Vogel klagt von seinen Libes Seilen. Itzt herrscht das Licht. Der schwartze Schatten fleucht 10 In eine Höl in welche sich verkreucht Den Schand und Furcht sich zu verbergen zwinget. Man kan dem Glantz des Tages ja entgehn! Doch nicht dem Licht das wo wir immer stehn Uns siht und richt und Hell und Grufft durchdringet. Abend. 1 DEr schnelle Tag ist hin die Nacht schwingt ihre Fahn Und führt die Sterne auff. Der Menschen müde Scharen Verlassen Feld und Werck wo Thir und Vögel waren Traurt itzt die Einsamkeit. Wie ist die Zeit verthan! 5 Der Port naht mehr und mehr sich zu der Glider Kahn. Gleich wie diß Licht verfil so wird in wenig Jahren Ich du und was man hat und was man siht hinfahren. Diß Leben kömmt mir vor als eine Renne-Bahn. Laß höchster Gott mich doch nicht auff dem Lauffplatz gleiten 10 Laß mich nicht Ach nicht Pracht nicht Lust nicht Angst verleiten! Dein ewig-heller Glantz sey vor und neben mir Laß wenn der müde Leib entschläfft die Seele wachen Und wenn der letzte Tag wird mit mir Abend machen So reiß mich aus dem Thal der Finsternüß zu dir! Mitternacht. 1 SChrecken und Stille und dunckeles Grausen finstere Kälte bedeckt das Land Itzt schläfft was Arbeit und Schmertzen ermüdet diß sind der traurigen Einsamkeit Stunden. Nunmehr ist was durch die Lüffte sich reget nunmehr sind Menschen und Thire verschwunden. Ob zwar die immerdar schimmernde Lichter der ewig schitternden Sternen entbrant! 5 Suchet ein fleissiger Sinn noch zu wachen? der durch Bemühung der künstlichen Hand Ihm die auch nach uns ankommende Seelen Ihm die an itzt sich hir finden verbunden? Wetzet ein bluttiger Mörder die Klinge? wil er unschuldiger Hertzen verwunden? Sorget ein Ehren-begehrend Gemütte wie zu erlangen ein höherer Stand? Sterbliche! Sterbliche! lasset diß dichten! Morgen! Ach Morgen! Ach muß man hinzihn! 10 Ach wir verschwinden gleich als die Gespenste die umb die Stund uns erscheinen und flihn. Wenn uns die finstere Gruben bedecket wird was wir wündschen und suchen zu nichte. Doch wie der gläntzende Morgen eröffnet was weder Monde noch Fackel bescheint: So wenn der plötzliche Tag wird anbrechen wird was geredet gewürcket gemeynt. Sonder vermänteln eröffnet sich finden vor des erschrecklichen GOttes Gerichte. 25 Gedichtinterpretation 1. Zeit/Raum Historischer Hintergrund? Tages-/Jahreszeitlich situiert? Gibt es einen Zeitbezug oder fehlt er gänzlich? Geographisch lokalisiert? 2. Sprache/Stil Welche Wortart dominiert? Satzbau? Wortwiederholungen? Ungewöhnliche/alte Wörter? Sprachliche Bilder (Metaphern, Allegorien, Vergleiche, Personifikationen, )? Struktur (Gegensätze, Steigerungen, )? Personifikationen? Enjambements? Zeilenstil? 3. Aufbau/Form (Gliederung, Reimschema, Versmass) Wie viele Strophen? Wie ist das Gedicht aufgebaut? Welches Reimschema? Versmass (Jambus, Trochäus, etc.)? Männlicher oder weiblicher Ausgang (Kadenz)? 4. Perspektive Wer spricht? Explizites oder verstecktes lyrisches Ich? Wer ist angesprochen? 5. Aussage Worum geht es? Wird Handlung erzählt? Was wird beschrieben (Dinge, Menschen, Tiere, Gefühle, etc.)? Titel? Interpretation? Aussage? Motive? Textwirkung? 26 Metaphern bei Gryphius Natur Tageszeiten 27 Schifffahrt