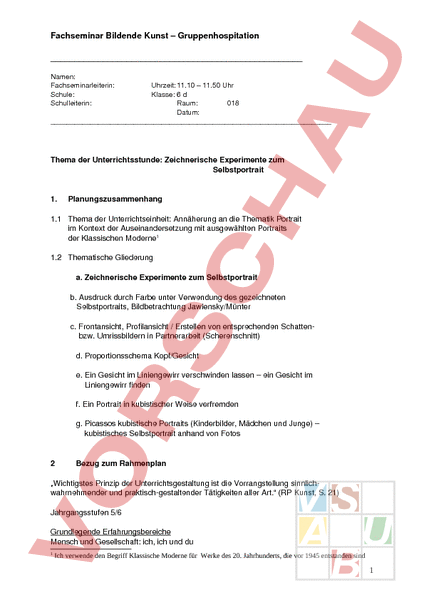Arbeitsblatt: Zeichnerische Experimente zum Selbstportrait
Material-Details
Stationenarbeit
Bildnerisches Gestalten
Grafik
6. Schuljahr
8 Seiten
Statistik
83726
1608
20
07.07.2011
Autor/in
Petra Müller
Land:
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Fachseminar Bildende Kunst – Gruppenhospitation Namen: Fachseminarleiterin: Schule: Schulleiterin: Uhrzeit:11.10 – 11.50 Uhr Klasse: 6 Raum: 018 Datum: Thema der Unterrichtsstunde: Zeichnerische Experimente zum Selbstportrait 1. Planungszusammenhang 1.1 Thema der Unterrichtseinheit: Annäherung an die Thematik Portrait im Kontext der Auseinandersetzung mit ausgewählten Portraits der Klassischen Moderne1 1.2 Thematische Gliederung a. Zeichnerische Experimente zum Selbstportrait b. Ausdruck durch Farbe unter Verwendung des gezeichneten Selbstportraits, Bildbetrachtung Jawlensky/Münter c. Frontansicht, Profilansicht Erstellen von entsprechenden Schatten bzw. Umrissbildern in Partnerarbeit (Scherenschnitt) d. Proportionsschema Kopf/Gesicht e. Ein Gesicht im Liniengewirr verschwinden lassen – ein Gesicht im Liniengewirr finden f. Ein Portrait in kubistischer Weise verfremden g. Picassos kubistische Portraits (Kinderbilder, Mädchen und Junge) – kubistisches Selbstportrait anhand von Fotos 2 Bezug zum Rahmenplan „Wichtigstes Prinzip der Unterrichtsgestaltung ist die Vorrangstellung sinnlich wahrnehmender und praktischgestaltender Tätigkeiten aller Art. (RP Kunst, S. 21) Jahrgangsstufen 5/6 Grundlegende Erfahrungsbereiche Mensch und Gesellschaft: ich, ich und du 1 Ich verwende den Begriff Klassische Moderne für Werke des 20. Jahrhunderts, die vor 1945 entstanden sind 1 Vorstellungswelten: Innere Welt subjektiver Wahrnehmungen (welche Vorstellung habe ich von mir, meinem Gesicht?) Von den SuS2 wird gefordert, sich bewusst auf unterschiedliche ästhetische Erfahrungen einzulassen. Zeit und Rhythmus Wachsen und Werden, Verändern, (S. 26) (wie verändert sich mein Gesicht, das Gesicht meiner Mitschüler in dieser Pubertätszeit?) Künstlerische Strategien bildhaftes Gestalten und Ausdrücken: annähern an Erforschen: wahrnehmen, untersuchen, experimentieren Anforderung: „begründete Vermutungen anstellen über praktizierte künstlerische Strategien. (S. 37) Verfahren und Techniken: Verfahren und Techniken auf Ausdrucksmöglichkeiten hin erkunden und erproben, daraus entstehende Ausdrucksqualitäten erkennen, benennen und wertschätzen. Inhalte: Zeichnen – Linien und Kritzel – Eigenschaften, Möglichkeiten und Ausdruckswerte: durchgehend – unterbrochen 2.1 Kompetenzen Sachkompetenz: Die SuS erarbeiten sich ein elementares Erfahrungswissen über Gestaltungsmöglichkeiten des mit Bleistift gezeichneten Selbstportraits. Methodenkompetenz: SuS sind in der Lage, zeichnend zu experimentieren. Personale Kompetenz: Die SuS schulen ihre Körperwahrnehmung. Sozialkompetenz: Die SuS entwickeln Toleranz und Respekt gegenüber ihren Mitschülern, deren Wahrnehmung und Ergebnissen. 3 Unterrichtsziele Stundenziel: Die SuS erarbeiten sich ein elementares Erfahrungswissen zum Thema Selbstportrait, in dem sie drei bisher unbekannte Herangehensweisen explorieren und deren Vor und Nachteile in Worte zu fassen versuchen. TLZ 1 SuS lernen den Fachbegriff Selbstportrait als Bezeichnung eines Bildnisses der eigenen Person kennen. TLZ 2 SuS erarbeiten sich ein elementares Erfahrungswissen zum Thema, indem sie drei durch die angeleitete Herangehensweisen des Zeichnens eines Selbstportraits erproben. TLZ 3 SuS analysieren die erprobten Erfahrungen, indem sie Vor und Nachteile der verschiedenen Herangehensweisen in Worten beschreiben. 2 Schülerinnen und Schüler 2 4 Sachdarstellung Ein Selbstportrait ist das Selbstbildnis (frz. portrait Bildnis), das der Künstler von sich selbst macht. Er hat einen hohen Aussagewert über die persönliche Selbsteinschätzung, spiegelt Wesensmerkmale, Eigenschaften und die Stellung des Künstlers in der Gesellschaft wider.3 Das Bildnis kann dem Portraitierten ähneln, ihn idealisieren oder karikieren. Es kann aber ebenso gut auch keinen unmittelbar nachvollziehbaren Bezug zum Bildautor aufweisen. Ein Schwerpunkt der Porträtmalerei des 20. Jahrhunderts lag in der Erfindung einer neuen Realität, die nur im Bild existiert. Das freie, aber auch das planvolle Spiel mit Farben und Formen bzw. die Gestaltung wurde wichtiger als die Abbildung. Nach der Form der Darstellung unterscheidet man: Bildniskopf Büste Bruststück Halbfigur Kniestück Ganzfigur Kopf unter Einbeziehung des Halses Kopf, Hals, Schulterpartie und ein Teil des Oberkörpers Großteil des Oberkörpers mit Armen Zeigt die Figur bis zur Taille Der Porträtierte ist bis zum Knie gezeichnet. Die Person ist in ihrer Gesamtheit zu sehen. Nach der Drehung des Kopfes unterscheidet man: Vorderansicht Profil Halbprofil Dreiviertelansicht en face, frontal, in gerader Ansicht Seitenansicht Eine Kopfseite ist voll zu sehen, die andere stark verkürzt. Früher spielte das reine Kopfporträt nur auf Münzen eine Rolle. Erst Albrecht Dürer (1471 – 1528) entwickelte Grafik und Zeichnung zu eigenständigen Kunstgattungen und das Selbstportrait zu einem eigenen Genre.4 1484 zeichnete er als Dreizehnjähriger ein bis heute faszinierendes Selbstportrait. Als Handzeichnung bezeichnet man die grafische Gestaltung auf der Fläche durch Punkte, Linien, Schraffuren, Kritzel u. a. Der Bildträger ist gewöhnlich Papier und das Zeichenmaterial ein Stift. Das Zeichnen ist eine direkte und jedem zugängliche Form des künstlerischen Ausdrucks, die leicht handhabbar ist und den SuS jederzeit zur Verfügung steht.5 Bleistifte als Zeichenmaterial können von nuancenreichen Grautönen bis hin zum tiefen Schwarz Raumillusionen erzeugen. Zeichnerische Grundfertigkeiten sind Voraussetzung für die Druckgrafik.6 5 Bedingungsfeldanalyse 5.1 Allgemeine Voraussetzungen In der Klasse sind zurzeit 11 Jungen und 8 Mädchen, überwiegend nichtdeutscher Herkunft und aus so genannten „bildungsfernen Elternhäusern. Es ist eine überwiegend leistungsstarke und leistungswillige Klasse. 3 Duden Kunst, Basiswissen Schule, S. 233 Ebd., S. 72 5 Diese Möglichkeit nutzen nicht wenige SuS zur Entlastung im Unterricht. 6 Ebd., S. 238 4 3 Eine Schülerin, Eman, hat den Status „lernbehindert und wird entsprechend in Deutsch und Mathematikstunden gefördert. In BK spricht sie mich persönlich an, wenn sie eine Frage hat oder etwas nicht versteht. Die Klassenlehrerin hat viel dafür getan, dass sich das Miteinander in der Lerngruppe positiver und unterstützender gestaltet, trotzdem gibt es immer wieder viele Streitereien unter den SuS, die das Arbeiten und Lernen auch zu zweit oder in Gruppen erschweren. Trotzdem sind die SuS mit Freude und manche auch mit Ehrgeiz in BK dabei. Die SuS sitzen an Gruppentischen. Ein Schüler (Kai) sitzt allein, weil er wenig gruppenfähig ist, sich der Gruppenarbeit meistens verweigert. Ein anderer Schüler (Serkan) sitzt ebenfalls allein, um andere zu schützen, weil er SuS massiv, aber sehr subtil unter Druck gesetzt hat. Ich unterrichte die Lerngruppe seit der 5. Klasse einmal wöchentlich für eine Doppelstunde in BK. Die Klassenlehrerin ist die zweite Stunde als Integrationslehrerin dabei, wenn sie nicht fehlende Lehrer vertreten muss. 5.2 Sachstruktureller Entwicklungsstand Ende der 5. Klasse hat sich die Lerngruppe mit Körperproportionen, jedoch weder mit Gesichtsproportionen noch mit dem Thema Selbstportrait auseinandergesetzt. Im letzten Projekt waren die SuS mit Druckvarianten begeistert beschäftigt. Mit Bleistift gezeichnet oder skizziert haben die SuS in diesem und im letzten Schuljahr selten. Für einige SuS (David, Mohammed, Hussein, Selda) ist die experimentierende, forschende Herangehensweise ein Problem, wie die Auseinandersetzung mit den Skulpturen von Roman Signer (Hamburger Bahnhof) gezeigt hat. Diese SuS drücken das in den Sätzen: Ich kann das nicht! oder Ich weiß nicht, was ich machen soll! aus. Sie brauchen dann viel Unterstützung, Ermunterung und Hilfe, um wirklich eigenständig ästhetisch etwas zu erforschen und auch Hilfen wie Wortkarten oder Satzanfänge, um diesen Prozess zu beschreiben. 6 Methodischdidaktische Vorüberlegungen In ihrer beginnenden Adoleszenzphase sind die 12 – 13 jährigen SuS sehr mit körperlichen Veränderungen, der Erforschung der männlichen und weiblichen Geschlechterrolle und mit Ende der Grundschulzeit dem Übergang auf eine weiterführende Schule beschäftigt. SuS fragen sich in dieser Phase verstärkt: Wer bin ich? Das Thema Selbstportrait kommt diesen existentiellen Fragen der SuS entgegen und bietet ihnen möglicherweise neue Einsichten und Wege, sich in der künstlerischen Auseinandersetzung mit sich selbst zu befassen und sich anderen mitzuteilen. Andererseits ist es ein sensibles Thema, das auch mit Ablehnung, mit nichteinverstandensein des eigenen Aussehens zu tun haben kann. Die nachfolgend beschriebenen einschränkenden Gestaltungs und Zeitkriterien sollen die SuS vor zu hohen Ansprüchen entlasten, sie zum spielerischen Experimentieren anregen und ihre zum Teil festgefahrenen Schematisierungen und allzu engen Bindungen an realistische Abbildungen unterlaufen. So kann das experimentierende Zeichnen befreiend wirken. In der Einführungsphase wird die Aufmerksamkeit zuerst auf eine Wortkarte Selbstportrait – an der Tafel gelenkt. Die SuS können ihr Vorwissen dazu aktivieren, das deutsche Wort kommt dazu. Um gleich evtl. Widerständen und Versagensängsten entgegenzutreten, wird das Stundenthema transparent gemacht, das zeichnerische Experimentieren zum Selbstportrait in drei Übungen. Die L. äußert die Erwartung, dass die SuS sich auf ein ungewohntes Experiment mit ungewohnten Ergebnissen einlassen und nicht erwarten, dass realistische Abbilder ihrer Gesichter entstehen. 4 Erarbeitung: 1. Aufgabe: nichts sehen – blind zeichnen (oder einen Punkt fixieren, auf jeden Fall nicht aufs Blatt schauen) DIN 4 L.: Schließe die Augen und zeichne dein Selbstportrait aus dem Gedächtnis. (1 Minute) 2. Aufgabe: sich im Spiegel sehen – blind zeichnen (DIN 4) L: Setze dich vor deinen Stuhl, stelle den Spiegel auf die Sitzfläche. Schau Dir dein Gesicht genau an und zeichne blind unter dem Stuhl dein Selbstportrait auf einem DIN 4 Blatt! (1 Minute) Austausch in PA oder Plenum: hast Du etwas besonders ausführlich gezeichnet? Ist dir etwas Neues in deinem Gesicht aufgefallen? Kannst du etwas von dir in deiner Zeichnung wieder erkennen, obwohl deine Hand doch „blind war? 3. Aufgabe: tasten – markieren zeichnen L: Halte ein DINA 3 Blatt vor dein Gesicht. Taste, was sich unter dem Blatt befindet. Wo liegen Nase, Augenhöhlen, Augenbrauen, Haaransatz, Mund, Mundwinkel, Kinn und Stirnlinie usw.? Markiere die entsprechenden Stellen dünn mit Bleistift. Du kannst dir dabei von einem Partner helfen lassen, musst es aber nicht. Schau Dir deine Hilfslinien anschließend an und verbinde sie zu einer Zeichnung deines Gesichtes. (2 2 Min.) Während aller Arbeitsphasen unterstützt die L. einzelne SuS und beobachtet, welche Schwierigkeiten bei der Arbeit auftauchen. Nach jeder Übung Zeit für spontane Reaktionen als emotionale Entlastung und Reflektion. Auswertung: Nach den Übungen werden die Zeichnungen von zwei SuS an die Tafel gehängt, um die Ergebnisse der drei unterschiedlichen Aufgabenstellungen verbal zu vergleichen. Dieses Gespräch bereitet die schriftliche Reflektion in PA vor. Dazu erhalten alle SuS das untere AB, um für 5 Min. die Vor und Nachteile der drei Übungen zu erarbeiten. Für diesen Vergleich legen sie ihre drei gezeichneten Selbstportraits nebeneinander auf den Tisch. Nicht alle SuS werden diese Aufgabe vollständig erfüllen können, aber so haben zumindest alle die Gelegenheit, in Ansätzen darüber nachzudenken. Anschließend werden die Ergebnisse gesammelt und auf OHFolie festgehalten. Dabei hängen die Ergebnisse zweier SuS exemplarisch an der Tafel. Die Stunde endet mit einem Ausblick auf das weitere Arbeiten mit den Zeichnungen. BK Klasse: Name: Datum: Zeichnerische Experimente zum Selbstportrait Auswertung Wie gezeichnet Format Zeit A4 2 Min. Vergleich der drei Übungen Vorteile Nachteile 5 Nichts sehen blind zeichnen A4 2 Min. A3 2 Min. Im Spiegel sehen blind zeichnen Tasten, markieren, zeichnen als Folie und Vorlage für die SuS Erwartete Äußerungen der SuS: beim Blindzeichnen konzentriere ich mich besser auf mein Gesicht. Ich kann aber meine Hand nicht steuern, ich erkenne mich überhaupt nicht. Ich kann zwar im Spiegel nachsehen, wie ich aussehe, kann es aber nicht auf meiner Zeichnung kontrollieren. Bei der letzten Übung ist die Stellung der Augen und des Mundes markiert, so dass ich die Proportionen richtig zeichne, aber ich kann das Format nicht frei wählen. Außerdem ist das Papier zerknittert. usw. 6 Es soll sich um eine bewertungsfreie Unterrichtsstunde handeln. „Lernsituationen, in denen die SuS spielerischexperimentell ästhetischkünstlerische Erfahrungen sammeln, sollten frei sein von fremder Bewertung. (RP BK, S. 41) 7 Literatur 1. Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg, Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport Berlin, Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur MecklenburgVorpommern, Rahmenlehrplan Grundschule Kunst, Berlin 2004 2. Zeitschrift KUNST 1/2005 Gesichter 3. Nicola Rother, „Blind zeichnen – besser sehen. In: Zeitschrift KUNST UNTERRICHT, Bildnerisch gestalten in der Grundschule, SB 2002 4. Duden Kunst, Basiswissen Schule, Berlin 2005 7 8 Verlaufsplanung Phase/ Zeit Inhalt/ Ziel Einstieg L. begrüßt die Gäste 11.10 –11.15 (ca. 5 Min.) Stummer Impuls: Wortkarte „Selbstportrait TLZ 1 L. fragt nach einer Erklärung des Begriffes Stundentransparenz und L.Erwartung: drei zeichnerische Experimente zum Thema Selbstportrait L. benennt die evtl. Schwierigkeiten. Erarbeitung 11.1511.30 (ca. 15 Min.) TLZ 2 Auswertung Sicherung 11.35 – 11.50 (ca. 15 Min.) TLZ 3 Sozial/ Aktionsformen Arbeitsmittel und Medien LSGespräch Wortkarte Tafel L. teilt Bleistifte und Papier aus und leitet die Erste Übung an. Einzelarbeit PartnerAustausch PA L. teilt Spiegel und Papier aus und leitet die EA Zweite Übung an (kurzer Erfahrungsaustausch) Plenum L. teilt Papier aus und leitet die 3. Übung an EA oder PA SuS vergleichen die Zeichnungen an der Tafel mit den Kreis vor der Aufgabenstellungen. Tafel L. teilt AB aus mit der Aufgabe, in PA die Vor und Nachteile der drei Übungen zu erarbeiten. PA L. sammelt und notiert auf OHFolie die Ergebnisse. Ausblick Plenum DIN 4 Papier Bleistift Didaktische Funktion Anknüpfen an Vorwissen Hinführung zum Stundenthema durch Visualisierung und Handlungsorientierung Zielorientierung Vorbereitung der anschließenden Arbeitsphase experimentelles Arbeiten unter Anleitung Plus Spiegel DIN 3 Papier SuSErgebnisse OHProjektor: AB Würdigung und Vergleich der SuSArbeiten 8