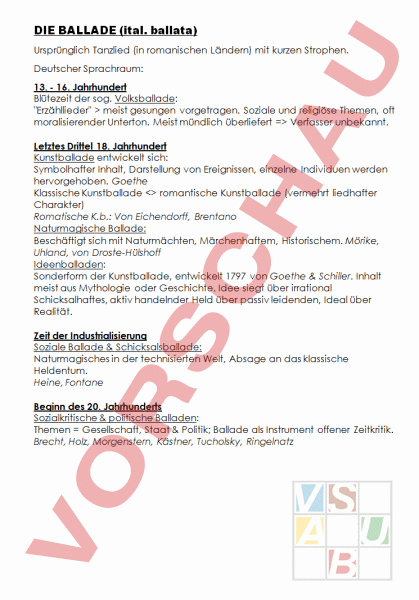Arbeitsblatt: Entwicklung der Ballade
Material-Details
Kurze Zusammenstellung der Entwicklungsgeschichte der Ballade vom 13. Jhdt. bis heute.
Deutsch
Leseförderung / Literatur
9. Schuljahr
1 Seiten
Statistik
8466
1686
15
30.07.2007
Autor/in
Doris Sommer
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
DIE BALLADE (ital. ballata) Ursprünglich Tanzlied (in romanischen Ländern) mit kurzen Strophen. Deutscher Sprachraum: 13. 16. Jahrhundert Blütezeit der sog. Volksballade: Erzähllieder meist gesungen vorgetragen. Soziale und religiöse Themen, oft moralisierender Unterton. Meist mündlich überliefert Verfasser unbekannt. Letztes Drittel 18. Jahrhundert Kunstballade entwickelt sich: Symbolhafter Inhalt, Darstellung von Ereignissen, einzelne Individuen werden hervorgehoben. Goethe Klassische Kunstballade romantische Kunstballade (vermehrt liedhafter Charakter) Romatische K.b.: Von Eichendorff, Brentano Naturmagische Ballade: Beschäftigt sich mit Naturmächten, Märchenhaftem, Historischem. Mörike, Uhland, von Droste-Hülshoff Ideenballaden: Sonderform der Kunstballade, entwickelt 1797 von Goethe Schiller. Inhalt meist aus Mythologie oder Geschichte. Idee siegt über irrational Schicksalhaftes, aktiv handelnder Held über passiv leidenden, Ideal über Realität. Zeit der Industrialisierung Soziale Ballade Schicksalsballade: Naturmagisches in der technisierten Welt, Absage an das klassische Heldentum. Heine, Fontane Beginn des 20. Jahrhunderts Sozialkritische politische Balladen: Themen Gesellschaft, Staat Politik; Ballade als Instrument offener Zeitkritik. Brecht, Holz, Morgenstern, Kästner, Tucholsky, Ringelnatz