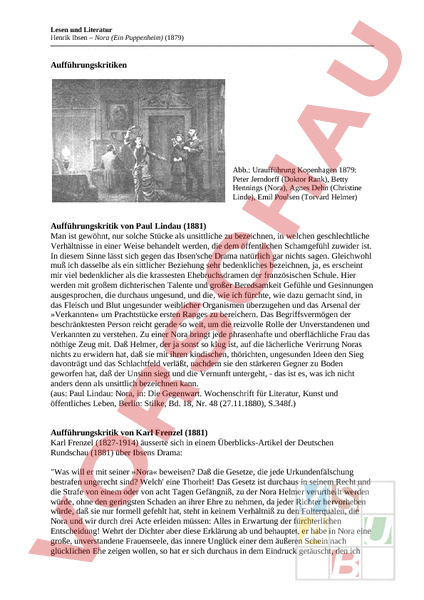Arbeitsblatt: Aufführungskritiken zu Ibsens Nora Ein Puppenheim
Material-Details
Arbeitsauftrag: 3 zeitgenössische Aufführungskritiken sollen gelesen und unter Berücksichtigung der damaligen gesellschaftlichen Verhältnisse bearbeitet werden.
Deutsch
Leseförderung / Literatur
10. Schuljahr
2 Seiten
Statistik
85915
1024
6
01.09.2011
Autor/in
Nadia Caldes
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Lesen und Literatur Henrik Ibsen – Nora (Ein Puppenheim) (1879) Aufführungskritiken Abb.: Uraufführung Kopenhagen 1879: Peter Jerndorff (Doktor Rank), Betty Hennings (Nora), Agnes Dehn (Christine Linde), Emil Poulsen (Torvard Helmer) Aufführungskritik von Paul Lindau (1881) Man ist gewöhnt, nur solche Stücke als unsittliche zu bezeichnen, in welchen geschlechtliche Verhältnisse in einer Weise behandelt werden, die dem öffentlichen Schamgefühl zuwider ist. In diesem Sinne lässt sich gegen das Ibsenche Drama natürlich gar nichts sagen. Gleichwohl muß ich dasselbe als ein sittlicher Beziehung sehr bedenkliches bezeichnen, ja, es erscheint mir viel bedenklicher als die krassesten Ehebruchsdramen der französischen Schule. Hier werden mit großem dichterischen Talente und großer Beredsamkeit Gefühle und Gesinnungen ausgesprochen, die durchaus ungesund, und die, wie ich fürchte, wie dazu gemacht sind, in das Fleisch und Blut ungesunder weiblicher Organismen überzugehen und das Arsenal der »Verkannten« um Prachtstücke ersten Ranges zu bereichern. Das Begriffsvermögen der beschränktesten Person reicht gerade so weit, um die reizvolle Rolle der Unverstandenen und Verkannten zu verstehen. Zu einer Nora bringt jede phrasenhafte und oberflächliche Frau das nöthige Zeug mit. Daß Helmer, der ja sonst so klug ist, auf die lächerliche Verirrung Noras nichts zu erwidern hat, daß sie mit ihren kindischen, thörichten, ungesunden Ideen den Sieg davonträgt und das Schlachtfeld verläßt, nachdem sie den stärkeren Gegner zu Boden geworfen hat, daß der Unsinn siegt und die Vernunft untergeht, das ist es, was ich nicht anders denn als unsittlich bezeichnen kann. (aus: Paul Lindau: Nora, in: Die Gegenwart. Wochenschrift für Literatur, Kunst und öffentliches Leben, Berlin: Stilke, Bd. 18, Nr. 48 (27.11.1880), S.348f.) Aufführungskritik von Karl Frenzel (1881) Karl Frenzel (1827-1914) äusserte sich in einem Überblicks-Artikel der Deutschen Rundschau (1881) über Ibsens Drama: Was will er mit seiner »Nora« beweisen? Daß die Gesetze, die jede Urkundenfälschung bestrafen ungerecht sind? Welch eine Thorheit! Das Gesetz ist durchaus in seinem Recht und die Strafe von einem oder von acht Tagen Gefängniß, zu der Nora Helmer verurtheilt werden würde, ohne den geringsten Schaden an ihrer Ehre zu nehmen, da jeder Richter hervorheben würde, daß sie nur formell gefehlt hat, steht in keinem Verhältniß zu den Folterqualen, die Nora und wir durch drei Acte erleiden müssen: Alles in Erwartung der fürchterlichen Entscheidung! Wehrt der Dichter aber diese Erklärung ab und behauptet, er habe in Nora eine große, unverstandene Frauenseele, das innere Unglück einer dem äußeren Schein nach glücklichen Ehe zeigen wollen, so hat er sich durchaus in dem Eindruck getäuscht, den ich Lesen und Literatur Henrik Ibsen – Nora (Ein Puppenheim) (1879) von seiner Nora empfange. [.] Und dies Verlassen ihres Mannes, ihrer unerwachsenen Kinder soll nicht unsittlich, soll tragisch sein? [.] Ibsens Nora stellt den Begriff der Pflicht einfach auf den Kopf; während sie die verkörperte Eigensucht ist, hält sie sich für die verkörperte hingebende Liebe- Den schlimmsten Fehler aber finde ich, daß die zwei Seiten, aus denen Noras Natur besteht, sich nicht zusammenreimen lassen. Wer so denkt und redet, wie die Nora der letzten Scene, tänzelt und ruschelt und spielt nicht das Kätzchen, wie die Nora der ersten. Möglich, daß unser Dichter ein Modell zu seiner Nora kennt, aber er hat nichts gethan, um ihr Abbild auf der Bühne, im Rahmen der Dichtung, wahrscheinlich zu machen. (aus: Karl Frenzel, Die Berliner Theater, in: Deutsche Rundschau (26) 19881, S.308f., zit. n.: Keel 1990, S.51) Aufführungskritik von Hugo Witttmann (1881) Hugo Wittman (geb. 1839) rezensierte die österreichische Erstaufführung im September 1881 in der Neuen Freien Presse, dem liberalen Weltblatt Wiens, die Aufführung des Stücks mit den Worten: Wir haben im Laufe der Zeit viel mißrathene Frauengestalten über die Bühne hinken sehen, aber eine so unausstehlich verschrobene und geistig verkrüppelte Person wie diese Nora des norwegischen Dichters ist uns selten vorgekommen. Bei anderen Mißgeburten kann man wenigstens errathen, was ihr unglückseliger Erzeuger eigentlich gemeint hat. die dramatische Absicht schlägt durch, wenn auch die dramatische Kunst versagt. Die arme Nora aber lässt vollständig im Unklaren, ob wir in ihr eine Verschwenderin oder eine haushälterische Frau, ein leichtsinniges Ding oder die Tugend selber, eine Puppe oder eine Heldin zu sehen haben. in Gewebe von Unmöglichkeiten und Unwahrheiten spinnt sich um dieses in das Nichts puffende Räthsel [.] (zit. n. Keel 1990, S.53) Auftrag • Fassen Sie die wichtigsten Aussagen des zeitgenössischen Kritikers Ihres Ihnen zugelosten Textes in Form von 1 bis 3 Thesen zusammen. • Denken Sie dabei an die zeitgenössischen gesellschaftlichen Verhältnisse, die den Autor zu dieser Kritik veranlasst haben. (Stichwort: bürgerliche Ehe!)