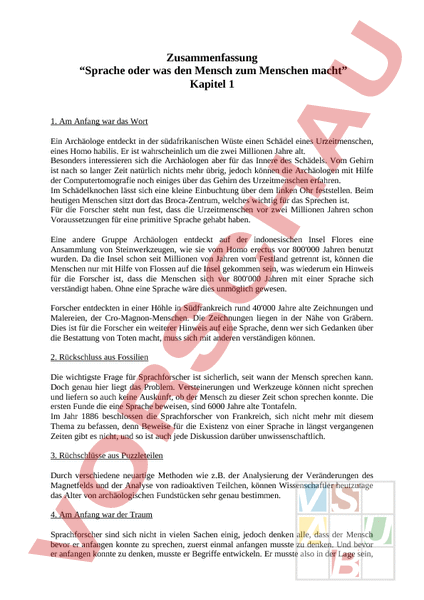Arbeitsblatt: Sprache oder Was den Mensch zum Menschen macht
Material-Details
Zusammenfassung des Buchess "Sprache oder was den Mensch zum Menschen macht" von Nikolaus Nützel
Deutsch
Leseförderung / Literatur
klassenübergreifend
30 Seiten
Statistik
86304
1245
4
08.09.2011
Autor/in
Severin Bruppacher
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Zusammenfassung Sprache oder was den Mensch zum Menschen macht Kapitel 1 1. Am Anfang war das Wort Ein Archäologe entdeckt in der südafrikanischen Wüste einen Schädel eines Urzeitmenschen, eines Homo habilis. Er ist wahrscheinlich um die zwei Millionen Jahre alt. Besonders interessieren sich die Archäologen aber für das Innere des Schädels. Vom Gehirn ist nach so langer Zeit natürlich nichts mehr übrig, jedoch können die Archäologen mit Hilfe der Computertomografie noch einiges über das Gehirn des Urzeitmenschen erfahren. Im Schädelknochen lässt sich eine kleine Einbuchtung über dem linken Ohr feststellen. Beim heutigen Menschen sitzt dort das Broca-Zentrum, welches wichtig für das Sprechen ist. Für die Forscher steht nun fest, dass die Urzeitmenschen vor zwei Millionen Jahren schon Voraussetzungen für eine primitive Sprache gehabt haben. Eine andere Gruppe Archäologen entdeckt auf der indonesischen Insel Flores eine Ansammlung von Steinwerkzeugen, wie sie vom Homo erectus vor 800�00 Jahren benutzt wurden. Da die Insel schon seit Millionen von Jahren vom Festland getrennt ist, können die Menschen nur mit Hilfe von Flossen auf die Insel gekommen sein, was wiederum ein Hinweis für die Forscher ist, dass die Menschen sich vor 800�00 Jahren mit einer Sprache sich verständigt haben. Ohne eine Sprache wäre dies unmöglich gewesen. Forscher entdeckten in einer Höhle in Südfrankreich rund 40�00 Jahre alte Zeichnungen und Malereien, der Cro-Magnon-Menschen. Die Zeichnungen liegen in der Nähe von Gräbern. Dies ist für die Forscher ein weiterer Hinweis auf eine Sprache, denn wer sich Gedanken über die Bestattung von Toten macht, muss sich mit anderen verständigen können. 2. Rückschluss aus Fossilien Die wichtigste Frage für Sprachforscher ist sicherlich, seit wann der Mensch sprechen kann. Doch genau hier liegt das Problem. Versteinerungen und Werkzeuge können nicht sprechen und liefern so auch keine Auskunft, ob der Mensch zu dieser Zeit schon sprechen konnte. Die ersten Funde die eine Sprache beweisen, sind 6000 Jahre alte Tontafeln. Im Jahr 1886 beschlossen die Sprachforscher von Frankreich, sich nicht mehr mit diesem Thema zu befassen, denn Beweise für die Existenz von einer Sprache in längst vergangenen Zeiten gibt es nicht, und so ist auch jede Diskussion darüber unwissenschaftlich. 3. Rüchschlüsse aus Puzzleteilen Durch verschiedene neuartige Methoden wie z.B. der Analysierung der Veränderungen des Magnetfelds und der Analyse von radioaktiven Teilchen, können Wissenschaftler heutzutage das Alter von archäologischen Fundstücken sehr genau bestimmen. 4. Am Anfang war der Traum Sprachforscher sind sich nicht in vielen Sachen einig, jedoch denken alle, dass der Mensch bevor er anfangen konnte zu sprechen, zuerst einmal anfangen musste zu denken. Und bevor er anfangen konnte zu denken, musste er Begriffe entwickeln. Er musste also in der Lage sein, reele von virtuellen, vorgestellten Gegenständen zu unterscheiden. Niedere Tiere wie ein Frosch können dies nicht. Höhere Tiere wie Hunde können jedoch träumen, dies aber auch nur von Bildern, die sie den Tag übergesehen haben. Sich Bilder vorzustellen, welche nicht gerade vorhanden sind, sind die Grundlage für das menschliche Denken, welche wiederum als Basis fürs Sprechen gilt. 5. Ein Begriff ist mehr als das, was wir sehen Eine Banane und eine Orange sind eigentlich total verschieden. Doch muss ein früherer Mensch erkannt haben, dass beides Obst ist. Obst hat er zwar nicht als Wort verwendet, es aber gedacht. Trotzdem hat er damit schon einen Begriff gebildet. Und dies hat sehr wahrscheinlich auch schon vor Millionen vor Jahren begonnen, denn auch einige Affen sind fähig, einfache Symbolsprachen zu erlernen. Also müssen die gemeinsamen Vorfahren von Affen und Menschen vor 5-6 Millionen Jahren schon frühe Formen des Denkens entwickelt haben. Doch schon vor zwei Millionen Jahren haben sich Menschen und Affen deutlich unterschieden. Der Mensch ging aufrecht und hatte ein grösseres Gehirn als Affen, dies vor allem durch den Konsum von Eiweiss aus Fleisch. Die grössere Anzahl von Gehirnzellen war grundlegend dafür, dass der Mensch eine Sprache entwickeln konnte. 6. Vom Kauorgan zum Sprechorgan Vor gut zwei Millionen Jahren waren die Stimmorgane der Menschen noch nicht zum Sprechen geeignet. Gesten mit den Händen und die Mimik waren also sehr wichtig am Anfang der Sprache. Die Augen waren mindestens so wichtig fürs Verstehen, wie die Ohren. Fürs Sprechen muss der Atem kontrolliert werden, da Sprechen nichts anderes ist, als kontrolliert Luft auszuatmen und so die Stimmbänder in Schwingung zu versetzen. Tiere können dies nicht. Schimpansen sind zwar in der Lage, zu schreien und zu rufen, jedoch müssen sie vor jedem Laut einatmen, was sich nicht fürs sprechen eignet. Auch die Knochenfunde von Homi erecti beweisen, dass diese ihren Atem noch nicht genau genug steuern konnten, um zu sprechen wie wir es kennen. 7. Ein langer Weg zur Sprache Wahrscheinlich waren die Menschen erst vor 200�00 Jahre körperlich in der Lage zu sprechen. Jedoch fanden die ersten richtigen Unterhaltungen zwischen Menschen wahrscheinlich erst vor 100�00 Jahren statt. Nun gibt es die Frage, wie die Sprache sich entwickelt hat. Wahrscheinlich ist sie zu einem grossen Teil spielerisch entstanden. Wenn zum Beispiel ein Baby einen bestimmten Gegenstand haben wollte und es vielleicht aus Versehen einen Laut ausstiess. Das Umfeld konnte nun diesen Begriff entweder für den Gegenstand verwenden oder mit dem Laut das Verhalten des Babys imitieren. Die ersten Worte wurden auch ausprobiert, ohne zu wissen wie sie auf das Umfeld wirkten. Entscheidend ist auch, dass die Menschen irgendwann angefangen haben, Wörter zu entwickeln, welche nicht mehr akustisch mit dem Begriff zu tun hatten. 8. Einige Theorien zu Entstehung menschlicher Wörter Wau-wau-Theorie: Die Sprache ist durch das Nachahmen von Naturlauten entstanden. Aua-Theorie: Die Sprache ging aus Ausrufen und Aufschreien hervor. Hau-ruck-Theorie: Die Sprache entstand durch Stöhnen und Rufen bei anstrengender gemeinsamer Arbeit. Sing-Sang-Theorie: Die Sprache ist beim gemeinsamen Singen entstanden. Die ersten drei Theorien eignen sich nicht für komplexere Sätze. Für solche sind Wörter notwendig, welche nichts mit dem zu tun haben, was sie bedeuten. Der Mensch legt selber fest, wie er einen Gegenstand oder eine Handlung benennt. 9. Die Sprache als Wettbewerbsvorteil Vor 200�00 Jahren, wo sich die Sprache gerade entwickelte, war es für Menschen enorm wichtig, den Tieren überlegen zu sein. Durch die Sprache konnten die Menschen besser jagen und auch besser Nahrung sammeln. Die Menschen konnten ihre Gedanken durch Wörter ordnen, was mithalf, das Denken weiter zu entwickeln. Anstatt sich ein Bild zu entwerfen, konnte man durch leises Sprechen schneller einen Gedanken entwerfen. 10. Keine Sprachentwicklung ohne Klatsch und Tratsch Die Sprache entstand sicher nicht nur, um irgendwelche Pläne fürs Überleben zu schmieden. Eine wichtige Funktion ist es, dass sich Menschen untereinander verstehen und so eine Gemeinschaft aufbauen und auch über unwichtige Dinge Sprechen können. Kapitel 2 „Francine sicher sein, dass Koko reden Oder: Können Tiere sprechen? Als das Gorillaweibchen Koko am 4.Juli 1971 geboren wurde, haben ihre Betreuer sofort angefangen ihr die Zeichensprache „Ameslan zu lehren. Das Gorillaweibchen gewann nach und nach einen immer grösseren Wortschatz. Nach Jahren des Lernens konnte Koko schliesslich all ihre Wünsche und ihre Gefühle ausdrücken, berichtet die Betreuerin Francine Patterson. Affensprache in der Wildnis Menschenaffen kommunizieren nicht nur mit Menschen, die ihnen vorher eine Gebärdensprache beigebracht haben. In der Wildnis kommunizieren Menschenaffen durch verschiedenste Laute wie Grunzen, Wimmern, Kreischen und Schreien. Auch weniger hoch entwickelte Affenarten wie die Grüne Meerkatze können durch verschiedene Laute miteinander kommunizieren. So warnt z.B. ein Bellen vor Leoparden, ein Husten vor Raubvögeln und ein Quieken vor Schlangen. Trompeten, Grunzen, Quieken, Zwitschern – und sogar Pupsen Nicht nur Affen können miteinander kommunizieren. Elefanten tun dies nicht nur durch das Trompeten, sondern auch mit Tönen, die so tief sind, dass sie für den Menschen unhörbar sind. Auch Wale brauchen verschiedene Geräusche für die Kommunikation und als Echolot. Andere Fische reiben ihre Schuppen aneinander oder lassen ihre Schwimmblasen schwingen um Rivalen zu vertreiben oder das andere Geschlecht auf sich aufmerksam zu machen. Der pazifische Hering stösst in gewissen Abständen Gasblasen aus seinem Hinterteil aus, um mit anderen Fischen zu kommunizieren. .wünschen dir ein frohes Jahr Vögel kommunizieren durch Rufe und Gesang. Die Nachtigall beherrscht z.B. über 200 verschiedene Strophen. Zudem gibt es auch unterschiede zwischen dem Gesang von Vögeln in verschiedenen Ländern. Papageien schaffen es sogar Stücke von menschlicher Sprache zu erlernen. So konnte der Graupapagei Alex verschiedene Gegenstände richtig benennen und auch einfache Forderungen stellen. Wie Maja und Willi wirklich reden Auch Tiere, bei denen man es nie vermuten wurde, gibt es Kommunikationssysteme: Glühwürmchen verständigen sich mit Lichtimpulsen, Ameisen mit verschiedenen Duftstoffen und Bienen mit dem Bienentanz. 1912 entdeckte der Naturforscher Karl von Frisch die Bienensprache. Wenn eine Botschafterbiene eine Nahrungsquelle entdeckt hat, teilt sie dies durch einen Tanz den anderen Bienen mit. Durch Geschwindigkeit, Ausrichtung etc. wird die Stelle der Nahrungsquelle beschrieben. Sprache mit Einschränkungen Obwohl es im Tierreich verschiedenste Sorten von Kommunikation gibt, wird damit eigentlich recht wenig ausgedrückt. Meist besteht der Sinn dahinter aus dem Fernhalten von Rivalen aus dem eigenen Territorium oder aus dem „Auf-sich-aufmerksam-machen. „Lass uns drüber reden gibt es bei den Tieren nicht So ist es auch bei den Grünen Meerkatzen. Diese können zwar mit verschiedenen Lauten auf verschiedene Gefahren aufmerksam machen, was sie aber nicht können, ist das „reden über die Gefahren, wenn diese nicht gerade anwesend ist. Wenn also eine Meerkatze z.B. den Schrei für einen sich nähernden Leopard ausstösst, obwohl dieser gar nicht existiert, würden doch alle Meerkatzen fliehen. Oder gibt es doch Tiere, die „drüber reden? Seit Ende der 60er-Jahre gibt es allerdings eine ganze Reihe von Forschern, die überzeugt sind, dass manche Tiere ähnlich mit einer Sprache umgehen können, wie der Mensch. So wurden dem Affenweibchen „Washoe ca. 130 Symbole der amerikanischen Gehörlosensprache beigebracht, mit denen sie sogar ganze Sätze gebildet hat. Dem Bonobo-Schimpansen Kanzi wurden 256 verschiedene abstrakte Symbole beigebracht, mit denen er sich verständlich machen konnte. Zudem soll es auch Beweise gegeben haben, nach denen Kanzi gesprochenes Englisch verstanden haben soll. Übertreiben die „Schimpansologen? Viele Wissenschaftler halten jedoch die Begeisterung der Pfleger der Tiere für übertrieben. So wird ihnen vorgeworfen, dass die Affen gar nicht sprechen können und dass jede Bewegung des Tieres als Geste gedeutet wird und auch nur von ihren Betreuern gedeutet werden kann. Weiss ein Tier, dass ich weiss, was das Tier weiss? Viele Forscher haben auch ein grosses Problem mit den Ergebnissen der Schimpansenforscher. Es fehlt nämlich der Beweis, dass Schimpansen ein Gefühl für Grammatik haben. Diese ist besonders wichtig für die menschliche Sprache, da durch verschiedene Satzstellungen verschiedene Botschaften transportiert werden können. Zudem fehlt den Tieren eine ganz wichtige Fähigkeit: Um gescheit mit jemandem reden zu können, muss man sich stückweise in die andere Person hinein versetzen können. Kapitel 3 „Tik vielleicht das älteste Wort der Menschheit Oder: Gab es eine Ursprache? Sir William Jones hielt am 2.Februar 1786 wieder einmal eine besonders anspruchvolle Rede vor der „Asiatick Society of Bengal in Kalkutta. Eigentlich war er Richter, doch er interessierte sich für die Frage, wie Menschen ihre Gedanken ausdrücken. In seiner beschäftigte er sich deshalb mit den Ähnlichkeiten verschiedener Sprachen. Er ahnte nicht, dass seine Rede für die Sprachwissenschaft von grosser Bedeutung werden würde. Jones behauptete nämlich, dass die alt-indische Sprache Sanskrit mit dem Latein und dem Griechischem so viele Ähnlichkeiten besitzen, dass sie von einer gemeinsamen Quelle abstammen müssen. Zudem sollten Keltisch und Gotisch mit dem Alt-Indischen verwandt sein. Eine revolutionäre Erkenntnis Solch eine Vorstellung war im späten 18.Jh. umstürzlerisch. Damals dachte man noch, dass zu biblischen Zeiten eine einzelne Sprache existiert hätte. Als Gottes Antwort auf den Turmbau zu Babel, den Gott als Provokation gedeutet hatte, da der Himmel nur für ihn und die Engel gedacht war, strafte er die Menschen, in dem er verschieden Sprachen und so Unverständnis zwischen den Menschen schuf. Dies wirft jedoch Widersprüche auf, da nach biblischer Auffassung alle Sprachen zur gleichen Zeit entstanden sind, aber z.B. Italienisch sich aus dem Latein entwickelt hat. Jones hielt sich als Erster nicht daran und behauptete, dass es Sprachfamilien gibt, deren Tochtersprachen sich ähnelten. Sanskrit: Altgriechisch: Latein: Altirisch: Gotisch: piter patér pater athir fadar Grausame Menschenversuche Um die „Frage zu klären, welche Sprache Gott den Menschen als erstes gegeben habe, haben verschiedene hohe Persönlichkeiten Versuche angeordnet. So z.B. Friedrich II., der Kinder aufziehen hat lassen, mit denen niemand reden durfte. Ähnliche versuche soll bereits Pharao Psammetich und König Jacob IV. von Schottland. Die Gesetzes-Entdecker Die Ideen trafen bei vielen Sprachforschern auf offene Ohren. So auch bei Jacob Grimm, dem berühmten Märchenautoren aber auch einer der begabtesten Sprachforscher seiner Zeit. Grimm war der Erste der beschrieb, dass das in einer alten Sprachstufe in einer germanischen Sprache meist als ausgesprochen wurde. Latein: Englisch: Deutsch: pater father Vater pes foot Fuss piscis fish Fisch Weil diese Lautverwandtschaften zwischen verschiedenen Sprachen sehr regelmässig verlaufen, werden sie als Gesetze bezeichnet. Auch in anderen Sprachen gibt es Gesetze, die sich gut erkennen lassen. Im Spanischen: Im Italienischen: bonum(lat.) - bueno bonum(lat.) - buono Latein: Spanisch: Italienisch: bonum (gut) bueno buono - ue - uo rota (Rad) rueda ruota focus Herd) fuego fuoco Auf den Spuren einer untergegangenen Sprache Mit diesen Gesetzen und den Verbindungen der verschiedenen Sprachen, die sich daraus ergaben, konnten Sprachwissenschaftler Stück für Stück die „gemeinsame Quelle rekonstruieren. Diese Quelle wird Indoeuropäisch genannt. Über 140 europäische und asiatische Sprachen gehen auf sie zurück. Man nimmt an, dass die Sprache vor rund 6000 Jahren gesprochen wurde. Wo genau und wie, ist unklar. Schriftliche Überlieferungen gibt es nicht. Trotzdem haben Wissenschaftler rund 1000 Wörter rekonstruiert. Eine Fabel aus lange vergangener Zeit Ein deutscher Sprachwissenschaftler namens August Schleicher hat 1868 sogar eine Geschichte ins Indoeuropäische übersetzt. Später sind allerdings Wissenschaftler zum Ergebnis gekommen, dass sich Schleicher in der Grammatik und der genauen Aussprache geirrt hatte. 1979 wurde die Geschichte von Winfried Lehmann und Ladislav Zgusta neu erzählt. Geschichte auf S.47 S.48 Immer weiter zurück in die Vergangenheit Bei europäischen und indischen Sprachen ist man sich halbwegs sicher, dass es eine gemeinsame Vorläufersprache gegeben hat. Einige Forscher glauben aber, dass es eine noch ältere Sprache gibt, aus der sich das Indoeuropäische entwickelt hat, nämlich das Nostratische. Sie wurde laut Forschern vor rund 12�00 Jahren gesprochen und aus ihr haben sich neben Indoeuropäische auch die drawidischen, die uralischen, die altaischen, die kartvelischen und die afro-asiatischen Sprachen entwickelt. So soll das indoeuropäische Wort für Wasser *yotor vor 12�00 Jahren als wete bezeichnet worden sein. Zudem soll es auf der ganzen Welt einige gleiche Elemente geben, auch wenn die Sprachen auf den ersten Blick total unterschiedlich aussehen, meint der Sprachwissenschaftler Merrit Ruhlen. Umstrittene Spurensuche Mithilfe solcher Übereinstimmungen soll sich sogar rekonstruieren lassen, wie die Menschen vor 100�00 Jahren begannen, etwas zu entwickeln, dass man Sprache nennen kann. So soll ein Steinzeit Mensch „tik gesagt haben, wenn er „eins gemeint hat. Wenn er „eins zeigen wollte, hob er den Zeigefinger nach oben. Allerdings ist dies bei vielen Wissenschaftlern umstritten. Allgemein glaubt man, dass jede Rekonstruktion, die über 6000 Jahre hinausgeht, reine Spekulation ist. Kapitel 4 Dreitausend fünftausend zehntausend Wer bietet mehr? Oder: Wie viele Sprachen gibt es auf der Erde? In den Ländern in Europa gibt es mehr Sprachen als man vielleicht denken würde. Es gibt nicht nur die Staatssprache, wie z.B. Französisch in Frankreich, Deutsch in Deutschland, sondern auch zahlreiche Minderheitensprachen und Regionalsprachen. Klare Frage – ungenaue Antwort Es kommt darauf an, wie man die Sprachen zählt. Die meisten Sprachwissenschaftler reden von ca. 4000 – 6000 Sprachen, die es weltweit gibt. Die niedrigste Schätzung geht von ca. 3000 aus, die höchste von 10�00. Eine Sprache – oder drei? Ansichtssache! Mit ein wenig Mühe, kann ein Norddeutscher einen Bayern verstehen. Auf die Frage, ob das Bayrische nun eine eigene Sprache ist, wird der Bayer ganz klar mit ja antworten, während der Wissenschaftler sagen wird, dass es nur ein Dialekt des Standartdeutsch ist. Ein gutes Argument dafür ist, dass sich Friesen und Bayern mit ein bisschen Mühe gut miteinander verständigen können. Geschichtliche und politische Zufälle Einige Sprachen entstanden durch die Staatenbildung. So sind z.B. das Niederländische und das Ostfriesische gar nicht einmal so verschieden. Doch als der Staat Niederlande gegründet wurde, wurde es auch zur Niederländischen Sprache. Ähnlich geht es mit dem ehemaligen Serbokroatischen. Bevor Jugoslawien auseinander fiel, war das Serbokroatische noch eine Sprache, heute pochen Kroaten und Serben darauf, ihre eigenen Sprachen zu haben. Kapitel 5 Erst tausend, dann hundert, dann eine. Oder: Werden irgendwann alle Menschen die gleiche Sprache sprechen? Edward Maddrell kam 1877 auf der Isle of Man auf die Welt. Edward wollte schon von früh auf Fischer werden, er ahnte doch nicht, dass er eines Tages einmal in verschiedensten Büchern und Zeitschriften erwähnt werden würde. Edward Maddrell war ab 1962 der letzte Mensch, der die Sprache der Insel, Manx, als Muttersprache hatte. Als er 1974 starb, wurde Manx nicht mehr zu den lebenden Sprachen gezählt, sie war die einzige Sprache, die in Europa im 20.Jh. ausgestorben ist. Weltweit sterben laut Forschern 100 Sprachen auf der ganzen Welt pro Jahr aus. Sprachen sterben langsam Manx war 200 Jahre vor Edwards Geburt noch die gängige Alltagssprache auf der Isle of Man. Sie ist aus dem Keltischen hervorgegangen, einer der wichtigsten Sprachen in Europa vor Christi Geburt. Heute sind keltische Sprachen fast verschwunden. Das Bretonische in Frankreich wird nicht mehr als Alltagssprache verwendet. In Cornwall in England konnte sich das Keltische auch nicht gegen das Englische durchsetzen. In Schottland gibt es noch ca. 70�00 Menschen, die zumindest Schottisch-Gälisch lesen und verstehen können. In Irland wird das Gälische noch von einigen 10�00 Personen als Alltagssprache verwendet. Machtpolitik und Armut lassen Sprachen sterben Als sich das Englische Imperium im Mittelalter ausbreitete, wurde auch das Keltische vom Englischen verdrängt. Überall in Schottland, Irland, Cornwall und Wales sprachen die Verwaltungsbeamten nur noch Englisch. Dokumente mussten auf Englisch geschrieben werden, wer im Beruf erfolgreich sein wollte, musste Englisch können und Kinder wurden in der Schule fürs Keltisch sprechen bestraft. Dies sogar teilweise noch bis in die 1960er-Jahre. Auch in anderen Ländern passieren ähnliche Dinge, die Türkei kennt das Kurdische immer noch nicht an. Die Opfer des Christoph Kolumbus Die meisten Sprachen wurden in der Kolonialzeit zwischen dem 16.Jh und dem 19.Jh. vernichtet. Als Kolumbus Amerika 1492 entdeckte, gab es auf dem Amerikanischen Kontinent tausende verschiedene sprachen. Ein Grossteil ist allerdings bald ausgestorben, da die Sprecher ausgerottet wurden oder nur noch wenige von ihnen übrig blieben. Zwar konnten sich noch einige Sprachen z.B. in Peru halten, jedoch wird, um einen guten Job zu finden, Spanisch oder Englisch benötigt. Auch in Irland wurde die Gälische Sprache nach Missernten immer mehr verdrängt, viele Iren wanderten in die USA aus und mussten deshalb Englisch lernen. Auch in Nordamerika, Japan und Australien gibt es alte Eingeborenensprachen, welche akut vom Aussterben bedroht sind. Eine Sprache für alle? Während viele kleine Sprachen langsam aussterben, wachsen manche Sprachen kontinuierlich weiter. Mandarin-Chinesisch wird von über einer Million Menschen als Erst- oder Zweitsprache verwendet, Spanisch von 520 Millionen, Englisch von ca. 510 Millionen und zum Vergleich, Deutsch von 130 Millionen. Englisch hat aber als Geschäfts- und Wissenschaftssprache denn grössten Einfluss. Manche Sprachwissenschaftler glauben auch, dass Englisch eine Art Einheits-Weltsprache wird. Allerdings wird dass auch von vielen bezweifelt, da dann Englisch auch in den Chinesisch, Spanisch etc. sprechenden Ländern als Amtssprache durchsetzen müsste. Allerdings sind sich auch viele Forscher einig, dass in 100 Jahren nur noch ca. 600 Sprachen also etwa nur noch 10 der heute gesprochenen Sprachen noch erhalten sein wird. Katastrophe oder der Weg ins Sprachparadies? Wichtig ist bei Sprachwissenschaftlern nicht nur die Frage, wie viele Sprachen überleben werden, sondern auch, ob dies nun positiv oder negativ ist. Befürworter des Sprachensterbens argumentieren damit, dass eine einheitliche Sprache der Menschheit nutzen würde, denn so wäre die Kommunikation um einiges einfacher. Gegner halten das Sprachensterben für eine Katastrophe, bei der Kulturen und Wissen verloren gehen. Das Sterben lässt sich bremsen Es gibt auch Zeichen dafür, dass das Sprachensterben nicht unaufhaltsam ist. Nachdem das Baskische und das Katalanische in Spanien während der Franco-Diktatur systematisch unterdrückt wurde, wird es heute wieder tagtäglich und auch als Hauptsprache gesprochen. Dass sich verschiedene Sprachen aber nicht gegenseitig verdrängen müssen, zeigen Beispiele aus Afrika oder Asien. Z.B. in Nigeria, Gabun oder Kenia ist es nicht ungewöhnlich neben der Sprache aus dem Heimatdorf auch noch eine andere Staatssprache und eine ehemalige Kolonialsprache zu sprechen. Rettungsprogramme für Sprachen Während einige Sprachen wie das Katalanische keine Hilfe brauchten, um zu überleben und immer von mehreren 100000 Menschen gesprochen wurde, brauchen andere Sprachen aktive Hilfe um zu überleben. So z.B. das Irische. Nach der Unabhängigkeit Irlands von Grossbritannien 1922, wurde Irisch als Staatssprache eingeführt und Schulkinder mussten es ab sofort lernen. Auch die eigentlich ausgestorbene Sprache Manx wurde als Freiwahlkurs auf der Isle of Man für Schulkinder angeboten. Auch werden Treffen veranstaltet bei denen das Hauptthema die Sprache Manx ist. Kapitel 6 „Wer nicht so spricht wie ich, der stottert Oder: Gibt es Sprachen die wertvoller sind als andere? Für die alten Griechen war klar, dass das Griechische die einzige brauchbare Sprache war, um sich zu verständigen und somit auch die beste. Alle anderen wurden Barbaren genannt, Stotterer. Ähnlich sahen es auch die Römer, für sie war alles andere als Lateinisch unbrauchbar und unlogisch, mit der Ausnahme von Griechisch. Zudem soll sich Lateinisch besonders gut zum Verfassen literarischer oder philosophischer Texte geeignet haben. Wettstreit der Sprach-Verherrlicher Auch wenn das Römerreich längst untergegangen war, hielt sich die Vorstellung, dass Lateinisch die wertvollste Sprache war noch lange. Lateinisch blieb übers Mittelalter hinaus die Sprache der Wissenschaft in Europa und auch in der katholischen Kirche wurde Lateinisch noch lange verwendet. Doch bald galt Latein nicht mehr als wertvollste Sprache, da es ja keine Muttersprachler mehr gab, die den Titel für ihre Sprache in Anspruch nehmen konnten. Es brach ein Wettstreit aus, in dem viele Leute behaupteten, dass ihre Sprache die wertvollste sei. Bsp. S.70 Die Sprache Gottes oder die Sprache der Vernunft? Die meisten Gelehrten hielten Hebräisch für eine halbwegs göttliche Sprache, da dies die Sprache des Volkes Israels ist und dies ja von Gott auserwählt. So versuchten viele Forscher die Ähnlichkeit ihrer Sprache zum Hebräischen zu belegen. So z.B. der Franzose Père Thomassin, der behauptete, Französisch und Hebräisch wären sich so ähnlich, man könnte eigentlich von ein und derselben Sprache reden. Auch das Italienische und das Deutsche wurden von Forschern aus diesen Ländern als die wertvollste Sprache gesehen. Nach einem deutschen Forscher soll man als deutscher Muttersprachler weitergehende Gefühle und Gedanken verstehen können als andere und auch Sprachen besser erlernen als Muttersprachler der fremden Sprache. Auch englische Forscher dachten, Englisch sei sehr wertvoll und soll deshalb auch in den indische Kolonien als einzige Sprache eingeführt werden. Die Literatur des Englischen sei besser und wertvoller als diejenige aller Sprachen vor 3000 Jahren zusammen. Arroganz kennt keine Grenzen Vor allem wurden nicht nur Sprachen mit übermässigen Lob beglückt sondern auch andere vermeintlich weniger wertvolle Sprachen herabgewürdigt. Dies waren meist Sprachen aus den neu entdeckten Kolonien, welche von den Forschern als niedrig und unkultiviert empfunden wurden und sich nur für ganz grundlegende Verständigung eignete. Als man jedoch anfangs des 19.Jh. anfing mit Wissenschaftlichen Methoden vorzugehen, hörte man bald auf, eine überlegene Sprache zu finden. Wer hat die meisten Laute? Wer die meisten Wörter? Wer die meisten Fälle? Man kann die Sprachen allerdings noch vergleichen. Das Russische z.B. hat ganze 6 Fälle, das Deutsche 4, Italienisch und Spanisch kommen ohne Fälle aus. Ist das Russische darum wertvoller als das Italienische? Ein anderes Beispiel ist die Anzahl Laute einer Sprache. Im Xu, das im südlichen Afrika gesprochen wird, gibt es 141 Laute. Die Rotokas-Sprache auf Neu-Guinea hat nur 11. Im Deutschen gibt es 38. Noch einmal ein anderes Beispiel ist die Anzahl Wörter einer Sprache. Englisch gilt als Sprache mit den meisten Wörtern. Nach verschiedenen Zählungen 600�00 – 800�00. Im Deutschen gibt es zwischen 300�00 und 500�00. Im Französischen „nur 100�00. Allerdings ist die Anzahl der Wörter einer Sprache für den Alltag ziemlich unbedeutend. Für ein durchschnittliches Alltagsgespräch reichen 400 – 800 Wörter. Mit 2000 Wörtern lässt sich so ziemlich jede Situation bewältigen. Abschied von der Arroganz Unter Sprachforschern gibt es heutzutage kaum noch jemand, der eine Sprache für wertvoller oder höher hält als eine andere. Dieses Denken sei zwar weit verbreitet, allerdings entzieht es sich jeder sprachwissenschaftlichen Grundlage, sagt der britische Sprachforscher David Crystal. Kapitel 7 Gegen Französisch, Englisch und überhaupt alles Fremde Oder: Lässt sich der Einfluss anderer Sprachen zurückdrängen? Im 17.Jh. richtete sich ganz Europa nach dem Sonnenkönig Louis XIV. Die Reichen und berühmten trugen die gleiche Mode wie am Hof von Versailles und man versuchte möglichst viel die französische Sprache zu verwenden. Auch in Deutschland. Anstatt deutscher Worte brauchte man möglichst viele französische in einem Satz und auch Latein wurde in die Alltagssprache eingebaut. Um einen feineren Eindruck zu machen, konnte man auch den eigenen Namen in Latein übersetzen. So wurde aus Müller Molitor, aus Bauer Agricola. Die Freunde der deutschen Sprache schlagen zurück Doch längst nicht alle waren über diese Sprachweise begeistert. Es entstand eine Gegenbewegung gegen die Lebensart aus Paris, die „welsch genannt wurde. Neben dem Schreiben von Spottgedichten taten sich im Jahre 1617 verschiedene deutsche Dichter zur Fruchtbaren Gesellschaft zusammen. Das Ziel dieser Vereinigung war die Reinhaltung der hochdeutschen Sprache. Doch anstatt nur zu klagen, entwickelte die Gesellschaft auch neue Wörter für Begriffe, für welche es bis jetzt nur lateinische und französische gab. So wurde aus Detail die Einzelheit, aus dem Parterre das Erdgeschoss und aus dem Universum das Weltall. Einige neue deutsche Wörter haben die alten Wörter sogar fast restlos verdrängt, wie z.B. Durchmesser statt Diameter und Selbstmord anstelle von Suicidium. Bei anderen Ausdrücken hatte sie doch weniger Erfolg: Süsschen anstatt Bonbon oder Lotterbett anstatt von Sofa konnte sich nicht durchsetzen. Genau so wenig die Neuschöpfungen für Lehnwörter, die es schon seit hunderten von Jahren in der deutschen Sprache gibt, wie z.B. Zitterweh anstatt Fieber oder Tageleuchter anstatt Fenster. Die Zeit der Akademien Doch die Deutschen des 17 18.Jh. standen mit ihrer Sorge um ihre Muttersprache nicht alleine da. In Frankreich, Italien und Spanien gab es sogar staatliche Akademien, die für die Reinhaltung der Sprache zuständig waren. In Spanien und Frankreich war es leicht, die Akademien zum Oberhaupt über die Sprache zu erklären, denn dort herrschte ein total absolutistischer König. In Deutschland war das schwieriger. Es kam erst 1885 zur Gründung einer Sprachakademie unter Wilhelm I., da vorher die verschiedenen Kleinstaaten niemals einer Sprachakademie zustimmten, die nicht in ihrem Staat aufgebaut wurde. Durch den Allgemeinen Deutschen Sprachverein wird heute in Deutschland nicht mehr vom Passagier, dem Perron oder dem Velo sondern vom Fahrgast, dem Bahnsteig und dem Fahrrad gesprochen. Sprachpflege in der Gegenwart – Gemässigte gegen Eiferer Nach dem 2. Weltkrieg wurde in Deutschland das Thema der Reinhaltung der Sprache zuerst einmal vernachlässigt. Die 1947 gegründete Gesellschaft für deutsche Sprache und die 1949 gegründete Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung führten ein recht beschauliches Leben. Doch in den letzten Jahren erlebt dieses Thema wieder einen kleinen Aufschwung. 1997 wurde der Verein Deutsche Sprache gegründet und im Jahre 2007 wurde die Fruchtbare Gesellschaft neu gegründet. Zum Ziel setzte sie sich, überflüssige Anglizismen aus dem Deutschen zu schaffen. Sie verleiht jährlich den Titel „Sprachpanscher des Jahres. Mit Gesetzen gegen Fremdwörter? Der frühere Innensenator von Berlin, Eckart Wertebach, glaubt, dass die „Verenglischung des Deutschen nur mit einem Gesetz gestoppt werden kann. Als Vorbild dafür nahm man ein Gesetz, das Frankreich 1994 verabschiedet wurde. Es verbietet Firmen Gebrauchsandweisungen oder Verträge auf eine andere Sprache ausser Französisch zu formulieren. Das Gesetz wird von der Regierung als Erfolg bewertet. Zudem kam es durch das Gesetz zu verschiedenen Wort-Neuschöpfungen: logiciel anstatt software, vélo tout terrain anstatt mountainbike. In Deutschland scheint ein solches Gesetz jedoch eher unwahrscheinlich. Kapitel 8 Das grosse Rätsel der Sprachwissenschaft Oder: Warum verändern sich Sprachen? In der Redaktion des Wahrig-Wörterbuchs konnte ein Erfolg verzeichnet werden. Die Sprachdetektive haben ein neues Wort dingfest gemacht, „schwächeln heisst es. Noch vor ein paar Jahren wurde das Wort noch nicht benutzt. Die Wörterbuchredaktion ist ständig auf der Suche nach neuen Wörtern. Dafür werden rund 500 Millionen Wörter von Spezialisten von der Universität Saarbrücken untersucht. Computer suchen nach neuen Wörtern oder schauen nach, ob vielleicht ein altes Wort neu verwendet wird, zudem filtern sie heraus, ob eventuell ein altes Wort nur falsch geschrieben wurde. Wenn dann tatsächlich ein neues Wort gefunden wurde, kommt es zuerst einmal in Beobachtung. Erst wenn sich die Fachleute sicher sind, dass das Wort auch in den alltäglichen Sprachgebrauch aufgenommen wurde, kommt es auch ins Wörterbuch, was Jahre dauern kann. Modebegriffe, wie z.B. der „Elchtest die zwar für eine Zeit lang sehr häufig genutzt werden, dann aber schnell wieder in Vergessenheit geraten, kommen nicht ins Wörterbuch. Solche Wörter werden von den Fachleuten „Leichen genannt. Sprachen ändern sich ständig Das Wort Team wurde in der Schweiz, Österreich und Deutschland nahtlos in den alltäglichen Gebrauch übernommen. So entstanden aus Team zusammen mit uralten deutschen Wörtern Begriffe wie Teamarbeit, teamfähig etc. Genau so wurden auch englische Verben ans deutsche Konjugationssystem angepasst. „Hast du das Glas schon recycelt? Dies ist die häufigste Art des Sprachwandels, das Übernehmen von neuen Wörtern aus anderen Sprachen. Schon die Wörter Fenster (von fenestra) und Socke (von soccus) kamen als Lehnwörter aus dem Lateinischen ins Deutsche. Gerade bei diesen Begriffen würde man niemals denken, dass dies nicht urdeutsche Wörter sind. Lehnwörter werden vor allem für Dinge verwendet, welche in der Sprache nicht vorhanden oder bekannt waren, so war z.B. die römische Socke für die Germanen völlig unbekannt. Auch das Wort Zucker kam vom arabischen Wort „sukkar über das italienische Wort „zucchero ins Deutsche. Ausländische Phantomwörter Teilweise werden bei uns aber Gegenstände auch mit Worten aus anderen Sprachen beschrieben, die es so in der jeweiligen Sprache gar nicht gibt. So z.B. das Wort Handy für Mobiltelefon. Im Englischen ist ein Mobiltelefon aber ein „mobile phone oder ein „cellular phone. Handy heisst im Englischen lediglich handlich oder geschickt. Auch im Französischen gibt es das Phänomen. Für das Wort „Jogging wie es im Deutschen und Englischen benutzt wird, gibt es in Frankreich das Wort „footing. Footing ist im Englischen jedoch das Fundament eines Hauses. Kreativer Austausch Doch auch in anderen Sprachen gibt es Lehnwörter aus dem Deutschen. So z.B. rucksack oder kindergarten, welche in Grossbritannien und Amerika, aber auch in anderen Ländern verwendet werden. Es ändern sich aber nicht nur die Wörter einer Sprache, sondern auch die Art wie sie verwendet werden. Während früher etwas „Sinn ergeben oder „Sinn gehabt hat, „macht heute etwas Sinn, genau wie im Englischen „It makes sense. Genau so „Ich erinnere es anstatt „Ich erinnere mich daran, wie im Englischen „I remember it. Aus Alt mach Neu Wo früher Latein geredet wurde, fanden die Menschen es bald nicht mehr passend, cantabo (ich werde singen) zu sagen. Sie sagten lieber cantare habeo (ich habe zu singen), doch dies war den Menschen zu lange und deshalb wurde es zu cantero im Italienischen, cantare im Spanischen und chanterai im Französischen. Doch egal ob in England, Frankreich oder Deutschland, vor 1000 Jahre hätte man die Vorfahren wohl kaum verstanden. Die Sprachen haben sich zu stark verändert. Im Deutschen wurde z.B. aus einem (dat)am Wortende mit wenigen Ausnahmen ein (das,dass). Oder aus einem am Ende ein ch (ik- ich). Aus dem uo in muotin wurde ein ü und aus dem ein e. Heute heisst es mühten. Diese Lautänderungen passierten meist nach den gleichen Regeln, deshalb konnten Forscher schon im 19.Jh. Lautgesetze formulieren. Altsächsich Althochdeutsch Neuhochdeutsch wird zu opan offan offen wird zu etan ezzan essen wird zu ch makon mahhon machen Diese Gesetze haben doch etwas an sich, nämlich dass man sich nicht an sie halten muss. So gab es im Englischen die Änderung von opan zu offen nicht (open). Genau so auch die Wörter eat und make. Fragt sich nur: Warum? Es ist also relativ einfach zu beschreiben, wie und was sich in einer Sprache verändert hat. Schwieriger wird es allerdings bei der Frage „Warum?. Die meisten Forscher fangen dann an, sich um die Frage herumzudrücken. Lange Zeit haben Forscher die verrücktesten Ideen entwickelt warum die Sprachen sich nun so verändert haben. So dachten manche, dass Laute wie p, und Laute sind, bei welchen beim Erzeugen die Luft gegen eine Barriere knallt, welche von Lippen, Gaumen oder Zunge gebildet wird. Die freiheitsliebenden Deutschen wollten dies aber nicht mehr länger akzeptieren und liessen die Luft nun frei strömen. Also entstanden Laute wie f, und ch. Eine andere Theorie behauptete, dass die Bewohner von Bergregionen viel stärker ein- und ausatmen. Deshalb durchbrechen die Bergbewohner also Verschlusslaute wie p, und k. Und tatsächlich, im Norden Deutschlands werden die Verschlusslaute immer noch gebraucht. Heutzutage gelten solche Theorien allerdings als Schwachsinn, denn auch ausserhalb von Bergregionen ändern sich Sprachen ständig. Warum verändern, was gut funktioniert? Das Hauptproblem bei der Suche nach dem „Warum? ist eine einfache Gedankenskette. Unsere Vorfahren haben mit ihrer Sprache erreicht, was zu erreichen war. Sie konnten sich verständigen. Doch warum haben sie die Sprache nun verändert? Bei der Prägung neuer Begriffe sieht die Sache noch sehr einfach aus. Als das Mobiltelefon eingeführt wurde, war das Wort Mobiltelefon zum umständlich oder nicht schick genug für Werbefachleute. Also kam das Wort Handy auf. Es war handlich und klang Englisch. Und Englisch hat für moderne Deutsche einen guten Klang. Alles einfacher? Doch die Sprache ändert sich nicht nur durch das Einführen neuer Wörter. Auch die Grammatik und die Aussprache ändert sich. Dort wird meist eine Vereinfachung als Grund angegeben. So wurde den Nachfahren der Römer das Deklinieren mit 6 verschiedenen Fällen zu mühsam. Deshalb wurden die Fälle abgeschafft und durch Präpositionen ersetzt. So wurde aus linguae (Genitiv) im Italienischen della lingua und im Spanischen de la lengua. Das sind zwar mehr Wörter, jedoch muss man sich keine Deklinationen mehr merken. Es ist also einfacher und deshalb auch logisch. Auch im Englischen wurden Fälle abgeschafft. So gab es im Altenglischen nicht nur einen Genitiv(scipes heute ships) sondern auch einen Dativ (scipe). Heutzutage ist dieser vollkommen unbekannt. Im Deutschen wird derweil der Genitiv langsam abgeschafft. „Er ist Vater dreier Kinder wird durch den Dativ ersetzt „Er ist Vater von drei Kindern. Und auch das Verbsystem wird vereinfacht. Starke Verben werden meistens so gebeugt wie man es von schwachen Verben kennt. schob - schnaubte, frug - fragte. Auch der Konjunktiv wird immer seltener in der Alltagssprache. Weniger ist mehr? Als eine Art Naturgesetz galt es lange Zeit auch, das die Aussprache über Jahrhundert langsam verschleift. Die Spanier machten aus habent (lat. Sie haben) han, ähnlich wie im derzeit im Deutschen haben - ham Wie schnell das passiert und ob sich eine Änderung durchsetzt, ist jedoch unklar. Die Wörter bist du und hast du, werden schon seit langem verschmolzen, früher aber war es sogar üblich, bistu und hastu in der Schriftsprache zu schreiben. Einzelne Buchstaben werden beim sprechen also schnell mal weggelassen. Allerdings zeigen vor allem Kinder, dass man auch mit dem Weglassen ganzer Wörter gut zurecht kommt. „Kann ich einen Kaffee anstatt „Kann ich einen Kaffee haben. So ist es vielleicht in 50 Jahren üblich, dass das Verb haben weggelassen wird. Manches wird auch komplizierter Doch nicht überall wird vereinfacht. Die Franzosen haben ihr aujourdhui, während die Italiener oggi, die Spanier hoy sagen was beides auf hoc diem (lat) zurückgeht. Aujourdhui geht allerdings auf ad diurnum de hoc diem zurück, was am Tage dieses Tages heisst. Auch das Zählen ist auf Französisch schwerer, sie haben z.B. 80 nicht von octoginta (lat) abgewandelt, sonder zuerst multipliziert und haben so quatre-vingt bekommen, was etwa soviel heisst wie vier mal zwanzig. Zudem gibt es noch die Metathese, so wird das Phänomen genannt, wenn die Italiener cocodrillo und die Spanier cocodrilo sagen, auch wenn es im Lateinischen crocodilus heisst. Dies zeigt, dass die Menschen also auch ganz gerne mit ihrer Sprache spielen. Wenn ihnen das Ergebnis ihres Spielen gefällt bleiben sie auch dabei. Die Kinder als Motor der Sprachentwicklung? Die Sprache ändert sich also auch durch spielerisches Ausprobieren. Das legt nahe, dass vor allem Kinder zum Sprachwandel beitragen. Kinder sprechen z.B. ihren Spielkameraden Florent immer wieder mit Frolent an. Sie begreifen gar nicht, dass die eigentlich falsch ist und machen weiter. Erwachsene kämen jedoch nie mehr auf die Idee eine solche Metathese zu verwenden. Ähnlich könnte es auch mit dem Wort cocodrillo oder cocodrilo abgelaufen sein. Zudem waren früher Kinder den Erwachsenen zahlenmässig überlegen und deshalb hätte dies gut passieren können. Früher wurden Kinder wahrscheinlich auch nicht immer von Lehrern und Eltern verbessert wenn sie etwas falsch sagten. Es gab auch keine Bücher oder Fernseher, die überregional verbreiteten, wie Sprache klingen und aussehen musste. Man war also toleranter. Das gleiche gilt für die Aussprache, wenn heute ein Kind lispelt wird es sofort in die Logopädie geschickt. Im südlichen Spanien, stört sich jedoch kaum jemand dran, das Lispeln gehört dort zur Norm. Doch vor Jahrhunderten war dies auch noch nicht so, es wurde noch nicht gelispelt, doch irgendwann haben sich die Lispler durchgesetzt. Doch die alleinigen Sprachwandler sind die Kinder auch nicht. Es gibt auch noch die kreativen Köpfe, welche immer neue Redensarten und Wörter ausdenken. Z.B „Weichei. Irgendjemand, der gerne bildlich spricht, benutzt diesen Begriff um jemand zu ärgern. Der Begriff verbreitet sich und etabliert sich irgendwann in der Sprache. Doch warum die Menschen Neues ausprobieren ist noch nicht geklärt. Doch in den letzten Jahrzehnten haben sich Thesen herauskristallisiert, welche einigermassen plausibel erklären, warum wir nicht mehr so sprechen wie vor 1000 Jahren. Nur meine Leute sprechen so wie ich Da wäre als erstes der Zusammenhalt in der Gruppe. Wer z.B. in einem Land ausgeraubt wird, von welchem er die Sprache nicht versteht, ist froh wenn er jemanden findet, welcher die eigene Sprache spricht. Er ist aber froher wenn er einen Muttersprachler trifft und wenn er sogar jemanden trifft, der den selben Dialekt hat, ist er sehr froh. Gleich Sprache und gleicher Dialekt schaffen Nähe und Vertrauen. Der britische Sprachforscher Robin Dunbar glaubt, dass Menschen genau aus diesem Grund neue Dialekte und neue Sprachen entwickelt haben, um zu sehen, wer zu ihnen gehört und wem sie vertrauen können. Seine Gedankenkette verläuft so: Früher als die Menschen noch in kleinen Siedlungen lebten, reisten sie nicht weit, um zu heiraten. Man heiratete im Dorf und schlussendlich waren alle Dorfbewohner mehr oder weniger miteinander verwandt. Um nun entfernte Verwandte von Zugereisten zu unterscheiden und zu sehen wem man nun eher vertrauen konnte, musste man einen eigenen Dialekt entwickeln. Um dies zu tun musste man die Sprache abwandeln. Ähnlich geht es heutzutage im Arbeitsleben zu. Verschiedene Berufsgruppen haben verschiedenes Vokabular. Dieses zeigt, welchen Beruf man ausübt. Abwechslung macht interessant Wenn ein Manager allerdings vor seinen Kollegen aber Worte wie Meeting, Tools etc benutzt, will er nicht nur anerkannt werden, er will auch, dass man ihm zuhört. Wenn er Wörter und Sätze also anders gestaltet schafft er dies. Es wundert also nicht, dass Wörter im Alltag ihre Bedeutung ändern und sich neue Wörter einbürgern. So wurde schwächeln zuerst nur im Sportjargon verwendet, allerdings kann heute auch der Börsenkurs schwächeln und ein Kollege nach 3 Bier. Vorhersage unmöglich Die Sprachentwicklung hat also viel mit Ausprobieren und Herumspielen zu tun. Manchmal bleibt erhalten was einfacher ist und manchmal was dem Menschen mehr gefällt. Eine logisch zwingende Richtung gibt es nicht. Doch dass eine Sprache sich nicht immer nach der Logik richtet, zeigt auch, dass es zum Teil Wortlücken in einer Sprache gibt. So gibt es im Deutschen kein Gegenteil zu durstig. Auch versuche scheiterten, denn neue Wörter bewusst einzuführen gelingt fast nie. Kapitel 9 Eine Erfindung wichtiger als Rad und Feuer Oder: Seit wann schreibt der Mensch? In einem Film über den Wilden Westen sind die Indianer völlig verblüfft, als zwei Weisse ihre Gedanken ohne mit einander zu sprechen über ein Stück Papier austauschen. Die zwei Weissen haben ihre Gedanken aufgeschrieben. Für die Indianer, welche noch nie etwas von Schrift gehört haben, ist dies pure Zauberei. Heutzutage gehört die Schrift in jedem Land der Erde zu den alltäglichen Dingen. Ohne sie könnte keine Gesellschaft mehr existieren. Die Schrift gibt es zwar noch nicht so lange wie das Rad oder das Feuer, dennoch ist sie nicht minderwichtig. Lange Zeit ging es aber vergessen, wie die ersten Anfänge der Schrift ausgesehen haben. Erst im 19. Und 20. Jh. gelang es, frühe Dokumente zu entziffern. So konnten sich die Gelehrten ein Bild machen, wie sich die Kunst des Schreibens entwickelt hat. Ein bedeutender Fund in der Wüste Besonders rätselhaft galten lange Zeit die Hieroglyphen, eine der ältesten Schriften der Menschheit. Vor 5400 Jahren fingen die Ägypter an, verschieden Symbole aufzuschreiben. Den ersten grossen Durchbruch machten französische Soldaten 1799 indem sie einen grossen Granitstein in der Nähe der von ihnen Rosette genannten Stadt fanden. Auf der Vorderseite war in 3 verschiedenen Schriften eine Inschrift eingemeisselt, nämlich in alte Hieroglyphen, in vereinfachten Hieroglyphen, der demotischen Schrift und in Griechisch. Durch diesen Stein war die Entzifferung der alten Hieroglyphen greifbar nahe. Die einzelnen Hieroglyphen standen jedoch nicht immer für ein ganzes Wort, sie konnten auch für einzelne Silben stehen. Was sie nun bedeuteten war deshalb erst einmal weiter rätselhaft. Ein ehrgeiziger Forscher Der 1790 geborene Franzose Francois Champollion konnte bereits im Alter von 9 Jahren antike Werke in Latein lesen. Auch interessierte er sich für Hieroglyphen und machte es sich zum Ziel dieses Rätsel zu lösen. Er studierte den Stein von Rosette und andere Inschriften auf Obelisken. Anderen Sprachforscher fiel in der Zwischenzeit auf, dass auf Obelisken bestimmte Zeichenfolgen durch ein Oval umrundet wurden (Kartuschen). Es kam die Vermutung auf, dass es sich dabei um die Namen der Pharaonen handeln könnte. In dem Champollion die Namen der Königin Kleopatra, von der die Kartusche bekannt war, mit dem auf dem Stein von Rosette eingemeisselten Hieroglyphen für Ptolemaios verglich, erkannte er, dass einzelne Hieroglyphen nicht immer für ein Wort oder eine Idee stand, sonder auch für einzelne Buchstaben stehen konnten. Vor allem für das Buchstabieren von ausländischen Namen verwendeten die Ägypter diese Möglichkeit. Champollion forschte weiter und entdeckte auch, dass die Hieroglyphen unterschiedliche Funktionen haben konnten. Ein Auge konnte tatsächlich ein Auge bedeuten, ein krummer Stab stand aber für Herrscher, da die Pharaonen einen solchen hatten. Eine Hieroglyphe konnte aber auch einen einzelnen Laut darstellen, z.B. ein Halbkreis, der ein Laib Brot darstellen sollte, ein t. Und schliesslich konnte eine Hieroglyphe eine andere besser deutbar machen. Diese Determinative zeigten z.B. dass ein Arm jetzt tatsächlich ein Arm oder etwas anderes bedeuten sollte. Eine Wurzel mit vielen Verzweigungen Die Hieroglyphen waren jedoch für den Alltag untauglich. Sie waren schwer zu schreiben und zu lesen und eigneten sich deshalb nicht für das Verfassen von schnellen Nachrichten. Doch dafür waren sie zuerst auch nicht gedacht, sonder für das Rühmen von Pharaonen in der Öffentlichkeit etc. Doch die Ägypter erkannten bald, dass eine Schrift für den Alltag ungeheuer praktisch war. Sie entwickelten deshalb die so genannte hieratische Schrift, welche einfacher zu schreiben und zu lesen war. Bücher auf Tontafeln Vor etwa 5000 Jahren begannen die Sumerer, eine Hochkultur im heutigen Irak, eine Schrift zu entwickeln, die man Keilschrift nennt. Die Sumerer waren fleissige Geschäftsleute und um ihren Handel besser zu organisieren, entwickelten sie die Keilschrift, bei der jedes Zeichen aus mehreren keilförmigen Elementen bestand. Zu Anfang versuchten die Sumerer auch Figuren nach zu ahmen, die es in der Wirklichkeit gab, doch bald verwendeten sie die Zeichen für einzelne Silben. Auch die Babylonier und die Assyrer übernahmen die Keilschrift. Die Keilschrift hielt sich rund 3000 Jahre lang und wurde erst etwa um Christi Geburt von einem System verdrängt, das leichter handhabbar war. Die Erfindung des Alphabets Auch andere Völker im heutigen Israel und Libanon entwickelten die Schrift weiter. Vor allem die Phönizier taten sich hervor. In ihrer Schrift, standen die einzelnen Zeichen nicht für Wörter oder Sätze, sondern für einzelne Laute. Die phönizische hatte jedoch keine Vokale, da die Phönizier sie für unnötig hielten. Die griechischen Nachbarn machten noch einen Schritt mehr und fügten auch Vokale ein, da sie der Meinung waren, dass die Schrift mit Vokalen deutlich einfacher zu lesen war. Ihre Schrift begann mit dem Buchstaben Alpha und wurde deshalb Alphabet genannt. Diese Idee fanden wiederum die Römer gut und änderten die Schrift um, bis sie schliesslich das lateinische Alphabet hatten, das heute am weitesten verbreitet ist. Das klingt nicht nur chinesisch, das liest sich auch so Ägypter und Griechen waren jedoch nicht die einzigen, welche vor Jahrtausenden anfingen, ihre Gedanken aufzuschreiben. Auch die Chinesen fingen vor 4000 Jahren damit an. Unklar ist jedoch, ob die Chinesen über Unwege von den Ägyptern dazu angeregt wurden oder umgekehrt. Die Chinesen fingen an, Bilder zu malen um Worte festzuhalten. Doch die Zeichen änderten sich und bald konnte man nicht mehr auf den ersten Blick erkennen, was ursprünglich damit gemeint war. Zudem wurde aus der Wortschrift eine Silbenschrift, was der chinesischen Sprache sehr entgegenkam, da sie vor allem aus einsilbigen Worten besteht, die unterschiedlich betont werden. Chinesische Schriftzeichen bestehen also meist aus zwei Elementen. Ein Element macht klar um was es geht und das andere zeigt, wie es betont wird. Das Wort „Mutter wird z.B. mit dem Zeichen für Frau und einem Zusatz der die Aussprache angibt gebildet. So kann die Grundsilbe „ma auf 10 verschiedene Weisen betont werden und immer etwas anderes bedeutend, z.B. Pferd, Hanf oder schimpfen. Um die Sprache also wieder zu geben sind viele verschiedene Zeichen nötig. Vor 300 Jahren liess ein Kaiser ein Wörterbuch herstellen, in dem 50�00 Zeichen aufgelistet sind. Heute besteht der Grundwortschatz aus ca. 2000 bis 4000 Zeichen. Wer eine Universität abschliesst, beherrscht normalerweise ca. 10�00 Zeichen und ein Professor ca. 20�00. Deshalb gab es immer wieder Bemühungen, das lateinische Alphabet in China einzuführen, was jedoch auf heftigen Widerstand traf, da die Zeichenschrift schon seit Jahrtausenden in der chinesischen Kultur verankert ist. Die komplizierteste Schrift der Welt Nicht nur in Europa übernahmen Völker oft die Schrift ihrer Nachbarn, auch die Japaner übernahmen vor 1500 Jahren die chinesische Schrift. Doch die chinesische Schrift, die sie Kanji nannten, passte nicht recht zur japanischen Sprache. Deshalb ergänzten sie sie mit Silbenzeichen. Diese wurden Kana genannt, die sich wiederum in Hiragana und Katakana unterteilen. Zudem gibt es in japanischen Texten auch immer wieder lateinische Buchstaben, die Romanji genannt werden. Wegen dieser Mischung gilt das Japanische als komplizierteste Schrift der Welt. Japanische Schüler brauchen also deutlich länger um Lesen und Schreiben zu lernen, als europäische Kinder. Es gibt auch Berichte aus den 50er-Jahren, dass die Selbstmordrate bei Schülern deutlich stieg, als das Schrift-Lernpensum erhöht wurde. Doch die komplizierte Schrift hat nicht verhindert, dass Japan zu einer grossen Wirtschaftsmacht aufgestiegen ist. Europäische Kenner der Sprache sagen sogar, dass sich ein Text in Kanji schon im Überfliegen recht gut zusammenfassen lässt. Auch hat sie nicht verhindert, dass japanische Firmen auf dem Computermarkt gross geworden sind, deren Tastaturen ja weltweit mit lateinischen Zeichen ausgestattet sind. Man verwendete einfach eine lateinische Umschrift für das japanische oder schrieb gleich auf Englisch. Auch wir schreiben mit Bildern Viele Völker in Asien schreiben heute also noch mit Zeichen, die auf Bilder zurückgehen. Doch auch das lateinische Alphabet geht auf Bilder zurück, was sich an einigen Stellen noch erkennen lässt. Der Buchstabe kam vom phönizischen Alef über das griechische Alpha ins lateinische Alphabet. Ursprünglich wurde das Alpha auf dem Kopf geschrieben. Alef bedeutete auf Phönizisch Ochse. Die zwei Hörner kann man also gut erkennen. Das ist jedoch nicht der einzige Buchstabe, der immer gedreht wurde, auch das E, und wurde immer wieder gedreht. Denn lange Zeit war es egal in welche Richtung man lesen sollte. Die Griechen schrieben manchmal auch von Rechts nach Links. Sie verwendeten sogar die Bustrophedon-Schrift, das heisst, man schrieb auf einer Zeile von Links nach Rechts und dann wechselte man von Rechts nach Links und so weiter. Deshalb ist es kein Wunder, dass verschiedene Zeichen immer wieder ihre Ausrichtung änderten, bevor sie endgültig stehen blieben. Doch das Wechseln zwischen normaler und Spiegelschrift scheint dem Menschen im Blut zu liegen. Vor allem bei Schreibanfängern sieht man oft, dass Buchstaben verkehrt geschrieben werden. Die Entwicklung steht nicht still Doch obwohl die Römer schon vor 2000 Jahren das lateinische Alphabet so gut wie zu Ende entwickelt haben, steht die Entwicklung nicht still. Im Mittelalter entwickelten die Mönche die Kleinbuchstaben, die Minuskeln. Eine weitere Revolution war die Erfindung des Buchdrucks im 15.Jh Johannes Gutenberg kam auf die Idee, Buchstaben einzeln in Metall zu giessen und diese immer so zusammenzustellen, wie man sie gerade braucht. Vorher wurden ganze Texte mühsam in Holzgeschnitzt. Ähnliche Ideen gab es in China und Korea zwar schon lange, doch gilt Gutenberg als Erfinder des modernen Buchdrucks, denn er hatte den Vorteil, dass das lateinische Alphabet nur aus wenigen Zeichen besteht. Darauf gaben sich künstlerische und handwerklich begabte Menschen Mühe unterschiedliche Schriften zu erfinden. Von Zauber und Geheimkunst zur alltäglichen Kulturtechnik Die Schrift hat einen langen Weg zurückgelegt von den mühsam gemeisselten Hieroglyphen zu schnell verfassten E-Mails etc. Noch in den 50er-Jahren war es mühsam von Hand oder mit der Schreibmaschine eine Text zu verfassen. Heutzutage hat sie ihren Siegeszug mit den Milliarden von E-Mails angetreten. Schreiben ist in den heutigen Industrienationen fast genau so wichtig wie Sprechen. Kapitel 10 Orthographie, Orthografie, Ortografie, Ortografi, ortografi. Oder: Warum sich Deutschland mit einer Rechtschreibreform so schwer tut Wegen der Rechtschreibrefom im Deutschen haben sich kluge Köpfe in Deutschland heftig gestritten. Man teilte sich in zwei Lager und beschimpfte sich. Es stellt sich die Frage warum es so schwer ist, die Rechtschreibreform so festzulegen, dass alle zufrieden sind. Erstes Hindernis für eine Rechtschreibreform: Es reden furchtbar viele mit Die Mitglieder der Königlichen Akademie in Spanien hatten es einfach. Sie konnten festlegen wie Spanisch geschrieben wurde, da sie unter dem Schutz des Königs standen. Sie konnten festlege, was klein geschrieben wurde und das man „filosofia schreibt. Im Deutschen galt jedoch schon damals, dass man Philosophie mit ph schreibt, denn die Philosophie kommt aus Griechenland und deshalb schreibt man es mit ph. In Italien hat die Accademia della Crusca schon 1582 angefangen, festzulegen, wie denn Italienisch geschrieben wird. Obwohl Italien damals aus vielen kleinen Herrschaftsbereichen bestand, genoss die Akademie bald schon grosses Ansehen. Niemand in Italien wagte es, sie zu kritisieren. Auch nicht beim Beispiel „tradizione. Im Lateinischen hätte man „traditione geschrieben, doch man spricht es „tradizione aus, also schreibt man es auch so. Im Deutschen beharrt man jedoch auf dem „ti in Tradition. Im Deutschen war dies auch von Anfang an viel schwieriger. Denn in Deutschland gab es keine Akademie. Zudem wurde Deutsch schon damals in vielen verschiedenen Staaten gesprochen. Und auch Deutschland war in viele kleine Königreiche und Fürstentümer unterteilt. Und auch heute ist das noch so. Die Schweiz und Österreich treffen ihre Entscheidungen selbst, Belgien und Luxemburg reden auch mit. Zweites Hindernis für eine Rechtschreibreform: Der richtige Zeitpunkt ist längst verpasst Die Sprachakademien in Spanien, Italien etc hatten auch einen weiteren Vorteil gegenüber den Deutschen. Als sie anfangs des 18.Jh. festlegten wie die Worte geschrieben wurde, interessierte es kaum jemanden, da noch nicht viele Leute schreiben konnten. Anders war das in Deutschland in den 80er-Jahren. In Deutschland entwickelten sich unterschiedliche Schreibweisen. Die Grossschreibung von Hauptwörtern war z.B. nichts Weiteres als eine Mode. Goethe hielt sich nicht an Regeln, sondern schrieb die Worte gross, die er für wichtig hielt. Und was er für wichtig hielt, liess er sich sicherlich nicht von jemandem vorschreiben. Doch dass es keine Regeln gab, war für den Buchdruck von Nachteil. Im 19.Jh. gab es deshalb zahlreiche Bemühungen, die Grossschreibung abzuschaffen, um das Lesen und das Schreiben einfacher zu machen. Jacob Grimm und sogar Konrad Duden, der Gründer des Dudenverlags, hielten die Grossschreibung für unnötig. Als im späten 19.Jh. die Regeln festgelegt wurden, gab es bereits so viele Texte mit Grossschreibung, dass man dabei blieb. Auch an Konferenzen 1876 und 1901 blieb man dabei. Doch auch weiterhin gab es Forderungen, die Kleinschreibung einzuführen, jedoch ohne Erfolg. Auch eine andere Eigenheit des Deutschen liess sich nicht mehr rückgängig machen. Nämlich die grosse Vielfalt, lange Vokale schriftlich wieder zu geben. So gibt es für ein langes „a mehrere Möglichkeiten, nämlich Saat, Naht und Tat. Versuche, dies anzugleichen, scheiterten 1988 und 2005. Drittes Hindernis für eine Rechtschreibreform: Die deutsche Sprache ist nicht logisch – und ihre Schreibung kann es wohl auch nicht sein Auch ein weiterer Grund erschwert die Rechtschreibreform. Im Deutschen werden häufig Wörter zusammengeklebt. So entsteht z.B. aus Schiff und Fahrt Schifffahrt. Doch dies galt vor einiger Zeit noch als hässlich. Also erfand man Regeln, dass der gleiche Buchstaben höchstens 2-mal nach einander vorkommen darf. Es hiess dann also Schiffahrt. Doch bei einigen Worten galt auch das als hässlich. Also gab es eine Ausnahme der Regel: Der gleiche Buchstabe darf drei Mal nacheinander vorkommen, wenn darauf ein Konsonant folgt. Z.B. Sauerstoffflasche. In anderen Sprachen existiert dieses Problem nicht, dort werden die Worte einfach getrennt stehen gelassen. Auch die Schwierigkeiten, welche durch das Getrennt- oder Zusammenschreiben von Verben entstehen, sind im Deutschen typisch. So gab es Streitigkeiten, ob man nun radfahren oder Rad fahren schreiben soll. In England z.B. ist dies kein Thema, die Fortbewegungsart wird in viele Worte zerlegt: to ride bike etc. Viertes Hindernis für eine Rechtschreibreform: Es tobt ein Glaubenskrieg Doch das grösste Problem ist ein rein psychologisches: Diejenigen, welche früher die alte Rechtschreibung mühsam erlernt haben, wollen sie nicht umlernen. Der frühere Leiter der Hamburger Journalistenschule Wolf Schneider sagt, dass es für Lehrer und Schüler wesentlich einfacher wäre, als für die 70 Mio. Erwachsenen die neue Rechtschreibung zu erlernen. Er reagiert im Vergleich zu anderen noch relativ neutral. Ein CDU-Politiker sagt, die Befürworter der Rechtschreibreform haben sich am „Heiligsten einer Kulturnation: der Sprache vergriffen und in Briefen wurden sie von aufgebrachten Bürgern beschimpft. Die Befürworter warfen den Gegnern Unrichtigkeiten und Verdrehungen vor. Im Laufe der Diskussion verwirrten sich allerdings die Argumente beider Seiten. Die Logik verschwand aus der Debatte. Die Zukunft der deutschen Rechtschreibung: eine bunte Vielfalt Die Chance, dass die geschriebene Sprache irgendwann so geschrieben wird, wie die gesprochene, ist also schon längst vertan. Es bleibt ein ähnlicher Zustand wie im 19.Jh., es existiert eine bunte Vielfalt der Schreibweisen. Kinder- und Jugendbücher sind meistens in der neuen Rechtschreibung verfasst, während die literarischen Werke älterer Schriftsteller noch meistens in der alten verfasst sind. Und es gibt Bücher, welche in einer Mischung der beiden verfasst sind. Da häufiger auch im Internet geschrieben wird und es den Benutzern von Chatrooms etc. ziemlich egal ist, welche Rechschreiberegeln verwenden, verwischt die Linie zwischen alter und neuer Rechtschreibung immer mehr. Und wer am Computer tippt, wird sowieso automatisch vom Korrekturprogramm korrigiert. Doch auch in anderen Sprachen gibt es Probleme, z.B. im Englischen. Die historisch gewachsene Unlogik kann etwa mit dem Deutschen verglichen werden. Und um eine Reform durchzuführen müsste man sich neben den Ländern mit Englisch als Staatsprache auch mit den alten englischen Kolonien abstimmen. Doch dies versucht man erst gar nicht. Und auch Frankreich hätte ein Problem, denn auch Frankreich hatte zahlreiche Kolonien. Zwei Jahrhunderte voller Streit – Zeitablauf der Rechtschreibreform Kapitel 11 Wenn Digger endkrass dissen Oder: Sprechen Jugendliche eine eigene Sprache? Wenn man einem Erwachsenen eine Satz hinlegt, der mit Wörtern der Jugendlichen geschrieben wird, wird er in schwerlich verstehen. Doch es leben im Deutschen Sprachraum so viele Jugendlich, welche auch nicht alle dieselben Wörter benutzen, dass wahrscheinlich auch Sprechen Jugendlich wirklich anders? Dass 16-Jährige anders als 60-Jährige reden ist wahrscheinlich auch Nichtsprachwissenschaftlern klar. Doch ob es jetzt wirklich eine Jugendsprache gibt, ist unklar. Was allerdings klar ist, dass es gewisse Besonderheiten gibt: -Jugendliche haben andere Grussformeln (sondersprachliche Grussformeln) -Jugendliche kleben Silben an Wörter, wie es Erwachsene nicht tun würden. Bsp. „endsauer (expressive Steigerung durch Präfigierung) -Jugendliche benutzen noch mehr Wörter aus dem Englischen als Erwachsene. Bsp. chillen etc. (Entlehnung). Zudem werden manche Wörter auch verändert. So entsteht aus „to disrespect „to diss, welches sogar erwachsene Briten und Amerikaner nicht verstehen. -Jugendliche verwenden Wörter, welche von Erwachsenen als anstössig empfunden werden. (diastratisch niedrig markierten Lexemen) -Jugendliche malen mit ihrer Sprache gerne Bilder: Münzmallorca für Solarium etc. (metaphorische Sprechweise) -Jugendliche lassen Wörter aus: Kommst du nachher Karstadt? Auf jeden. (elliptische Sprechweise) -Jugendliche verwenden gebräuchliche Wörter mit neuem Sinn: Biotonne für Vegetarier aber auch für Joschka Fischer. (Verfremdung, welche zu Polysemie führt) -Jugendliche verwenden neue grammatische Regeln: Aus der Vorsilbe „un- machen sie ein neues Wort, in dem sie es steigern. „unst und „unsten. (paradoxe Superlativbildung zu einem Präfix) -Jugendliche verwenden gerne Füllwörter: und so, na ja etc. (Abtönungspartikel) -Jugendwörter schneiden gerne Worte ab: Alk statt Alkohol und türlich anstatt natürlich (Kopfwörter und Schwanzwörter) Alles in allem sprechen Jugendliche also anders. Doch eine ganz andere Sprache ist es nicht. Sprachwissenschaftler haben herausgefunden, dass sie sich nur um ca. 1 von der durchschnittlichen Erwachsenensprache unterscheidet. Nichts verändert sich so schnell wie Jugendsprache In etwas sind sich Wissenschaftler aber einig: Die Jugendsprache ändert sich schneller als der Rest der Sprache. Und sie ist eine relativ neue Erscheinung, es gibt sie wahrscheinlich erst seit ca. 150 Jahren. Im Mittelalter gab es noch keine Orte, die nur Jugendlich besuchten, oder Kleidung, welche nur Jugendliche trugen. Erst ab dem 19.Jh. ist eindeutig belegbar, dass Jugendliche anders als Erwachsene gesprochen haben. Schon im 19.Jh. übernahmen Jugendliche gerne Worte aus anderen Sprachen. Damals allerdings eher aus dem Französischen. Pousser wurde zu poussieren. Heute würde man flirten sagen. Aus der lateinischen Redewendung „ sub omne canone leiteten die jungen Leute von damals „unter aller Kanone her. Heute verwenden ihn eher ältere Leute. Die Jugendsprache ändert sich also sehr schnell, und dies in drei Richtungen. Manche Worte verschwinden wied