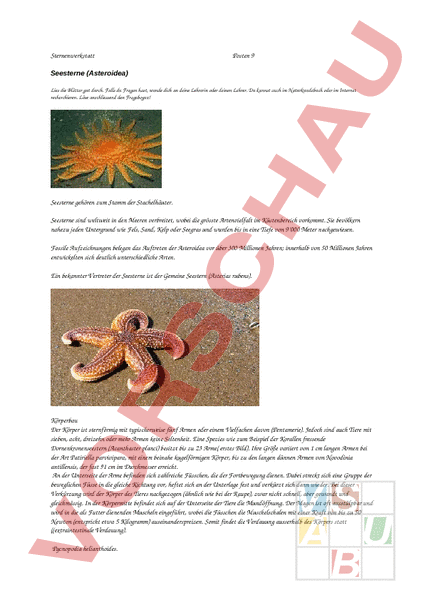Arbeitsblatt: Sternenwerkstatt Posten 9
Material-Details
Werkstatt für die Adventszeit
Deutsch
Gemischte Themen
6. Schuljahr
3 Seiten
Statistik
90627
770
2
04.12.2011
Autor/in
Isabella Fasnacht
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Sternenwerkstatt Posten 9 Seesterne (Asteroidea) Lies die Blätter gut durch. Falls du Fragen hast, wende dich an deine Lehrerin oder deinen Lehrer. Du kannst auch im Naturkundebuch oder im Internet recherchieren. Löse anschliessend den Fragebogen! Seesterne gehören zum Stamm der Stachelhäuter. Seesterne sind weltweit in den Meeren verbreitet, wobei die grösste Artenvielfalt im Küstenbereich vorkommt. Sie bevölkern nahezu jeden Untergrund wie Fels, Sand, Kelp oder Seegras und wurden bis in eine Tiefe von 9‘000 Meter nachgewiesen. Fossile Aufzeichnungen belegen das Auftreten der Asteroidea vor über 300 Millionen Jahren; innerhalb von 50 Millionen Jahren entwickelten sich deutlich unterschiedliche Arten. Ein bekannter Vertreter der Seesterne ist der Gemeine Seestern (Asterias rubens). Körperbau Der Körper ist sternförmig mit typischerweise fünf Armen oder einem Vielfachen davon (Pentamerie). Jedoch sind auch Tiere mit sieben, acht, dreizehn oder mehr Armen keine Seltenheit. Eine Spezies wie zum Beispiel der Korallen fressende Dornenkronenseestern (Acanthaster planci) besitzt bis zu 23 Arme( erstes Bild). Ihre Größe variiert von 1 cm langen Armen bei der Art Patiriella parvivipara, mit einem beinahe kugelförmigen Körper, bis zu den langen dünnen Armen von Novodinia antillensis, der fast 91 cm im Durchmesser erreicht. An der Unterseite der Arme befinden sich zahlreiche Füsschen, die der Fortbewegung dienen. Dabei streckt sich eine Gruppe der beweglichen Füsse in die gleiche Richtung vor, heftet sich an der Unterlage fest und verkürzt sich dann wieder. Bei dieser Verkürzung wird der Körper des Tieres nachgezogen (ähnlich wie bei der Raupe), zwar nicht schnell, aber gewandt und gleichmässig. In der Körpermitte befindet sich auf der Unterseite der Tiere die Mundöffnung. Der Magen ist oft ausstülpbar und wird in die als Futter dienenden Muscheln eingeführt, wobei die Füsschen die Muschelschalen mit einer Kraft von bis zu 50 Newton (entspricht etwa 5 Kilogramm) auseinanderspreizen. Somit findet die Verdauung ausserhalb des Körpers statt ((extraintestinale Verdauung). Pycnopodia helianthoides. Extraintestinale Verdauung der Schere eines Taschenkrebses. Wenn das Futter verspeist ist, zieht der Seestern den Magen wieder ins Innere zurück. Weitere Futtertiere neben Muscheln (insbesondere Miesmuscheln) sind Schwämme, Schnecken, Aas, Fische, Moostierchen und Seescheiden. Die Körperfärbung ist auf der Oberseite meist sehr auffällig, während die Unterseite eine hellere Farbe aufweist. Man kann den Seestern durch 5 Schnittebenen in je 2 spiegelbildlich gleiche Teile zerlegen. Da jeder Arm nahezu alle wichtigen Organe enthält, können einzelne Arme weiterleben und sogar den Rest ergänzen (Regeneration, mutabiles Gewebe ). Bei diesem Vorgang entsteht zuerst die Körperscheibe, aus der dann die Arme knospenartig hervorwachsen. Seesterne besitzen ein zentrales Nervensystem bzw. ein diffuses Nervennetz, jedoch konnte noch kein Organ identifiziert werden, das man als Gehirn bezeichnen könnte. An der Oberseite des Seesterns sind deutlich zahlreiche kleine Knoten und Unebenheiten fühlbar. Diese gehen aus wirbelartig verbundenen Kalkplättchen unter der Haut hervor. Die Kalkplättchen bilden das Hautskelett des Tieres. Da die Plättchen aber trotz der Verbindung gegeneinander verschiebbar sind, behält der Seestern seine Beweglichkeit. Seesterne besitzen keine Augen, mit denen sie Objekte erkennen oder identifizieren können. An ihren Armsitzen befinden sich jedoch mehrere Lichtsinneszellen, um Helligkeitsunterschiede in ihrer Umgebung wahrnehmen zu können. Fortpflanzung Seesterne sind getrenntgeschlechtlich. Von umherschwimmenden Spermien stimuliert, geben die Weibchen ihre Eier ins Wasser ab. Die Spermien bzw. Eier entwickeln sich in fünf Keimdrüsen, die in den Armwinkeln liegen. Die sich aus den Eiern entwickelnden Larven leben einige Zeit planktonisch (wie Plankton) und wandeln sich dann in Seesterne um, wobei einige Seesternarten sich auch gänzlich ohne Larvenstadium entwickeln. Die typische Radiärsymmetrie der Seesterne bildet sich erst später aus. Bei den Dornensternen gibt es weniger Männchen als Weibchen. Selten gibt es auch zwittrige Seesternarten. Dort sind die jüngeren Individuen zunächst Spermien erzeugende Männchen (Protandrie). Mit zunehmendem Alter wandeln sie sich zu Weibchen um, die nur noch Eier hervorbringen. Daneben gibt es Übergangsstadien, in denen Ei und Samenzellen gleichzeitig reifen. Es existiert auch eine ungeschlechtliche Vermehrung von Seesternen. Durch Querteilung entstehen oft „Kometenformen, bei denen zwei bis vier große Arme drei oder mehr kleineren, erst neu gebildeten gegenüberstehen.