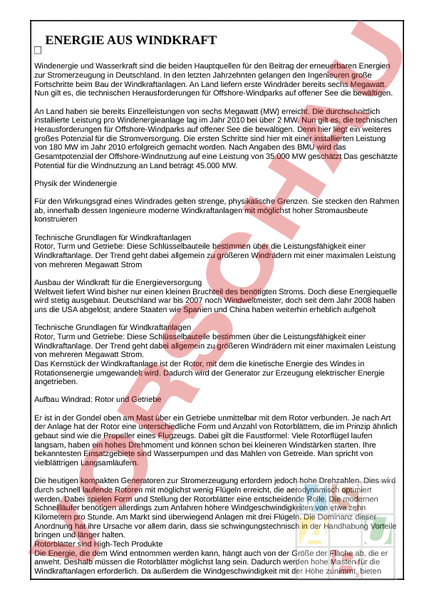Arbeitsblatt: Energie aus Windkraft
Material-Details
Beschreibung von Kraftwerksanlagen, die mit Windenergie arbeiten
Physik
Anderes Thema
9. Schuljahr
3 Seiten
Statistik
91339
1100
4
16.12.2011
Autor/in
Kuster Adolf (Spitzname)
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
ENERGIE AUS WINDKRAFT Windenergie und Wasserkraft sind die beiden Hauptquellen für den Beitrag der erneuerbaren Energien zur Stromerzeugung in Deutschland. In den letzten Jahrzehnten gelangen den Ingenieuren große Fortschritte beim Bau der Windkraftanlagen. An Land liefern erste Windräder bereits sechs Megawatt. Nun gilt es, die technischen Herausforderungen für Offshore-Windparks auf offener See die bewältigen. An Land haben sie bereits Einzelleistungen von sechs Megawatt (MW) erreicht. Die durchschnittlich installierte Leistung pro Windenergieanlage lag im Jahr 2010 bei über 2 MW. Nun gilt es, die technischen Herausforderungen für Offshore-Windparks auf offener See die bewältigen. Denn hier liegt ein weiteres großes Potenzial für die Stromversorgung. Die ersten Schritte sind hier mit einer installierten Leistung von 180 MW im Jahr 2010 erfolgreich gemacht worden. Nach Angaben des BMU wird das Gesamtpotenzial der Offshore-Windnutzung auf eine Leistung von 35.000 MW geschätzt Das geschätzte Potential für die Windnutzung an Land beträgt 45.000 MW. Physik der Windenergie Für den Wirkungsgrad eines Windrades gelten strenge, physikalische Grenzen. Sie stecken den Rahmen ab, innerhalb dessen Ingenieure moderne Windkraftanlagen mit möglichst hoher Stromausbeute konstruieren Technische Grundlagen für Windkraftanlagen Rotor, Turm und Getriebe: Diese Schlüsselbauteile bestimmen über die Leistungsfähigkeit einer Windkraftanlage. Der Trend geht dabei allgemein zu größeren Windrädern mit einer maximalen Leistung von mehreren Megawatt Strom Ausbau der Windkraft für die Energieversorgung Weltweit liefert Wind bisher nur einen kleinen Bruchteil des benötigten Stroms. Doch diese Energiequelle wird stetig ausgebaut. Deutschland war bis 2007 noch Windweltmeister, doch seit dem Jahr 2008 haben uns die USA abgelöst; andere Staaten wie Spanien und China haben weiterhin erheblich aufgeholt Technische Grundlagen für Windkraftanlagen Rotor, Turm und Getriebe: Diese Schlüsselbauteile bestimmen über die Leistungsfähigkeit einer Windkraftanlage. Der Trend geht dabei allgemein zu größeren Windrädern mit einer maximalen Leistung von mehreren Megawatt Strom. Das Kernstück der Windkraftanlage ist der Rotor, mit dem die kinetische Energie des Windes in Rotationsenergie umgewandelt wird. Dadurch wird der Generator zur Erzeugung elektrischer Energie angetrieben. Aufbau Windrad: Rotor und Getriebe Er ist in der Gondel oben am Mast über ein Getriebe unmittelbar mit dem Rotor verbunden. Je nach Art der Anlage hat der Rotor eine unterschiedliche Form und Anzahl von Rotorblättern, die im Prinzip ähnlich gebaut sind wie die Propeller eines Flugzeugs. Dabei gilt die Faustformel: Viele Rotorflügel laufen langsam, haben ein hohes Drehmoment und können schon bei kleineren Windstärken starten. Ihre bekanntesten Einsatzgebiete sind Wasserpumpen und das Mahlen von Getreide. Man spricht von vielblättrigen Langsamläufern. Die heutigen kompakten Generatoren zur Stromerzeugung erfordern jedoch hohe Drehzahlen. Dies wird durch schnell laufende Rotoren mit möglichst wenig Flügeln erreicht, die aerodynamisch optimiert werden. Dabei spielen Form und Stellung der Rotorblätter eine entscheidende Rolle. Die modernen Schnellläufer benötigen allerdings zum Anfahren höhere Windgeschwindigkeiten von etwa zehn Kilometern pro Stunde. Am Markt sind überwiegend Anlagen mit drei Flügeln. Die Dominanz dieser Anordnung hat ihre Ursache vor allem darin, dass sie schwingungstechnisch in der Handhabung Vorteile bringen und länger halten. Rotorblätter sind High-Tech Produkte Die Energie, die dem Wind entnommen werden kann, hängt auch von der Größe der Fläche ab, die er anweht. Deshalb müssen die Rotorblätter möglichst lang sein. Dadurch werden hohe Masten für die Windkraftanlagen erforderlich. Da außerdem die Windgeschwindigkeit mit der Höhe zunimmt, bieten große Masten einen weiteren Vorteil. Mehr Leistung mit größeren Rotoren Moderne große Windkraftwerke haben Rotordurchmesser bis zu 100 Meter und mehr, bei Drehzahlen von 0,3 bis 2 pro Sekunde mit Leistungen von einigen 100 Kilowatt bis zu fünf Megawatt. Allerdings kann die Rotorlänge nicht beliebig groß werden, weil an den Rotorenden enorme Zentrifugalkräfte angreifen. So kommen die Flügelspitzen von 50 Meter-Rotoren bei einer Drehzahl von 0,3 pro Sekunde auf eine Geschwindigkeit von 340 Kilometern pro Stunde. Dadurch treten Fliehkräfte auf, die dem 18-Fachen der Erdbeschleunigung entsprechen. Dies erfordert hohe Ansprüche an die Zerreißfestigkeit der verwendeten Materialien und äußerst präzise Berechnungen der Konstruktion. Große Fortschritte seit 1980 Die technische Entwicklung der Windenergie seit 1980 ist beeindruckend. Zum großen Teil bedingt durch die erhebliche öffentliche Förderung von Forschung und Entwicklung hat sich die Leistung der Windkraftanlagen um mehr als einen Faktor 160 vergrößert. Dem ging eine Vergrößerung der Rotordurchmesser von 15 Meter auf 115 Meter und der Nabenhöhe von 30 Meter auf 120 Meter einher. Höhere Naben und größere Rotoren für mehr Leistung Die Rotorblätter sind um ihre Längsachse verstellbar. Dadurch kann die Drehzahl der Rotoren bei wechselnden Windgeschwindigkeiten weitgehend konstant gehalten werden. Außerdem kann bei starkem Wind so die Angriffsfläche verkleinert und bei schwachem Wind vergrößert werden. Weiterhin ist die Gondel am Mast drehbar gelagert, wodurch sich die Rotoren den wechselnden Windrichtungen anpassen können. Bei zu hohen Windgeschwindigkeiten etwa 25 Meter pro Sekunde -, die wegen der hohen Zentrifugalkräfte zu Beschädigungen der Rotoren führen könnten, kann die Anlage automatisch durch Verstellen der Rotorblätter aus dem Wind genommen werden. Das Schwergewicht der Anlagengrößen lag im Jahr 2005 bei 1,5 bis 3,1 Megawatt. Mittlerweile erreichen die größten Anlagen Leistungen von fünf Megawatt, wie zum Beispiel die zwölf Kraftwerke des ersten deutschen Offshore-Windparks alpha ventus, die 2009 vor der Nordseeinsel Borkum in Betrieb gingen. Mit der produzierten Menge an Strom ließen sich rund 50.000 Haushalte versorgen. Um den Wind auch an Land besser nutzen zu können, will die Bundesregierung das so genannte Repowering vorantreiben dabei werden kleine Anlagen, die vor allem aus den 1990er Jahren stammen, durch leistungsstärkere Modelle ersetzt. Ausbau der Windkraft für die Energieversorgung Weltweit liefert Wind bisher nur einen kleinen Bruchteil des benötigten Stroms. Doch diese Energiequelle wird stetig ausgebaut. Deutschland war bis 2007 noch Windweltmeister, doch seit dem Jahr 2008 haben uns die USA abgelöst; andere Staaten wie Spanien und China haben weiterhin erheblich aufgeholt. Windenergie und Wasserkraft sind die beiden Hauptquellen für den Beitrag der erneuerbaren Energien zur Stromerzeugung in Deutschland. Allerdings ist die Menge des Stroms aus Windenergie im Jahr 2009 gegenüber dem Jahr 2008 witterungsbedingt um ca. 6% auf 38 Terawattstunden (TWh) zurückgegangen, obwohl sich der steigende Trend beim Ausbau der Windkraft auf insgesamt 21164 Anlagen fortgesetzt hat. Sie waren über das ganze Bundesgebiet verteilt und ergaben zusammen eine Kraftwerkskapazität von 25.777 Megawatt (MW). Windenergieanlagen und deren Leistung in Deutschland. Nach Abschätzungen des Bundesumweltministeriums beträgt das ausbaufähige Potenzial der Windenergie auf dem Festland 45.000 MW und Offshore auf offener See jeweils zusätzlich 35.000 MW mit potenziellen Erträgen von 100 Terawattstunden pro Jahr bzw. 135 Terawattstunden pro Jahr. An der Primärenergieversorgung Deutschlands im Jahr 2006 war der Anteil der Windenergie mit 1 Prozent jedoch noch deutlich bescheidener. Insgesamt ist seit Anfang der 90er Jahre ein rasanter Anstieg der Windenergienutzung in Deutschland zu beobachten. So hat sich die Zahl der Windkraftanlagen in den letzten zehn Jahren mehr als verdreifacht. Der Trend ist weiterhin steigend, wenn sich auch eine Sättigung der Zahl der installierten Anlagen abzuzeichnen scheint. Die produzierte Menge an Strom aus Windenergie ist dem Ausbau der Windkraftwerke gefolgt, wenn auch nicht immer exakt mit der Höhe der installierten Leistung, weil auch die Windverhältnisse und damit die Meteorologie eines Jahres hierfür eine wichtige Rolle spielen. Hierfür war das Jahr 2009 als trotz steigender Zahl der Windkraftanlagen die produzierte Strommenge zurückging ein gutes Beispiel. Top 10 der weltweit installierten Windleistung 2009 nach Staaten. Weltweit waren 2009 insgesamt 157.899 Megawatt Windleistung installiert, davon rd. 16 Prozent in Deutschland. Durch den weiteren Ausbau der Windenergieleistung in den USA auf 35.159 Megawatt blieb Deutschland zwar auf dem zweiten Platz der Weltrangliste, aber dies wird sich wahrscheinlich in Kürze ändern, weil nun in China ebenfalls ein rasantes Wachstum der Windkraftleistungen zu beobachten ist. Dadurch wurde schon 2009 Spanien vom dritten Platz verdrängt. Ebenfalls die Plätze 8 und 10 gewechselt haben Portugal und Dänemark.