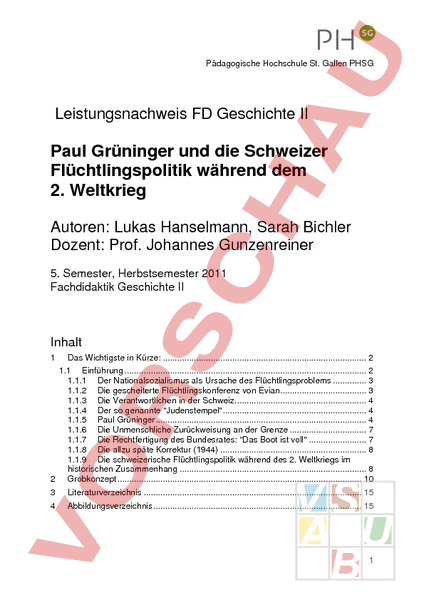Arbeitsblatt: Paul Grüninger
Material-Details
Kurze Zusammenfassung zur Schweizer Flüchtlingspolitik mit Schwerpunkt Paul Grüninger
Geschichte
Schweizer Geschichte
8. Schuljahr
15 Seiten
Statistik
91820
1577
25
01.01.2012
Autor/in
Sarah Bichler
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Pädagogische Hochschule St. Gallen PHSG Leistungsnachweis FD Geschichte II Paul Grüninger und die Schweizer Flüchtlingspolitik während dem 2. Weltkrieg Autoren: Lukas Hanselmann, Sarah Bichler Dozent: Prof. Johannes Gunzenreiner 5. Semester, Herbstsemester 2011 Fachdidaktik Geschichte II Inhalt 1 Das Wichtigste in Kürze: . 2 1.1 Einführung . 2 1.1.1 Der Nationalsozialismus als Ursache des Flüchtlingsproblems 3 1.1.2 Die gescheiterte Flüchtlingskonferenz von Evian 3 1.1.3 Die Verantwortlichen in der Schweiz . 4 1.1.4 Der so genannte Judenstempel 4 1.1.5 Paul Grüninger 4 1.1.6 Die Unmenschliche Zurückweisung an der Grenze 7 1.1.7 Die Rechtfertigung des Bundesrates: Das Boot ist voll 7 1.1.8 Die allzu späte Korrektur (1944) . 8 1.1.9 Die schweizerische Flüchtlingspolitik während des 2. Weltkriegs im historischen Zusammenhang 8 2 Grobkonzept 10 3 Literaturverzeichnis . 15 4 Abbildungsverzeichnis . 15 1 1. Die Schweiz im 2. Weltkrieg – Flüchtlingspolitik 1 Das Wichtigste in Kürze: Im Zweiten Weltkrieg war die Schweiz während mehr als vier Jahre von den Achsenmächten eingeschlossen. Daraus ergab sich eine starke wirtschaftliche Abhängigkeit. Dennoch konnte sie durch eine geschickte Politik ihre Existenz als selbstständiger Staat bewahren und sich aus dem Kriegsgeschehen heraushalten. (Meyer Schneebeli, 2007) 1.1 Einführung Im Ganzen ging es den Schweizern politisch und militärisch sehr viel besser als den Bewohnern der meisten übrigen europäischen Staaten. Daher versuchten viele Verfolgte, in die Schweiz zu fliehen. Ein geschriebenes Recht auf Aufnahme hatten nur fremde Soldaten (abgedrängte Truppen, geflohene Kriegsgefangene usw.) und politisch Verfolgte. Dieser Begriff wurde sehr eng ausgelegt. So galten Juden nicht als „politisch verfolgt, auch dann nicht, als immer deutlicher wurde, dass ihnen die Vernichtung in den Konzentrationslagern drohte. In der Praxis war man grosszügiger, solange nicht sehr viele Flüchtlinge eintrafen. Als 1942 der Flüchtlingsstrom zunahm, beschloss der Bundesrat, die Bestimmungen hart anzuwenden. Gegen die vor allem 1942 1943 harte Haltung des Bundesrates setzten sich zahlreiche Hilfswerke und kirchliche Organisationen für eine grosszügigere Haltung ein. Bei Kriegsende befanden sich über 100‘000 Flüchtlinge aller Art in der Schweiz. Die Abgewiesenen dagegen, schätzungsweise 20‘000, waren nun wohl zum grössten Teil nicht mehr am Leben. (Meyer Schneebeli, 2007) 2 Abbildung 1: Sowjetische Kriegsgefangene aus Deutschland in der Schweiz (Jud, 2010) 1.1.1 Der Nationalsozialismus als Ursache des Flüchtlingsproblems Nach der Machtergreifung der NSDAP in Deutschland flohen bis zum Herbst 1933 rund 2000 Flüchtlinge (vorwiegend Juden und Intellektuelle) aus Deutschland in die Schweiz, Ende 1938 waren es bereits 10�00. Bis zum Waffenstillstand am 8. Mai 1945 stieg die Zahl der Flüchtlinge auf 115�00, wovon rund 50�00-60�00 internierte Soldaten, die von den feindlichen Truppen an die Grenze abgedrängt worden waren Insgesamt beherbergte die Schweiz 295381 Flüchtlinge. (Jud, 2010) 1.1.2 Die gescheiterte Flüchtlingskonferenz von Evian An einer internationalen Flüchtlingskonferenz in Evian (auf der französischen Seite des Genfersees) stand 1938 nicht das Schicksal der Verfolgten, sondern die Gefährdung der potentiellen Aufnahmeländer durch die Massenvertreibung im Vordergrund. Sie verlief ohne konkretes Ergebnis. Zahlreiche Staaten schränkten die Zulassung von Flüchtlingen weiter ein. Rückblickend kann man festhalten, dass damals die internationale Staatengemeinschaft, insbesondere die USA es verpasst haben, sich ernsthaft für die Flüchtlinge einzusetzen. Die Schweiz war, gemessen an der Zahl der aufgenommenen Flücht- 3 linge pro Einwohner, durchaus eine der meisten Flüchtlings aufnehmenden Staaten. (Jud, 2010) 1.1.3 Die Verantwortlichen in der Schweiz Die Flüchtlingspolitik der Schweiz vor und während des 2. Weltkriegs wurde von Heinrich Rothmund (Chef der Polizeiabteilung des EJPD Fremdenpolizei) und Bundesrat Eduard Steiger (BGB, Vorgängerpartei der SVP) geprägt. Die EJPD hatte seit dem 1. Weltkrieg die ideologischen und rechtlichen Grundlagen der Schweizerischen Bevölkerungspolitik ausgearbeitet und in der Zwischenkriegszeit eine antisemitistisch geprägte Ausländerpolitik durchgesetzt. In letzter Instanz entschied die Polizeiabteilung über die Aufnahme und Wegweisung von Flüchtlingen. Im EJPD herrschten starke fremdenfeindliche und antisemitische Tendenzen. (Jud, 2010) 1.1.4 Der so genannte Judenstempel Im April 1938 verlangte die Schweiz von Deutschland Massnahmen, um die Flüchtlingsströme besser kontrollieren zu können. Die deutsche Seite schlug den JStempel vor. Rothmund erkannte den diskriminierden Charakter dieser Massnahme, der Bundesrat hiess aber dieses Abkommen mit Deutschland einstimmig für gut. Durch eine Verordnung des deutschen Nazi-Regimes wurden am 5. Oktober 1938 die Reisepässe deutscher und österreichischer Juden für ungültig erklärt, eingezogen und mit einem roten J-Stempel, den sogenannten Judenstempel, gekennzeichnet. (Jud, 2010) 1.1.5 Paul Grüninger Grüninger erblickte 1891 in St.Gallen das Licht der Welt. Er genoss eine protestantische Erziehung zusammen mit seinen drei Geschwistern. 1907 startete er eine Ausbildung zum Lehrer in Rorschach. Nach erfolgreichem Abschluss unterrichtete er einige Jahre, zuerst in Räfis und dann in Au. 1919 wurde eine Stelle als Leutnant des Lanjägerkorps (Polizei) frei. Grüninger bewarb sich „einzig und allein wegen der finanziellen Besserstellung. Im September desselben Jahres hatte Grüninger seinen ersten Arbeitstag. Grüninger stieg in den folgenden Jahren die Karriereleiter zum 4 Hauptmann empor. Bessere Jobs lehnte er jedoch ab mit der Begründung: „Die Bekämpfung des Verbrechertums mit den modernsten Fahndungsmitteln und die Heranbildung befähigter Polizeiorgane liegen mir mehr am Herzen. Als 1938 die Pogrome in Österreich begannen, versuchten viele jüdischstämmige Burschen, Frauen und Familien in die Schweiz zu flüchten. Die Anfangs offenen Schweizer Grenzen wurden immer strenger kontrolliert, so dass offiziell keine Juden mehr ins Land durften. Nur Personen mit den richtigen Einreisepapieren durften das Land betreten. In einer ersten Phase waren es vor allem Leute wie Jakob Spirig, die den Juden geholfen haben. Die Flüchtlingshelfer von Diepoldsau nahmen jeweils die Flüchtlinge auf der österreichischen Seite des Rheins, meist in Hohenems, in Empfang und verhalfen Ihnen ungesehen, meist mit listigen Tricks, am Zoll vorbeizukommen. Für ihre Dienste nahmen sie fünf bis zehn Mark lohn. Falls aber mal einer nicht zahlen konnte war das kein Grund ihn stehen zu lassen. „ Die Leute hatten ja nichts. Das waren Arbeiter und Arbeitslose wie wir auch, meinte Spirig. Spirig hat so alleine bis an die 100 Juden vor den Nazis gerettet. 1941 wurde er jedoch bei einer seiner Aktionen verhaftet und für einige Monate in die „Kiste gesteckt worden. Auf der Schweizer Seite Angekommen, habe er die Flüchtlinge jeweils ins Lager geschickt. Ins Lager, ins Flüchtlingslager, welches Paul Grüninger im Juli 1938 in Diepoldsau eröffnete. Grüninger stellte damals Wachtmeister Ernst Kamm als Leiter des Lagers ein. Dieser galt als typischer Polizist, fair aber trotzdem sehr streng. Kamm sagte später, dass es die schlimmste Zeit seines Lebens war. Er wurde dauernd von Flüchtlingen geweckt mitten in der Nacht, weil sie Unterschlupf suchten. Je nach Situation habe er dann Hauptmann Grüninger oder gar Regierungsrat Valentin Keel, gleichgesinnter wie Grüninger, angerufen. Diese seien dann jeweils in den Gasthof Sonne gekommen und haben die besagten Leute beurteilt. Der Regierungsrat sei bei solchem Elend häufig in Tränen ausgebrochen und Grüninger habe mitgeweint. „Eine richtige Heulerei sei das manchmal geworden, so Kamm. Grüninger hat den Leuten jedoch nicht nur geholfen in der Schweiz zu bleiben, er hat auch einige aus Österreich rausgeholt. Wie bereits erwähnt wurde die Visapflicht für Reisen in die Schweiz eingeführt. Als Juden mit dem „Judenstempel hatte man allerdings keine Chance ein solches Visa zu erlangen. Grüninger fälschte solche Visen kurzerhand und brachte sie, teils gar persönlich, nach Österreich. So konnten zahlreiche Juden in die Schweiz einreisen. 5 Diese gefälschten Dokumente waren es dann auch, die Polizeihauptmann Grüninger zu Fall brachten. Grüninger wurde 1939 von Dienst suspendiert. Es entstand sowohl im Regierungsrat wie auch in der Öffentlichkeit eine enorme Debatte um Grüninger. Denn dieser bestritt seine Taten nicht. Er sagte jedoch immer, dass er nach Befehl gehandelt hatte. So auch in seinem Geständnis vom 6. April 1939: „Ich begrüsse den Untersuch! Er wird mir die Gelegenheit verschaffen, den Nachweis zu erbringen, dass ich aus rein menschlichen Motiven und ganz im Sinne und Geiste meines Vorgesetzten gehandelt habe. Wenn dieser mir heute aus unerklärlichen Motiven nicht mehr zur Sache steht, werde ich darzutun in der Lage sein, dass ich nicht in einem einzigen Fall gegen mir gegebene Weisungen des Departements verstiess. Ich habe als Mensch und Beamter aus achtenswerten Motiven gehandelt. In diesem Geständnis spricht er auch den Punkt an, der zur Debatte führte. Valentin Keel, der in Diepoldsau noch bei der „Heulerei dabei war, verleugnete jegliches Wissen über die Taten von Grüninger. So kam es, dass der Ruf Grüningers enorm litt, unter anderem auch wegen Unterstellungen und Gerüchten im Bezug auf Bestechung und Frauen. Valentin Keel hingegen wurde wiedergewählt und blieb Regierungsrat in St.Gallen. Paul Grüninger wurde wegen Amtspflichtverletzung und Urkundenfälschung verurteilt und musste eine hohe Busse bezahlen. Von nun an lebte er bis zu seinem Tod 1972 in absoluter Armut. Erst 1993 wird er von der St.Galler Regierung politisch rehabilitiert. 1995 erfolgte dann die juristische Rehabilitation. 1998 wurde den Nachkommen eine materielle Wiedergutmachung zugesprochen. Der gesamte Betrag floss in die Gründung der Paul Grüningerstiftung. Die Stiftung setzt sich noch heutet für Menschenrechte ein. Nebst der Stiftung ist der Name Paul Grüninger noch heute an zahlreichen Orten zu finden. Nebst Plätzen und Strassen in St.Gallen und dem Rest der Welt (u.A. in Jerusalem und Stuttgart) steht sein Namen über dem Stadion des SC Brühl. Das PaulGrüninger- Stadion wurde 2006 zu ehren des Spielers (Meister 1915) und Präsidenten (1924-27; 1937-40) getauft. (Dindo, 1997) (Keller, 1993) 6 1.1.6 Die Unmenschliche Zurückweisung an der Grenze Im Januar 1942 ernannte der Bundesrat den Diplomaten Edouard de Haller zum Delegierten des Bundesrates für internationale Hilfswerke. In dieser Koordinationsfunktion behinderte de Haller die Hilfswerke im Sinn der abweisenden offiziellen Flüchtlingspolitik. Ab Frühjahr 1942 wurden Juden von deutschen Spezialeinheiten zu Tausenden nach Osten deportiert, ab Mai begann der Holocaust. Am 16. Juli wurden über 13�00 französische Juden in Paris verhaftet und deportiert. Ende Juli erstattete Robert Jezler (Stellvertreter Rothmunds) dem Bundesrat Bericht: „Die übereinstimmenden und zuverlässigen Berichte über die Art und Weise, wie die Deportationen durchgeführt werden, und über die Zustände in den Judenbezirken im Osten sind derart grässlich, dass man die verzweifelten Versuche der Flüchtlinge, solchem Schicksal zu entrinnen, verstehen muss und eine Rückweisung kaum mehr verantworten kann. Dennoch betonte er, man dürfe in der heutigen Kriegszeit, in der auch die Schweiz in gewissem Sinn um ihre Existenz kämpfen müsse, und empfahl, bei der Aufnahme von Flüchtlingen in Zukunft grose Zurückhaltung zu üben. Die Schweizer Behörden reagierten auf die klar verschärfte Bedrohung für jüdische Flüchtlinge nun aber nicht etwa mit einer Lockerung der Flüchtlingspolitik, ganz im Gegenteil: Am 13. August 1942 erliess Polizeichef Heinrich Rothmund in Abwesenheit von Bundesrat Eduard von Steiger eine totale Grenzsperre für Flüchtlinge. Die Massnahme wurde in der Öffentlichkeit sofort heftig kritisiert. Nach einem persönlichen Appell der Flüchtlingsmutter Gertrud Kurz ordnete Bundesrat Eduard von Steiger am 24. August die Lockerung der Sperre an. (Jud, 2010) 1.1.7 Die Rechtfertigung des Bundesrates: Das Boot ist voll Von Steiger rechtfertigte sich unter anderem wie folgt: „Unter Umständen muss man sogar hart und unnachgiebig scheinen, muss Vorwürfe, Beschimpfungen und Verleumdungen ertragen und trotzdem widerstehen können und nicht umfallen. Wer ein schon stark besetztes kleines Rettungsboot mit beschränktem Fassungsvermögen und ebenso beschränkten Vorräten zu kommandieren hat, indessen Tausende von Opfern einer Schiffskatastrophe nach Rettung schreien, muss hart scheinen, wenn er nicht alle aufnehmen kann. Und doch ist er noch menschlich, wenn er beizeiten vor falschen Hoffnungen warnt und wenigstens die schon Aufgenommenen zu retten sucht. Am 22./23. September wurde die Asylpolitik des Bundesrates im Parlament 7 zwar von einzelnen Volksvertretern heftig kritisiert, die bürgerliche Mehrheit billigte sie jedoch. Darauf verschärfte die Regierung die Aufnahmepraxis wieder. 1.1.8 Die allzu späte Korrektur (1944) Um den russischen Vormarsch zu stoppen, besetzten deutsche Truppen am 19. März 1944 das bis dahin mit Deutschland verbündete Ungarn. Zwischen dem 15. Mai und dem 8. Juli 1944 wurden 476�00 Juden aus Ungarn ins Vernichtungslager Auschwitz deportiert. Am 12. Juli 1944 trafen in Bern Nachrichten aus Ungarn ein, wonach alle Juden in Ungarn mit dem Tod bedroht seien. Die Schweiz revidierte ihre Flüchtlingspolitik am 12. Juli 1944, als es bereits zu spät war. Am 12. Juli 1944 erliess das EJPD neue Weisungen über die Aufnahme von Flüchtlingen. Juden wurden darin von den Behörden erstmals als allgemein gefährdet eingestuft und, unabhängig von speziellen persönlichen Asylgründen, als Flüchtlinge anerkannt. Damit reagierte man auf einen Bericht aus der Botschaft in Budapest, dass alle Juden in Ungarn vom Tod bedroht seien. (Jud, 2010) 1.1.9 Die schweizerische Flüchtlingspolitik während des 2. Weltkriegs im historischen Zusammenhang Zu beachten ist, dass die meisten Staaten auf dem europäischen Festland von deutschen oder mit ihnen verbündeten Truppen besetzt waren und aus all diesen Ländern insgesamt rund 6 Millionen Juden in die Vernichtungslager der Nazis verschleppt wurden. Bei einer eigenen Bevölkerung von 4 Millionen hätte die isolierte Schweiz zwar niemals alle von den Nazis verfolgten Personen aufnehmen können, wohl aber die rund 20�00 25�00 Flüchtlinge, die bis zur Schweizer Grenze gelangten und dort in den praktisch sicheren Tod zurückgeschickt wurden. Diese hätten die Zahl der Flüchtlinge nur um rund 10%, die der Gesamtbevölkerung um lediglich 0,6% erhöht. Bis 1940 wäre eine Weiterreise der zivilen Flüchtlinge auf dem Land- und Seeweg in die USA oder nach Kanada noch problemlos möglich gewesen, nachher hätte man sie allenfalls über eine Luftbrücke in Sicherheit bringen können. Amerika hat während des Zweiten Weltkriegs weniger Flüchtlinge ins Land gelassen als die Schweiz. (Jud, 2010) 8 Abbildung 2 Flüchtlingsbaracke in St. Margrethen (Durch die Geschichte zur Gegenwart 3) 9 2 Grobkonzept Grobkonzept Fachbereich: Geschichte Teilbereich: 2. WK LP SG 97 Richtziele: Sich in der Welt und in der Zeit orientieren Veränderungen in Raum und Zeit verfolgen Sich mit aktuellen Fragen in Raum und Zeit auseinandersetzen Grobziele: Staatsformen und deren Merkmale erkennen und beurteilen Veränderungen in den Denkweisen erkennen, beschreiben und beurteilen Veränderung der globalen Machtverhältnisse beschreiben Verflechtung zwischen der Schweiz, Europa und der Welt untersuchen und beurteilen Globales demokratisches und solidarisches Verhalten einsehen Grundrechte aller Menschen kennen und reflektieren Formen und Ursachen von Gewalt erkennen, Möglichkeiten zu gewaltfreiem Zusammenleben kennen und einüben Konflikte aufzeigen, Lösungsmöglichkeiten suchen und Wege, die zu fairem Umgang miteinander führen Inhalt: 2. Weltkrieg Rolle der Schweiz während und nach den Weltkriegen Umfang: 4 Doppellektionen Grobziel/ Lernziel/ did.-method. Hinweise 1. Doppellektion (GZ 1) Medien/ Aufgaben/ Material Bemerkungen LZ 1: Einen Zeitstrahl zur Schweiz im Zweiten Weltkrieg mit mindestens 6 Unterteilungen erstellen. LZ 2: Die Flüchtlingspolitik der Schweiz in eigenen Worten im Geschichtsheft festhalten. Bild „Flüchtlingsstrom „Durch die Geschichte zur Gegenwart 3 Klassensatz Geschichtsheft A3- Blätter Vorwissen: Die SuS wissen über den zweiten Weltkrieg bescheid und kennen die Rolle der Schweiz während der Zeit von 1933-1945. 10 Lektionsinhalte: Einstieg: Bild „Flüchtlingsstrom betrachten zuerst in PA dann in der Klasse und Stichworte notieren. Filzstifte Bildmaterial zur Illustration des Zeitstrahls Scheren und Leimstifte SuS lesen die S. 156- 158 „Durch die Geschichte zur Gegenwart 3. Inkl. Beantworten der fragen 1-8 ins Geschichtsheft. Einen Teil der Fragen dient der Repetition ein weiterer vertieft das Wissen über die Flüchtlingspolitik. Die SuS erstellen in GA (3) aus ihrem Vorwissen über den 2. WK einen Zeitstrahl über die Schweiz. Als Hilfe dient das Buch „Durch die Geschichte zur Gegenwart Der Zeitstrahl wird auf ein A3 Papier gestaltet. Zusammenfassung ins Geschichtsheft selbständig erstellen. Dazu gehört auch eine persönliche Stellungsnahme in mind. 2 Sätzen. 2 3 Doppellektion (GZ 1) LZ 3: Verschiedene Aspekte der Flüchtlingssituation in einer Werkstatt erarbeiten Lektionsinhalte: -Einstieg 1: Filmausschnitt zum Thema (Bsp. Das Boot ist voll) Beamer PC Internet Filmausschnitt Postenaufträge Postenmaterial Werkstattpass Geschichtsheft Einstieg 2: Lehrererzählung -Postenarbeit an verschiedenen Posten: Die Schweiz und die Flüchtlinge (PA) Jüdische Flüchtlinge (PA) Der „J-Stempel (EA) Erholungsaufenthalt für Kinder (EA) 11 Der Gürtel wir enger geschnallt (EA) Zeit pro Posten ca. 40 min. Die SuS erstellen ein Dossier darüber und geben dies am Schluss der ab. HA: Fertigstellung des Dossiers. 4. Doppellektion (GZ 1) LZ 4: Mind. Ein Argument für die Position der Gruppe während der Diskussion formulieren. Lektionsinhalte: PC Beamer Internet Arbeitsblatt Paul Grüninger Link zum Film: - Film „Der Fall Grüninger (53min.) Fragen zum Film beantworten Diskussion über Pro- und Kontra: Die Klasse wird aufgeteilt in ein Lager Pro und eines Contra Flüchtlinge. Die einzelnen Gruppen haben zuerst 10 min. um Argumente zu finden. Danach wird die Diskussion geführt. Die leitet dabei die Diskussion und gibt wenn nötig neue Inputs. 12 Bilder Einstieg 1. Lektion Flüchtlinge aus Frankreich in einer Empfangsstelle im Jura, 1940. (Frankhauser) 13 Flüchtlingsbaracke in St. Margrethen (Meyer, Schneebeli, 2007) 14 3 Literaturverzeichnis Anonym. (2011). Paul Grüninger. Abgerufen am 11. 11 2011: Dindo, R. (Regisseur). (1997). Grüningers Fall. Frankhauser, P. (kein Datum). Swissworld. Abgerufen am 15. November 2011 von weiten_weltkrieg/ Jud, M. (2010). Schweizer Geschichte. Abgerufen am 12. 11 2011 von Keller, S. (1993). Grüningers Fall. Zürich: Rotpunkt. Meyer, H., Schneebeli, P. (2007). Durch die Geschichte zur Gegenwart 3. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich. 4 Abbildungsverzeichnis Abbildung 1: Sowjetische Kriegsgefangene aus Deutschland, in der Schweiz . 3 Abbildung 2 Flüchtlingsbaracke in St. Margrethen (Durch die Geschichte zur Gegenwart 3) 9 15