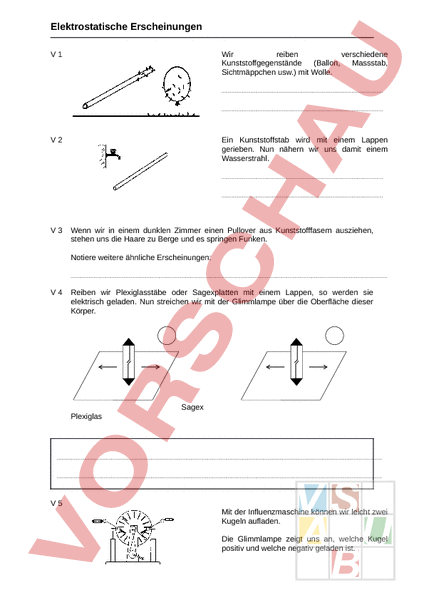Arbeitsblatt: Elektrizität
Material-Details
verschiedene AB
Physik
Elektrizität / Magnetismus
8. Schuljahr
7 Seiten
Statistik
92825
1514
44
19.01.2012
Autor/in
fässler melanie
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Elektrostatische Erscheinungen V1 Wir reiben verschiedene Kunststoffgegenstände (Ballon, Massstab, Sichtmäppchen usw.) mit Wolle. . . V2 Ein Kunststoffstab wird mit einem Lappen gerieben. Nun nähern wir uns damit einem Wasserstrahl. . . V3 Wenn wir in einem dunklen Zimmer einen Pullover aus Kunststofffasern ausziehen, stehen uns die Haare zu Berge und es springen Funken. Notiere weitere ähnliche Erscheinungen: V4 Reiben wir Plexiglasstäbe oder Sagexplatten mit einem Lappen, so werden sie elektrisch geladen. Nun streichen wir mit der Glimmlampe über die Oberfläche dieser Körper. Sagex Plexiglas . . V5 Mit der Influenzmaschine können wir leicht zwei Kugeln aufladen. Die Glimmlampe zeigt uns an, welche Kugel positiv und welche negativ geladen ist. Elektrische Ladung V1 Stäbe aus Plexiglas und anderem Kunststoff werden gerieben. Der eine Stab wird drehbar gelagert. Nun nähern wir die beiden Stäbe einander. . Ladung des 1. Stabes Ladung des 2. Stabes Wirkung Diese Feststellungen fassen wir im Elektrostatischen Grundgesetz zusammen: . . V2 Wir halten verschieden elektrisch geladene Platten in Rizinus- oder Paraffinöl und streuen Griesskörner darauf. Beobachtung: . . . . Der Raum, in dem die elektrischen Abstossungs- und Anziehungskräfte wirksam sind, wird als elektrisches Feld bezeichnet.Ursache der elektrischen Ladung Nach Niels Bohr besteht jedes Atom aus einem Kern und einer Elektronenhülle. Im Kern sind die positiv geladenen Teilchen, die Protonen, und die elektrisch neutralen Teilchen, die Neutronen, eng beisammen. Die Neutronen bewirken, dass sich die Protonen (die ja positiv geladen sind) nicht gegenseitig abstossen. Die negativen Elektronen kreisen mit grosser Geschwindigkeit um den Kern. Bei ungeladenen Körpern hat es in jedem Atom gleich viele Protonen wie Elektronen. Das Atom als Ganzes ist deshalb elektrisch neutral (ungeladen). Durch Reibung können Elektronen aus den Atomen entfernt werden. Dies gelingt umso leichter, je weiter die Elektronen vom Kern entfernt sind. Das zurückbleibende Atom enthält dann mehr Protonen als Elektronen, es ist also positiv geladen. Es können nur Elektronen zu- oder weggeführt werden. Die Protonen lassen sich durch Reiben nicht aus dem Kern entfernen! Negative Ladung bedeutet: . Positive Ladung bedeutet: . Beim Reiben eines Plexiglasstabes mit Seide werden dem Plexiglas Elektronen entrissen. Im Plexiglas sind dann mehr Protonen als Elektronen vorhanden: Der Plexiglasstab ist positiv geladen. Der Seidenlappen fängt Elektronen auf und wird somit negativ geladen. . . . . . Laden Entladen Ladung messen Ein Körper kann auf drei verschiedene Arten geladen werden: . V1 Wir reiben ein Sagexstück mit Wolle und prüfen mit der Glimmlampe: Nun laden wir das Sagexstück erneut auf und fahren mit einer Leuchtstoffröhre darüber. Anschliessend prüfen wir wiederum mit der Glimmlampe. V2 Wir laden zwei Kugeln oder zwei Schüler mit Hilfe der Influenzmaschine entgegengesetzt auf und nähern sie einander. . . . . Die Entladung kann langsam oder sehr schnell vor sich gehen. 3 Wir laden einen Schüler mit der Influenzmaschine auf: . . . V4 Nach dem gleichen Prinzip funktioniert das Elektroskop, ein Ladungsmessgerät. Elektrische Spannung Ladungsunterschied Wir betrachten zwei Gläser, die verschieden hoch mit Wasser gefüllt sind: . . . Das eingefüllte Wasser kann beim Auslaufen Arbeit verrichten und z. B. ein Wasserrad antreiben. Diese aufgespeicherte Arbeit wird als Potential bezeichnet. Je mehr Wasser enthalten ist, umso mehr Arbeit kann verrichtet werden, umso grösser ist also das Potential. Zwischen den beiden verschieden hoch gefüllten Wassergläsern besteht ein Unterschied, eine Potentialdifferenz. Statt mit Wasser gefüllte Gläser denken wir uns zwei verschieden geladene Kugeln: negativ geladen zu viele Elektronen positiv geladen zu wenig Elektronen Den Ladungsunterschied zwischen zwei verschieden oder verschieden stark geladenen Körpern bezeichnet man als elektrische Spannung. Dieser Ladungsunterschied wird auch als Potentialdifferenz bezeichnet. Die Potentialdifferenz ist die Ursache für das Bestreben nach einem Ladungsausgleich. Der italienische Graf Alessandro Volta (1745 1827) beschäftigte sich intensiv mit der Elektrizität. Ihm zu Ehren wird die elektrische Spannung mit Volt gemessen. Elektrische Spannung Symbol: . Masseinheit: Elektrischer Strom Wir betrachten zwei verbundene Gefässe, die verschieden hoch mit Wasser gefüllt sind: Öffnen wir den Hahn des Verbindungsstückes, so gleichen sich die Wasserstände aus, es . Dieser Wasserstrom kann Arbeit verrichten und z. B. ein Wasserrad antreiben. Wir verbinden zwei verschieden geladene Kugeln mit einem Kabel. Wir wissen, dass der Kupferdraht aus Atomen besteht, um deren Kerne Elektronen kreisen. Die äusseren Elektronen sind so weit vom Kern weg, dass sie bei jeder sich bietenden Gelegenheit „abhauen, also vom Kern weggehen. Sie sind praktisch frei beweglich. Stoffe mit frei beweglichen Elektronen sind gute elektrische Leiter: Beispiele: . Stoffe ohne frei bewegliche Elektronen leiten den Strom nicht. Man nennt sie Nichtleiter oder Isolatoren. Beispiele: . Die Stromstärke wird zu Ehren des französischen Naturforschers André Marie Ampère (1775 1836) in Ampere gemessen. Beträgt die Stromstärke 1 A, so fliessen 6,3 1018 Elektronen pro Sekunde. Elektrischer Strom Symbol: . Masseinheit: Definition: . . Der Blitz Benjamin Franklin, Staatsmann und Erfinder, wies 1752 mit einem Drachen nach, dass es sich beim Blitz um eine elektrische Entladung handelt. Beim Drachensteigenlassen ist Vorsicht geboten: die feuchte Drachenschnur kann bei einem Gewitter zu einem höchst gefährlichen elektrischen Leiter werden! Entstehung der Blitze Zu Beginn ist eine Gewitterwolke unscheinbar: Warme, feuchte Luft kühlt sich beim Aufsteigen ab und bildet eine weisse Quellwolke. Wenn sie in kältere Höhen hinaufwächst, gefrieren die Wassertröpfchen zu Eiskristallen. Auf- und abwärts stürzende Winde wirbeln die Eiskristalle durcheinander und erzeugen so positive und negative Ladungen. Es bildet sich der typische Gewitterpilz mit dem ambossförmigen Oberteil. Das Zentrum in der Wolke wird negativ aufgeladen. Diese negative Ladung bewirkt, dass sich auf der Erde positive Ladung ansammelt. Die elektrische Spannung kann so gross werden, dass sie den Blitz auslöst. Die meisten Blitze verlaufen von Wolke zu Wolke, nur etwa jeder vierte Blitz zuckt zur Erde. Faraday- Käfig Der englische Physiker Michael Faraday (1791 1876) bewies mit Experimenten, dass alle elektrischen Ströme auch der Blitz über die Aussenseite eines Metallkäfigs fliessen und keine elektrischen Effekte innerhalb des Käfigs hervorrufen. Um das Eindringen des Blitzes zu verhindern, ist keine vollkommen geschlossene Metallhülle erforderlich! So wirken z. B. Armierungseisen eines Gebäudes aus Stahlbeton oder eine Autokarosserie als FaradayKäfig. Hinweise für das Verhalten bei Gewittern (Auszug aus dem gleichnamigen SEV-Merkblatt) Der Blitz schlägt bevorzugt an Stellen ein, welche die Umgebung wesentlich überragen, z. B. Bäume, Berggipfel, Aussichtstürme, einzelne Hütten, Kapellen. Personen, die sich in der Nähe solcher Orte aufhalten, sind gefährdet. Aber nicht nur am Einschlagpunkt besteht Gefahr, der Umkreis bis etwa 30 vom Einschlagort muss als gefährdet angesehen werden. Wenn ein Teil des Blitzstromes über den Menschen fliesst, dann kann dies zu unwillkürlichen Muskelreaktionen führen, die eine Person einige Meter fortschleudern können. Daher sind auch Stellen zu meiden, die zu einem Absturz führen könnten. Wo ist Schutz zu suchen? 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* in Wohnhäusern in Stahlskelettbauten in Baracken mit zusammenhängenden Blechwänden und -decken in Autos mit Ganzmetallkarosserie, Traktoren mit Metalldach, Ganzmetallwohnwagen in Eisenbahnwagen in Metallkabinen von Seilbahnen, Schiffen oder Lastwagen in grossen Höhlen, in denen man stehen kann, ohne mit dem Kopf nahe zur Decke zu kommen 8* im Innern eines Waldes mit gleichmässig hohem Baumbestand 9* jedoch nicht in der Nähe einzelner Bäume oder herabhängender Äste Zur Not kann Schutz gesucht werden: 10* im Innern von Hütten, Kapellen, Scheunen (nicht an Aussenwände anlehnen!) 11* unter Freileitungen, jedoch nicht in der Nähe von Masten, 12* durch Niederhocken mit geschlossenen Füssen in Bodenmulden, Hohlwegen oder am Fuss von Felsvorsprüngen. Welche Standorte sind gefährdet? 13* einzeln stehende Bäume und Baumgruppen 14* Waldränder mit hohen Bäumen 15* ungeschützte Objekte im freien Feld wie Heuwagen, Aussichtstürme, Unterstände 16* Berggrate und Berggipfel 17* Masten von Freileitungen 18* die unmittelbare Nähe hoher Krane 19* Schwimmbäder und Seen, namentlich deren Ufer 20* ungeschützte Zelte 21* ungeschützte Boote mit Metallmasten 22* der Aufenthalt neben dem Auto, bei Weidezäunen 23* das Tragen von überragenden Gegenständen (Pickel, Ski, Fischerruten usw.) 24* das Anlehnen an Felswände Was ist zu tun bei einem Blitzunfall? Blitzunfälle sind nicht immer tödlich. Bei getroffenen Personen ist daher sofort mit den lebensrettenden Sofortmassnahmen zu beginnen: 25* Beatmung 26* Herzmassage 27* vor Unterkühlung schützen 28* Seitenlagerung 29* Verbrennungen mit steriler Gaze abdecken 30* sofort einen Arzt rufen, mit den lebensrettenden Sofortmassnahmen fortfahren