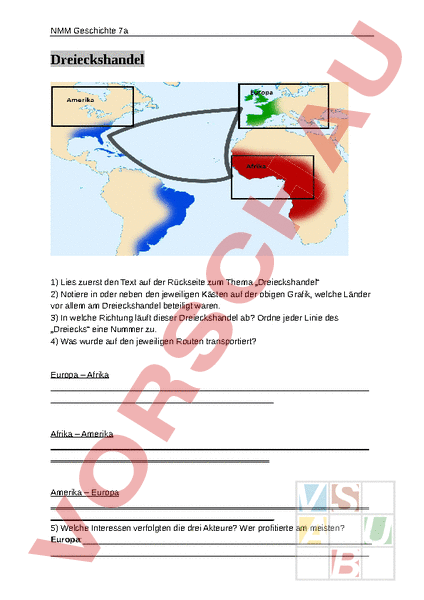Arbeitsblatt: Dreieckshandel Sklaverei
Material-Details
Arbeitsblatt zum Thema Dreieckshandel
Geschichte
Anderes Thema
7. Schuljahr
2 Seiten
Statistik
93915
4722
95
08.02.2012
Autor/in
Ronny Graber
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
NMM Geschichte 7a Dreieckshandel 1) Lies zuerst den Text auf der Rückseite zum Thema „Dreieckshandel 2) Notiere in oder neben den jeweiligen Kästen auf der obigen Grafik, welche Länder vor allem am Dreieckshandel beteiligt waren. 3) In welche Richtung läuft dieser Dreieckshandel ab? Ordne jeder Linie des „Dreiecks eine Nummer zu. 4) Was wurde auf den jeweiligen Routen transportiert? Europa – Afrika Afrika – Amerika Amerika – Europa 5) Welche Interessen verfolgten die drei Akteure? Wer profitierte am meisten? Europa: NMM Geschichte 7a Afrika: Amerika: Sonstige Bemerkungen: Der Deieckshandel Beginn derGlobalisierung Im 18. Jahrhundert kommen in Europa die „Kolonialwaren – tropische Produkte – in Mode: unter anderem Kaffee, Tabak, Zucker, Kakao, Baumwolle und Reis. Daraus entwickelte sich ein Bedürfnis der Europäer für diese Produkte. Um die Nachfrage befriedigen zu können, brauchte man mehr Sklaven, die auf den Plantagen in Nordamerika, auf karibischen Inseln und Brasilien arbeiteten. Der Dreieckshandel Europa – Afrika – Amerika kennt mehrere Varianten. Der portugiesische Handel verbindet direkt den Golf von Guinea und Angola mit Brasilien: Das ist der kürzeste und schnellste Weg. Er ist am wenigsten kostspielig – sowohl an Kapital als auch an Menschenleben. Die durchschnittliche Dauer dieser Reise beträgt 18 Monate. Im Lauf des 17. und 18. Jahrhunderts ändert sich die Rangfolge der im Sklavenhandel tätigen Länder: Zu Beginn dominieren die Engländer und Holländer. Der französische Handel beginnt erst spät (1673) und in kleinem Masse. Dafür überflügelt Frankreich im 18. Jahrhundert Holland bei weitem und wird, nach England, die zweite grosse Sklavenhandelsnation. Mehrere andere Länder wie Schweden und Dänemark sind ebenfalls in kleinem Umfang im Sklavenhandel tätig. Spanien und Portugal betreiben kaum mehr Sklavenhandel. Schliesslich nimmt Brasilien einen immer grösser werdenden Platz ein und wird eine Zeit lang zu Beginn des 19. Jahrhunderts, die wichtigste Nation im „Ebenholz-Handel (anderes Wort für Sklavenhandel). Die Sklavenhändler aus Europa tauschten an der afrikanischen Küste europäische Manufakturwaren wie Textilien, Werkzeuge, Feuerwaffen, Metall- und Glaswaren gegen Sklaven. Diese wurden auf Sklavenschiffen nach Amerika transportiert, wo sie auf Zuckerrohr-, Baumwoll-, Kaffee-, Kakao- und Tabakplantagen und in Bergwerken arbeiten mussten. Die Händler kauften dann die Produkte und Rohstoffe dieser Plantagen und Minen und verkauften sie in Europa mit Profit weiter. Ein Sklave, den man in Afrika für Tauschartikel im Wert von fünf Gulden erwerben konnte, brachte in Amerika das Zehnfache in Zucker ein, der in Europa wiederum für ein Vielfaches verkauft werden konnte! Damit nahm die Globalisierung der Wirtschaft ihren Anfang. Das handelspolitische Interesse der europäischen Staaten zielte allein darauf ab, möglichst grossen Nutzen aus ihren Kolonien zu ziehen. Diese Handelsbeziehungen waren von Beginn weg einseitig ausgerichtet, die Kolonien waren Ausbeutungsobjekte und niemals gleichgestellte Handelspartner. Die Europäer beluden ihre Schiffe mit Gütern und Fabrikwaren aus Europa, insbesondere Textilien, wofür sie in Afrika schwarze Sklaven erwarben. Diese wurden in den amerikanischen Kolonien wiederum gegen Zucker, Baumwolle, Tabak und andere koloniale Rohstoffe eingetauscht. Dieser Handelskreislauf prägte die wirtschaftliche Entwicklung der drei Kontinente. In Europa wurden die industrielle Produktion und somit die Entstehung von Fabriken und Arbeitsplätzen angekurbelt und die Schiffsindustrie, besonders in Grossbritannien, blühte auf. Die steigende Nachfrage der afrikanischen Herrscher nach europäischen Fertigwaren, insbesondere Kleidern, zwang sie dazu, den Europäern ein interessantes Tauschgeschäft anbieten zu können. Da sie im Vergleich zu ihrer Konkurrenz in Asien und Amerika kaum NMM Geschichte 7a über Produkte und Rohstoffe als Handelswaren verfügten, verlegten sie sich auf den Handel mit menschlichen Waren, den Sklaven. So waren in Afrika bald unzählige Einheimische mit dem Einfangen ihrer Landsleute beschäftigt. Nach dem Verbot des Sklavenhandels für britische Staatsbürger 1807 übte Grossbritannien Druck auf andere Kolonialmächte aus, um keine Handelsnachteile zu haben. Von Grossbritannien bedrängt beschlossen die politischen Mächte Europas im Wiener Kongress 1815 die Ächtung der Sklaverei aus humanitären Gründen.