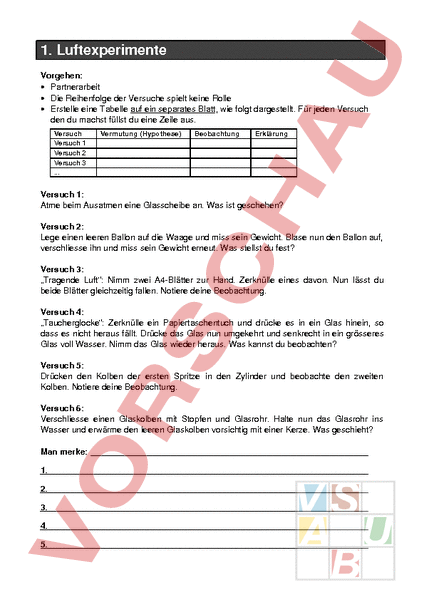Arbeitsblatt: Schülerskript Thema Atmung
Material-Details
Das Skript für Schüler zum Thema Atmung mit Theorie und Experimenten.
Biologie
Anatomie / Physiologie
1. Schuljahr
15 Seiten
Statistik
94074
1314
32
08.02.2012
Autor/in
Marco Zgraggen
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
1. Luftexperimente Vorgehen: • Partnerarbeit • Die Reihenfolge der Versuche spielt keine Rolle • Erstelle eine Tabelle auf ein separates Blatt, wie folgt dargestellt. Für jeden Versuch den du machst füllst du eine Zeile aus. Versuch Versuch 1 Versuch 2 Versuch 3 . Vermutung (Hypothese) Beobachtung Erklärung Versuch 1: Atme beim Ausatmen eine Glasscheibe an. Was ist geschehen? Versuch 2: Lege einen leeren Ballon auf die Waage und miss sein Gewicht. Blase nun den Ballon auf, verschliesse ihn und miss sein Gewicht erneut. Was stellst du fest? Versuch 3: „Tragende Luft: Nimm zwei A4Blätter zur Hand. Zerknülle eines davon. Nun lässt du beide Blätter gleichzeitig fallen. Notiere deine Beobachtung. Versuch 4: „Taucherglocke: Zerknülle ein Papiertaschentuch und drücke es in ein Glas hinein, so dass es nicht heraus fällt. Drücke das Glas nun umgekehrt und senkrecht in ein grösseres Glas voll Wasser. Nimm das Glas wieder heraus. Was kannst du beobachten? Versuch 5: Drücken den Kolben der ersten Spritze in den Zylinder und beobachte den zweiten Kolben. Notiere deine Beobachtung. Versuch 6: Verschliesse einen Glaskolben mit Stopfen und Glasrohr. Halte nun das Glasrohr ins Wasser und erwärme den leeren Glaskolben vorsichtig mit einer Kerze. Was geschieht? Man merke: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2. Zusammensetzung der Atemluft Experiment 1 Eine brennende Kerze verbraucht Sauerstoff (O 2). Stelle eine brennende Kerze in eine wassergefüllte Petrischale und stülpe einen Glaszylinder darüber. Stoppe die Zeit, bis die Kerze erlischt. Notiere dir die Zeit in der untenstehenden Tabelle! Stelle den Standzylinder mit der Öffnung nach unten auf den Tisch. Halte unter den Rand des Glaszylinders ein Trinkhalm. Blase mehrmals hintereinander Ausatmungsluft hinein. Stülpe nun den Zylinder wieder über die brennende Kerze und stoppe ebenfalls die Zeit. Notiere die gestoppte Zeit wiederum in der Tabelle und vergleiche die Zeiten miteinander. Brenndauer der Kerze „normale Luft Ausatmungsluft Man merke: 2. Zusammensetzung der Atemluft Experiment 2 1. Im Mineralwasser ist häufig Kohlensäuregas (Kohlenstoffdioxid, CO2) gelöst. Das Kohlensäuregas aus der Mineralwasserflasche wird in Kalkwasser geleitet. Was stellst du fest? Wie erklärst du dir deine Beobachtung? Beobachtung: 2. Atme nun mit einem Trinkhalm deine Ausatmungsluft ebenfalls in frisches Kalkwasser. Was passiert? Was kannst du daraus folgern? Beobachtung: 3. Leite frische Luft mit dem Blasebalg in Kalkwasser. Notiere und erkläre deine Beobachtung. Beobachtung: Man Merke – aus den Versuchen 1, 2 und 3 folgt: Aus Experiment 1 und 2 folgt: 2. Zusammensetzung der Atemluft Übertrage die Prozentwerte in die entsprechenden Säulen (1% entspricht 1mm). Verwende für jedes Gas eine andere Farbe: • Sauerstoff – rot • Kohlendioxid – blau • Stickstoff und Edelgase gelb Eingeatmete Luft Sauerstoff (O2) 21% Kohlendioxid (CO2) 0.03% Stickstoff Edelgase (N2) Ausgeatmete Luft und 78.97 Ausgeatmete Luft Sauerstoff (O2) 17% Kohlendioxid (CO2) 4.03% Stickstoff (N2) und Edelgase 78.97 3. Der Weg der Atemluft Ausatmungsluft Einatmungsluft Film Notiere dir zehn Aussagen aus dem Film auf ein separates Blatt. Während dem Film werden keine Notizen gemacht! Text Lies den Text. Unterstreiche die Atemorgane rot und deren Funktionen grün. Halt mal die Luft an! So sehr du dich auch anstrengst, mehr als 1 bis 2 Minuten ohne zu atmen schaffst du nicht. Unser Körper benötigt ständig Atemluft. Sie kann durch Nase oder Mund ein und ausgeatmet werden. Du solltest die Luft aber möglichst durch die Nase einatmen. An den Wänden der Nasenhöhle wird die Luft vorgewärmt. Ausserdem bleiben aufgenommene Staubteilchen an der Nasenschleimhaut hängen, und die Luft wird mit Feuchtigkeit angereichert. Die Nasenhöhle geht in den Rachenraum über. Hier kreuzen sich Luft und Nahrungsweg. Der Kehldeckel verhindert, dass beim Schlucken Speiseteile in die Atemwege gelangen. Darunter liegt der Kehlkopf. Im Kehlkopf entsteht mit Hilfe der Stimmbänder die Stimme. An den Kehlkopf schliesst sich die 10 bis 15 cm lange Luftröhre an. Sie wird durch elastische, ringförmige Knorpelspangen gebildet. Ähnlich wie beim Schlauch eines Staubsaugers verhindern sie, dass die Luftröhre beim Einatmen zusammengedrückt wird. An ihrem unteren Ende verzweigt sich die Luftröhre in zwei Hauptäste, die Bronchien. Die Bronchien verästeln sich so weit, dass sie insgesamt an einen auf den Kopf gestellten Baum erinnern. Luftröhre und Bronchien sind mit Flimmerhärchen ausgekleidet. Sie sorgen durch ständige Bewegung dafür, dass eingeatmete Staubteilchen wieder nach aussen transportiert werden. Am Ende der feinsten Verästelungen der Bronchien sitzen winzige Lungenbläschen. Bis hierher muss die Atemluft gelangen. Mehrere hundert Millionen solcher Lungenbläschen bilden das schwammartige Lungengewebe, das von vielen Blutkapillaren durchzogen ist. Die Lunge besteht aus zwei voneinander getrennten Hälften, dem rechten und dem linken Lungenflügel. Da die Lunge keine Muskeln besitzt, kann sie selbst keine Atembewegungen ausführen. Wie erfolgt aber das Atmen? Gleich einem Blasebalg vergrössert sich beim Einatmen der Brustraum, während er sich beim Ausatmen verkleinert. Die Lunge, die den Brustraum ausfüllt, macht jede Vergrösserung und Verkleinerung mit. Auf diese Weise wird Atemluft eingesogen oder ausgepresst. 3. Der Weg der Atemluft Beschrifte die Bilder mit Hilfe des Textes! Längsschnitt durch den Kopf: Vorderansicht der beiden Lungenflügel: 1 1 2 2 4 3 4 3 5 5 8 7 6 6 7 8 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. Die Atemwege werden unterteilt in obere (Nase, Nasennebenhöhlen und Rachenraum) und untere Atemwege (Kehlkopf, Luftröhre, Bronchien und Lunge). Zeichne nun auf ein separates Blatt den gesamten Weg der Atemluft in einem Bild. Lege das Skript zur Seite und versuche zuerst ohne Hilfe den Weg der Atemluft zu zeichnen. Lies nochmals die zehn Aussagen aus dem Film durch und tausche sie mit deinem Nachbarn aus. Wie würdest du den Film kommentieren? Schauen wir mal. 3. Der Weg der Atemluft Die Luft dringt bei normaler Atmung durch die in unseren Körper ein. Zuerst wird sie durch grob gefiltert. Feuchte Schleimhäute halten und zurück und die Luft beim Schnupfen schwellen die Schleimhäute an und geben zu viel Flüssigkeit ab. Weiter wird die Luft durch die stark durchbluteten Nasenmuscheln und durch die auf ihre Verträglichkeit geprüft. Im wird die Luft weiter befeuchtet und hier kreuzen sich und. Der schliesst beim Schlucken die ab und verhindert so das Eindringen von Nahrung. Der dient der Tonerzeugung (Stimme). Die ist ein ca. 12cm langer, elastischer Schlauch, der durch 16 bis 20 hufeisenförmige offen gehalten wird. Die Innenseite der Luftröhre ist ausgekleidet mit Schleimhautzellen, die feinste tragen diese schlagen ständig Richtung Rachen und transportieren so kleine nach oben, wo diese durch Husten ausgeschieden werden können. Schliesslich teilt sich die Luftröhre in zwei gleichlange Äste, die , von denen jede in einen Lungenflügel führt. In den verästeln sich die Bronchien weiter bis in feinste Zweige. An deren Ende befinden . sich Hier traubenartige findet Gebilde jetzt von winzigen schliesslich der von und statt. Dieser Vorgang heisst äussere Atmung. 4. Gasaustausch in den Lungenbläschen In den traubenartigen Lungenbläschen ( Alveolen), die mit einem dichten Netz von feinsten Blutgefässen ( Kapillaren) umsponnen sind, findet der Gasaustausch zwischen dem Blut und der Luft statt. Es gibt ca. 300 Mio. Lungenbläschen von je etwa 0,2 mm Durchmesser mit einer Gesamtoberfläche von fast 100 m2. Ihr Innenraum ist mit sauerstoffreicher, frisch eingeatmeter Luft gefüllt. An ihrer Aussenwand wird durch das Netz der Haargefässe das aus dem Körper kommende, mit Kohlendioxid beladene Blut vorbeigeführt. Das Blut und die eingeatmete Luft sind nur durch eine sehr dünne, ca. 0,004 mm dicke Wand voneinander getrennt, die nur für gasförmige Stoffe durchlässig ist. So kann das Kohlendioxid (CO2) ungehindert aus dem Blut in die Lungenbläschen übertreten und gleichzeitig der Sauerstoff (O2) von den Lungenbläschen in das Blut eindringen. Die folgende Abbildung zeigt schematisch einen Schnitt durch ein Lungenbläschen (Alveole), dessen Funktion hier dargestellt werden soll. Ordne den Nummern folgende Begriffe zu: sauerstoffreiches Blut Kohlendioxid sauerstoffarmes Blut Ausatmungsluft feine Blutgefässe Lungenbläschen Sauerstoff Einatmungsluft Gib dem sauerstoffreichen Blut eine rote, dem sauerstoffarmen Blut eine blaue Farbe. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 5. Innere Atmung und äussere Atmung Man unterscheidet die innere Atmung und die äussere Atmung Die äussere Atmung ist das „Atmen (Einatmen und Ausatmen von Luft und der Gasaustausch (O2, CO2) in der Lunge. Die innere Atmung meint die Energieumwandlung in den Zellen. Bei diesem Vorgang reagieren Nährstoffmoleküle (Zucker) in den Zellen mit 2 und setzen Energie frei. Als Abbauprodukt entsteht CO2. Wie atmet denn das Kind im Mutterleib? Stelle Vermutungen auf, wie das Kind im Mutterleib atmen kann? Notiere deine Vermutungen auf ein separates Blatt. Man merke: 6. Atemfrequenz und Lungenvolumen Setz dich bequem und aufrecht auf den Stuhl. Atme normal ein und aus. Dein Partner (deine Partnerin) zählt deine Atemzüge während einer Minute (Ein und Ausatmen ein Atemzug) Mein Messwert pro Minute in Ruhephase: Spring so schell als möglich während einer Minute mit dem Seil. Dein Partner (deine Partnerin) stoppt die Zeit und zählt anschliessend an die Übung sofort während einer Minute deine Atemzüge. Anzahl Atemzüge pro Minute nach körperlicher Bewegung: Vergleiche nun folgende Werte bezüglich der Atemzüge beim Menschen: Neugeborenes: 40 bis 60 Atemzüge pro Minute Teenager: 20 bis 30 Atemzüge pro Minute Erwachsener: 16 bis 20 Atemzüge pro Minute Wovon hängt die Anzahl und Tiefe der Atemzüge ab? Messung der Vitalkapazität (Luftvolumen, das maximal ein und ausgeatmet werden kann ): Nimm einen Rundballon und blase ihn zwei bis dreimal auf, damit er geschmeidig wird. Atme soviel Luft wie möglich ein, halte die Luft an. Nimm den Ballon an den Mund und blase alle Luft aus der Lunge in den Ballon hinein. Verschliesse den Ballon mit einem Knopf. Tauche den Ballon in einen mit Wasser gefüllten Kessel, bei dem man die Wassermenge ablesen kann. Etwa 1.5 Liter Luft bleiben immer in der Lunge. Zählt man diesen Wert zur Vitalkapazität hinzu, so erhält man die Totalkapazität, welche 3.5 – 4 Liter beträgt. Bei normaler Atmung werden pro Atemzug etwa 0.5 Liter Luft ein und wieder ausgeatmet. 7. Brust und Zwerchfellatmung Die Lungen liegen gut geschützt unter den Rippen, eingebettet und luftdicht verpackt in einem doppelwandigen Sack, der aus Rippenfell und Lungenfell gebildet wird. Das Lungenfell umgibt die Lungenflügel, das Rippenfell kleidet die Innenwand des Brustkorbes aus. Zwischen den zwei Häuten befindet sich ein kleiner, spaltförmiger Raum, der eine wässrige Flüssigkeit enthält. So können sich die beiden Häute wie zwei nasse Glasplatten gegeneinander verschieben, ohne sich voneinander zu entfernen. Die Brustatmung Beim Einatmen ziehen sich die Zwischenrippenmuskeln zusammen und heben so die Rippen. Das mit den Rippen verwachsene Rippenfell macht die Bewegungen mit und zieht das Lungenfell ebenfalls mit sich. Dadurch wird die Lunge passiv gedehnt, der Raum in den Lungenbläschen vergrössert sich und die Luft kann durch Luftröhre und Bronchien einströmen. Beim Ausatmen erschlaffen die Zwischenrippenmuskeln und der Brustkorb senkt sich. Der Brustraum verkleinert sich und die Luft wird aus der Lunge hinaus gepresst. Die Zwerchfellatmung Einatmen: Zieht sich die Zwerchfellmuskulatur zusammen, spannt sich das Zwerchfell und senkt sich nach unten. Das Lungenvolumen nimmt zu. Ausatmen: Lässt die Spannung des Zwerchfells nach, wird es nach oben gedrückt. 8. Sezieren 8. Sezieren (Vorgehen nur für LP) A) Klasse in 4 Gruppen aufteilen (je nach Lust am sezieren.) 1. 2. 3. 4. Gruppe: sehr interessiert Gruppe: interessiert Gruppe: so la la Gruppe: Ekel (nachfragen) B) Gruppen neu durchmischen C) Unterschied Schweinlunge Menschenlunge thematisieren! Überblick über Lunge im Plenum anschauen (Auftrag 1.) D) Aufgaben in der Gruppe: 1. Sezierchef/in 2. Protokollchef/in 3. Präsentator/in 4. Hilfssezierer/in E) Pflichtaufgaben den Gruppen zuordnen: 1. Gruppe: Aufgabe 2 und 3 2. Gruppe: Aufgabe 4 3. Gruppe: Aufgabe 5 und 6 4. Gruppe: Aufgabe 7 und 8 9. Erkrankung der Atemwege Schnupfen Die häufigste Krankheit des Menschen ist der Schnupfen. Besonders oft sind Schulkinder erkältet: durchschnittlich plagt sie zweimal im Jahr dieses Leiden. Eine plötzliche Abkühlung und der Schnupfen ist da. Die Ursache ist ein kleiner Erreger, der sich in den Nasenschleimhäuten einnistet. Diese Erreger, in der Fachsprache Viren genannt, werden von den erkrankten Personen ausgeniest, ausgehustet oder nur ausgeatmet. Auf diese Art werden viele Gesunde, z. B. in vollen Schulbussen, angesteckt. Etwa zwei Tage danach beginnt die Krankheit mit Niesen, die Nase läuft, die Augen tränen und die Nasenschleimhäute schwellen an. Leichtes Fieber, Halsschmerzen und Husten begleiten den Schnupfen. Im Normalfall ist die Erkältung nach einer Woche überstanden. Ein hartnäckiger Husten kann noch weitere Beschwerden verursachen, ebenso eine Entzündung der Nebenhöhlen. Dabei werden Hohlräume, die beiderseits der Nase und über der Nase in den Schädel eingebettet sind, befallen. Bronchitis Auch andere Abschnitte der Atemwege können von Entzündungskrankheiten befallen werden. Ist die Luftröhre betroffen, so spricht man von Luftröhrenkatarr. Beim üblichen Husten sind häufig die Bronchien entzündet (Bronchitis). Lungenentzündung Bei einer Lungenentzündung sind die Lungenbläschen erkrankt: Man unterscheidet verschiedene Formen, je nachdem, ob ein ganzer Lungenlappen oder nur Teile befallen sind. Eine Röntgenuntersuchung gibt dem Arzt Auskunft über die Ausdehnung und den Luftgehalt der Lunge; die erkrankten Stellen sind als Schatten sichtbar. Häufig entsteht eine Lungenentzündung im Verlauf einer anderen Krankheit. Bei Kindern besteht diese Gefahr nach Masern, Keuchhusten und Diphtherie, bei älteren Menschen nach einer Grippe oder einer Bronchitis. Da diese Menschen durch die Krankheit geschwächt sind, kann die Lungenentzündung gefährlich werden. In den meisten Fällen aber kann der Arzt die Krankheit mit Medikamenten heilen. Lungentuberkulose Die von ROBERT KOCH 1883 entdeckten Tuberkelbakterien verursachen die Lungentuberkulose. Man erkrankt, wenn man die Bakterien einatmet. Da Tuberkulosekranke oft husten, besteht die Gefahr sehr leicht. Erste Anzeichen dieser Erkrankung sind Mattigkeit, abendliches Fieber und Nachtschweiss. Später kommen Husten, Auswurf, Abmagerung, Durchfälle und höheres Fieber hinzu. Für eine Heilung ist es günstig, wenn die Krankheit früh erkannt wird. In speziellen Lungensanatorien werden die Patienten behandelt und dank moderner Mittel meist geheilt. Bronchialasthma Allergien und seelische Belastungen können zu Krämpfen der Muskulatur der Atemwege führen. Dabei ziehen sich die Muskeln der Bronchien zusammen, verengen den Atemweg stark und behindern besonders die Ausatmung. Die an Bronchialasthma erkrankten Menschen atmen deshalb leichter ein als aus. Die Zufuhr sauerstoffreicher Frischluft ist begrenzt, da verbrauchte Luft in den Lungen zurückbleibt. Die Erkrankten leiden unter Atemnot und müssen krampf und schleimlösende Mittel einnehmen. Höhenkrankheit Der Sauerstoffgehalt der Luft nimmt mit zunehmender Höhe ab. Dies kann oberhalb von 3000 für den Menschen bereits gefährlich sein. Strengen sich Menschen in dieser Höhe zu sehr an, so kann der gesteigerte Sauerstoffbedarf nicht mehr gedeckt werden. Besonders bei Herz und Lungenkranken können schwere Störungen auftreten. Starke Kopfschmerzen sind ein erstes Warnzeichen. Dieser Höhenrausch führt dann nicht selten zu Fehlleistungen, die z. B. beim Bergsteigen gefährliche Folgen haben können. Von der Höhenkrankheit befallene Menschen leiden an Bewusstseinsstörungen und können ihre Bewegungen nicht mehr kontrollieren. Dazu kommt auch noch, dass die niedrige Umgebungstemperatur die Atemleistung erhöht, um die notwendige Körpertemperatur zu erhalten. In den Bergen sind deshalb wärmeisolierende Kleidung und eine wenig belastende Ernährung sinnvoll. Fragen zum Text 1.) Um welche Erkrankung handelt es sich, wenn die Luftröhre von einer Entzündungskrankheit befallen ist? 2.) Welcher Abschnitt der Atemwege ist bei einer Lungenentzündung betroffen? 3.) Warum kann es oberhalb von 3000 Meter über Meer zur Höhenkrankheit kommen? 4.) Welches ist die häufigste Krankheit der Atemwege? Warum wird man relativ einfach mit einem Schnupfen angesteckt? 6.) Beschreibe die Erkrankung Bronchialasthma. 7.) Weshalb erkrankt man an Lungentuberkulose und welches sind die Symptome der Krankheit?