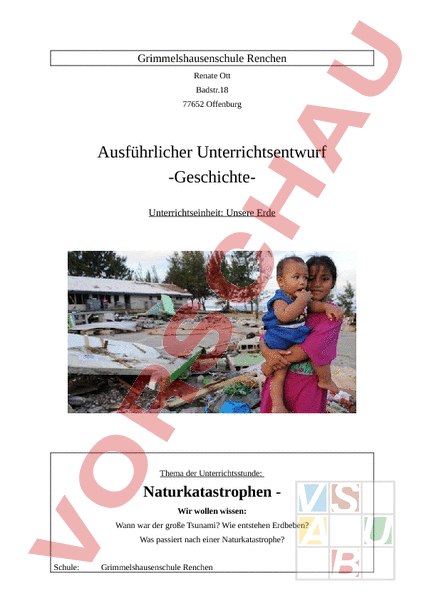Arbeitsblatt: Naturkatastrophen - Wir wollen wissen: Wann war der große Tsunami? Wie entstehen Erdbeben? Was passiert nach einer Naturkatastrophe?
Material-Details
Eine Unterrichtsentwurf zu Naturkatastrophen (Tsunami, Erdbeben, ...) Die Fragen der Schüler wurden in Stationenarbeit beantwortet
Geographie
Geologie / Tektonik / Vulkanismus
5. Schuljahr
12 Seiten
Statistik
97190
1338
51
11.04.2012
Autor/in
Andrej Springer
Land: Deutschland
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Grimmelshausenschule Renchen Renate Ott Badstr.18 77652 Offenburg Ausführlicher Unterrichtsentwurf -GeschichteUnterrichtseinheit: Unsere Erde Thema der Unterrichtsstunde: Naturkatastrophen Wir wollen wissen: Wann war der große Tsunami? Wie entstehen Erdbeben? Was passiert nach einer Naturkatastrophe? Schule: Grimmelshausenschule Renchen Fach: Klasse: WZG 5 Datum: 31.01.2012 Zeit: 13:25 – 14:10 Uhr Inhalt 2 1. Rahmenbedingungen 1.1 Blick auf die Schule Die Grimmelshausenschule ist eine Verbundschule, bestehend aus Grund-, Haupt- und Realschule. Die Grundschule befindet sich in einem gesonderten Gebäude an der Hauptstraße, während Haupt- und Realschüler1 im Gebäude in der Friedhofstraße unterrichtet werden. Insgesamt unterrichten 68 Lehrkräfte unter der Leitung von Herrn Ralf Moll für 32 Schulklassen, ca. 810 Schüler. Renchen als eine Kleinstadt am Rande des Schwarzwaldes verdankt seinen Titel als „Grimmelshausenstadt dem gleichnamigen Barockdichter, der hier 1667-1676 als Bürgermeister fungierte. Besonders engagiert zeigt sich die Schule im Umweltbereich, unter anderem deutlich in der Teilnahme an einem Programm des Landes Baden-Württemberg zur Visualisierung des Energieverbrauchs. Das Ziel der Grimmelshausenschule in Renchen ist: Die Bildung einer ganzheitlichen Persönlichkeit, die eigenverantwortlich ihren Weg geht und sich ihrer Verantwortung gegenüber den Mitmenschen und der Umwelt bewusst ist. Diese Ziele finden sich in den drei Säulen des Leitbildes der Grimmelshausenschule wieder: • Methodenkompetenz • Umwelt und Nachhaltigkeit • Soziale Kompetenz Soziales Lernen 1.2 Blick auf die Klasse Die Klasse 5 der Werkrealschule wird von insgesamt 19 Schüler,6 Mädchen und 13 Jungen besucht. Ich unterrichte sie zwei Stunden in der Woche im Fächerverbund Welt-ZeitGesellschaft. Insgesamt ist die Klasse recht lebhaft. Es ist daher in regelmäßigen Abständen notwendig, auf bestehende (Gesprächs-)Regeln hinzuweisen. Ein nennenswertes Problem hinsichtlich des Arbeitsverhaltens ist, dass die Jugendlichen sich teilweise schnell ablenken lassen und in Gespräche verfallen, die den Unterricht stören. Hierzu habe ich vor einiger Zeit ein System eingeführt, in dem ich nach einer einmaligen Verwarnung dem entsprechenden Schüler eine gelbe Karte auf den Tisch lege. Die Klasse weiß, dass bei einer weiteren Störung direkt eine rote Karte in Verbindung mit einer Strafarbeit folgt. Zusätzlich verwende ich einen Dreiklang als akustisches Signal für gewünschte Ruhe. 1Im weiteren Verlauf wird auf die sprachliche Differenzierung männlich/ weiblich verzichtet. Wird nicht explizit darauf hingewiesen, sind grundsätzlich beide Geschlechter gemeint. 3 Die Schüler sitzen im Klassenzimmer in immer wieder wechselnden Sozialformen. Sie sind an Einzel-, Partner- sowie Gruppenarbeit gewöhnt. Die Schüler kennen verschiedene Methoden des kooperativen Lernens. Was das Leistungsvermögen der Klasse angeht, gibt es große Unterschiede. Neben Schülern, die konzentriert Themen erarbeiten können, gibt es auch Schüler, die große Schwierigkeiten haben Inhalte zu erfassen und sie sich zu merken. Um den Anforderungen gerecht zu werden braucht es ein hohes Maß an Differenzierung. Im Folgenden beschreibe ich einige Schüler, die ihres Leistungsvermögens bzw. ihres Verhaltens wegen oft besondere Aufmerksamkeit benötigen. Elias und Wendell bringen im Unterricht fundierte Beiträge, wobei es jedoch beiden schwer fällt, sich längere Zeit auf ihre Arbeit zu konzentrieren. Domenico und Jannick ziehen immer wieder gerne die Aufmerksamkeit aller auf sich, durch lautes Lachen und lauten Kommentaren. Meine methodisch-erzieherische Konsequenz für den Unterricht besteht darin, dass ich sie direkt anspreche und auf das Kartensystem hinweise. Besonders zu erwähnen scheint mir an dieser Stelle außerdem der Schüler Denis. Er wird oft aus der Klassengemeinschaft ausgeschlossen und arbeitet kaum mit. Aufgrund seiner schwach ausgeprägten Lese- und Rechtschreibkompetenzen erhält er oft Hilfestellung und Zeit nach seinem Lerntempo zu arbeiten. Auf seine wenigen Wortmeldungen versuche ich deshalb immer besonders einzugehen und diese positiv hervorzuheben. Die Mädchen, Zep, Selina und Sabrina sind sehr zurückhaltend und bringen sich in Unterrichtsgesprächen kaum ein. Ich versuche sie zu motivieren, ihr Wissen und ihre Vorerfahrungen im Unterricht zu äußern. 4 2. Blick auf die Sache 2.1 Wann war der große Tsunami? Was ist ein Tsunami? Ein Tsunami, auch seismische Woge genannt, wird durch ein untermeerisches Erdbeben ausgelöst. Es handelt sich dabei um eine extrem langfrequentige Flutwelle. (1)Er kündigt sich manchmal wie eine Sturmflut durch plötzliches Anschwellen des Ozeans an. Er kann bis zu 950 km/h. erreichen. An der Küste türmen sich ihre Wellen bis zu 30m hoch auf. Tsunamis bestehen oft aus einer ganzen Wellenkette, und die erste Welle ist selten die größte. Wahre Wasserwände können stundenlang auf die Küste zurollen. Oft dringt das Wasser ins Binnenland, überflutet Äcker und verwüstet Städte. (2) Wann war der große Tsunami? Beschränkt auf Tsunamis im 21. Jahrhundert 21. Mai 2003 26. Dez. 2004 17. Juli 2006 2. April 2007 30. Sept. 2009 25. Okt. 2010 11. März 2011 5 Erdbeben vor Algerien tötete mehr als 2000 Menschen und löste einen kleinen Tsunami aus, der auf Mallorca und Ibiza zu lokalen Überschwemmungen führte. Durch ein Erdbeben im Indischen Ozean vor der Insel Sumatra, ereignete sich eine der bisher schlimmsten Tsunamikatastrophen der Geschichte. Mindestens 231.000 Menschen in acht asiatischen Ländern wurden getötet. Die Wellenenergie breitete sich mehrere tausend Kilometer bis nach Ost- und Südostafrika aus und forderte als Flutwelle dort weitere Opfer. Ein Seebeben vor der indonesischen Insel Java löste einen Tsunami aus, durch den über 700 Menschen ums Leben kamen. Ein Seebeben bei den Salomonen der Stärke 8,0 löste im Südpazifik einen Tsunami aus, der die Salomonen-Inseln verwüstete. Die Flutwelle war bis zu zwölf Meter hoch. Es wurden mindestens 12 bis 20 Menschen getötet. Ein Erdbeben vor der Küste der Samoainseln mit der Stärke 8,0 löste einen Tsunami aus, der Teile der Insel verwüstete. Nach ersten Berichten kamen dabei mindestens 80 bis 100 Menschen ums Leben. Ein Erdbeben der Stärke 7,2 bis 7,5 löste auf den Mentawai-Inseln vor Sumatra einen Tsunami mit gut drei Meter hoher Flutwelle aus, die bis zu 600 Meter landeinwärts drang. Mindestens 272 Tote und weitere Vermisste. In Folge eines Erdbebens der Stärke 9,0 traf ein Tsunami mit einer Höhe bis zu 23 Metern die ostjapanische Küste vor Tōhoku. Die Flutwellen breiteten sich über den gesamten Pazifikraum aus, trafen die Küsten anderer Länder aber weniger stark als zunächst befürchtet. Noch Wochen später waren diverse Nachbeben und neue starke Erdbeben zu spüren. Bestätigt sind bisher 11.500 Todesopfer und 16.400 Vermisste. Durch diesen Tsunami wurde auch die Nuklearkatastrophe von Fukushima ausgelöst. Ebenso lösten sich in der ca. 13000 km entfernten Antarktis größere Eisberge vom Schelfeis, dies konnte mittels dem EnvisatSatelliten beobachtet werden. (3) 2.2 Wie entstehen Erdbeben? Was ist ein Erdbeben? Ein Erdbeben ist eine Erschütterung eines Teils der Erdoberfläche und des Erdinneren, die von einem Erdbebenherd ausgehen. Die Erschütterungen können sich auch über die ganze Erde ausbreiten, dann spricht man von einem Weltbeben. Verheerende Katastrophen richten besonders die gefürchteten Seebeben an, da sie Tsunamis auslösen können. Diese Beben unter dem Meeresgrund können noch weit entfernt vom Bebenherd die Küsten völlig verwüsten. (1) Ein Erdbebenherd ist ein tief gelegener Punkt, zumeist in der Erdkruste oder im Erdmantel, von dem die Erschütterung ausgeht. (1)Schätzungen zufolge verloren während der letzten 500 Jahren mehr als sieben Millionen Menschen durch Erdbeben ihr Leben. (1) Warum bebt die Erde? Die Erdkruste ist die äußerste Schicht unseres Planeten. Sie besteht aus riesigen Einzelteilen, den tektonischen Platten, die sich wie ein Puzzle zusammenfügen. Diese Platten bewegen sich sehr langsam auf dem Magma fort, einem flüssigen Gestein im Erdinneren. Durch die Bewegung können Erdbeben entstehen. Die Beben sind besonders heftig, wenn die Platten zusammenstoßen oder sich beim Gleiten ineinander verhaken. Die meisten Erdbeben entstehen an den Rändern der Platten. Abbildung Tektonische Platten der Erde 2.3 Was passiert nach einer Naturkatastrophe? Nach einem Erdbeben oder Tsunami Erdbeben und Tsunamis sind so mächtig, dass sie tausende Kilometer zerstören und Küstenlinien verändern können. Meistens hinterlassen sie ein Bild des Grauens. Die genaue Zahl der Toten wird man meistens nie erfahren. Die Suche nach Überlebenden gestaltet sich sehr schwierig, da das Wasser oft Eisenbahnschienen und Straßen einfach wegspült, Häuser und Fischboote zerstört.Oft trifft Hilfe aus aller Welt ein. Als erstes brauchen die Überlebenden Unterkünfte und Medikamente. Die Obdachlosen bringt man wenn möglich in riesigen Zeltlagern unter. Dann beginnen die Helfer, die Trümmer wegzuräumen, und nehmen die wohl schwerste Aufgabe in Angriff: das Bergen der Leichen, bevor diese verwesen und 6 womöglich Seuchen, wie Cholera und Thyphus, verursachen. Nach den Aufräumarbeiten kann langsam wieder das normale Leben aufgenommen werden. (2) Erinnerung: Tausende gedenken der Tsunami-Opfer Abbildung 26.12.2011, 12:55 Uhr dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH Tausende Menschen haben am Montag in Thailand und Indonesien der Opfer des verheerenden Tsunami am 26. Dezember 2004 gedacht.Allein entlang der Westküste von Sumatra starben 170 000 Menschen. In Aceh kamen Angehörige an dem Massengrab in Siron zusammen. Nach der Tragödie mussten viele Leichen anonym bestattet werden. Tausende Papierpflanzen nahe Banda Aceh in Indonesien erinnern an die Toten der TsunamiKatastrophe von 2004. (4) 3. Didaktisch-methodische Analyse 3.1 Bezug zum Bildungsplan Einbettung der Unterrichtsstunde in den Fächerverbund WZG Bezug zu den Bildungsstandards – Leitgedanken zum Kompetenzerwerb Grundlegende Kenntnisse von natürlichen Voraussetzungen sollen zu einem Raumverständnis führen, das Bedingungen einer verantwortlichen menschlichen Nutzung einordnen kann.Die Schülerinnen und Schüler nehmen lokale und globale Gefährdung durch Naturkatastrophen und menschliches Handeln wahr. Ausgangspunkt der Entscheidung für Themen, Methoden und Medien sind der Erfahrungsund Interessenhorizont der Schülerinnen und Schüler. Diese gewinnen Informationen aus kontinuierlichen und nicht-kontinuierlichen Texten. Literatur und Film werden in den Unterricht einbezogen. Das Thema der Unterrichtseinheit wie auch das Thema der Stunde ist im Bildungsplan der Werkrealschule folgenden Kompetenzbereichen zuzuordnen: Kompetenzbereich „Erde und Umwelt kennen Wind und Wasser als äußere Kräfte, die die Erdoberfläche formen Kompetenzbereich „Orientierung in Raum und Zeit können geschichtliche Ereignisse in eine Zeitleiste einordnen 7 3.2 Einbettung in die Einheit Die heutige Stunde ist die erste Stunde im Teilbereich „Naturkatastrophen der Einheit „Unsere Erde. Das Thema der Unterrichtsstundefolgt im Sinne der Schülerorientierungden Interessen und Wissensbedürfnissen, die durch ihre konkreten Fragen sichtbar geworden sind. Über die Formulierung von Fragen zum Thema „Unsere Erde entstanden 4 Kategorien: 1. Entstehung der Erde 2. Naturkatastrophen und Zukunft 3. Rekorde der Erde 4. Rund um die Erde (sonstige Fragen) Die Informationen werden entsprechend den Fragen ausgewählt und bereitgestellt. Die Schülerfragen fungieren somit als Leitfragen, zugleich aber auch als Arbeitsfragen. Die Schüler lernen mit ihren eigenen Fragen ihre Umwelt zu erschließen und Antworten auf ihre Fragen zu finden. Diese Art von Unterricht ist als ein Beitrag zum selbst gesteuerten Unterricht zu verstehen, bei dem die Schüler Entscheidungen im Lernprozess (z.B.: Anlass, Art und Weise, Inhalt, Ziel) beeinflussen können. (5) 3.3 Qualitätskriterien Themenorientierung Die Umsetzung des Fächerverbundsgedanken erfordert eine themenorientierte Herangehensweise. Das Thema ist zwar überwiegend geografisch geprägt, jedoch lassen sich darüber hinaus Perspektiven aus Geschichte, Soziologie (sozialen Verhaltens) und Wirtschaft daran aufzeigen. Selbstständiges Lernen Methoden selbstständigen Lernens schaffen Motivation und Lernerfolg durch Differenzierung. In der Stationenarbeit werde verschiedene Unterrichtsinhalet gleichzeitig angeboten, sodass die Schüler über die Reihenfolge der Arbeit und über die Verweildauer an der Station weitgehend selbst bestimmen können. Es werden soziale (Arbeiten in Partnerarbeit), personale (kommunizieren) und methodische (Arbeit mit unterschiedlichen Texten, Büchern) Kompetenzen gefördert. 3.4 Lernziele der Stunde Abgeleitet von den zu erreichenden Kompetenzen setze ich folgende Zielsetzungen: Stundenziel: In der heutigen Stunde bearbeiten die Schülerinnen und Schüler mindestens eine von ihnen selbst gestellte Frage zum Thema „Naturkatastrophen. Ziele Ich arbeite so, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Frage einem übergeordneten Thema zuordnen ihr Vorwissen äußern eine der drei Stationen 8 Maßnahmen Indikatoren Schülerinnen und Schüler Fragekärtchen Kategorienübersicht ordnen ihre Frage einer der vier Kategorie zu Placemat notieren ihr Vorwissen Arbeitsangebote an Stationen arbeiten selbstständig mit (Fragen) bearbeiten ihre Arbeitsergebnisse mitteilen können angeregt werden weitere Fragen zu unbekannten Themenbereichen zu stellen Impulsanfangssätze Impulsfrage: Ich frage mich noch Partner, tauschen sich aus hören zu, äußern sich äußern Fragen 3.5 Didaktisch-Methodischer Kommentar Die folgenden Phasen des Unterrichts orientieren sich im Groben an dem Beispiel für sinnvolle Unterrichtsphasen nach Unruh Petersen (6), die ich in der Vorbereitung auf die Stunde übertragen und dabei modifiziert habe. Ankommen („Lernlaune) Vor Beginn der Stunde habe ich bereits Gruppentische aufgestellt. Die übliche Anordnung der Tische ist für diese Unterrichtsstunde ungünstig, sodass ich sie verändert habe. Zunächst setzen sich die Jugendlichen an ihren Platz und ich begrüße alle Personen im Raum. Anschließend folgt die „Frage der Woche, eine Form des Unterrichtseinstiegs. Ein Schüler, der sich in der vorangegangenen Stunde bereit erklär hat, schreibt eine Frage auf eine Folie, die –ähnlich wie bei einer Quizshow im Fernsehen- drei oder vier Antwortvorgaben hat. Die Schüler zeigen mit der Anzahl ihrer hochgehaltenen Finger an, was ihrer Meinung nach die richtige Antwort ist. Dieses Ritual zu Beginn der Stunde soll die Jugendlichen auf den WZG-Unterricht einstimmen. Die Schüler werden so dazu angehalten mit offenen Augen durchs Leben zu gehen. Außerdem schafft eine „Frage der Woche zu Beginn eines Nachmittagsunterrichts schnell Aufmerksamkeit und Konzentration. Es ist ein exzellentes Instrument, um die zum erfolgreichen Lernen so wichtige „Lernlaune auf Seiten der Schüler zu schaffen. (6) Fahrplan der Einheit Da die Schüler gewohnt sind den geplanten Ablauf der Stunde am Anfang zu erfahren, verweise ich darauf, dass sie ihn heute nicht als Fahrplan der Stunde, sondern als Fahrplan der Einheit anhand eines Plakates kennen lernen. Da echtes Lernen, das von Entdeckerfreude, Motivation und Durchhaltevermöge gekennzeichnet ist und auch auf lange Sicht bleibende Erkenntnisse, Fähigkeiten und Wissen vermittelt, dann stattfindet, wenn es als sinnvoll erlebt wird, mache ich meinen Schülern transparent, was genau die nächsten Themen der Unterrichtseinheit sind. Ich verweise darauf, dass die Themen durch ihre Fragen bestimmt wurden und dass ihre Aufgabe ist ihre Fragen den Kategorien zuzuordnen. Danach erkläre ich, dass wir heute an dem Thema „Naturkatastrophen arbeiten werden. Vorwissen Um das Vorwissen zu aktivieren, setzte ich, nach dem Konzept des Kooperativen Lernens, die Methode „Placemat ein. Der Ablauf lässt sich in drei Phasen gliedern 9 1. Einzelarbeit: Pro Feld nimmt je eine Person Platz und schreibt in einer vorgegebenen Zeit seine Gedanken und Wissen zum Thema „Naturkatastrophen auf. 2. Gruppenarbeit: Anschließend tauschen die Lernenden ihre individuellen Notizen mit den anderen Gruppenmitgliedern aus. Dazu wird das Blatt gedreht und die Lernenden lesen, bis jede Person ihr ursprüngliches Feld erneut vor sich hat. Nachdem alle Lernenden sämtliche Eintragungen gelesen haben, einigen sie sich auf beispielsweise zwei bis drei zentrale Aussagen. Dabei ist wichtig, dass die Lernenden genug Sprechanlässe haben, um sich über ihr Vorwissen auszutauschen, die Ideen jedes einzelnen Gruppenmitgliedes zu berücksichtigen, sowie einen Konsens zu finden, welche Einzelaussagen für die Meinung der gesamten Gruppe stehen. Diese Aussagen finden in der Mitte des Placemats Platz. 3. Plenum: In der dritten Phase wird auf eine Präsentation der Ergebnisse der Kleingruppen aus Zeitgründen verzichtet. Es wird lediglich das Feld in der Mitte des Placemats entfernt, durch mich gesichtet und an den Lernstationen als Informationswissen angebracht. Ich habe mich erfahrungsgemäß dafür entschieden, die Schüler ihr Vorwissen zuerst auf PostIts schreiben zu lassen und diese dann auf ihr Placemat zu platzieren. Ihre Konsensaussage kann so leicht in die Mitte des Placemats übertragen werden. Info zum Thema Die Schüler sehen eine kurze Filmsequenz zum Erdbeben in Sumatra am 26.12.2004. Genannte Fachbegriffe werden genannt, aber anschließend nicht nur teilweise in der Stationenarbeit thematisiert. Es dient als Motivation. Die Filmsequenz wird am Ende des Teilbereichs „Naturkatastrophen aufgegriffen und thematisiert. Selbstständige Arbeit Der Arbeitsauftrag wird an der Tafel visualisiert. Die Schüler arbeitet mit der ihnen bekannte Stationenarbeit. Die Stationen behandeln unsere vorher gesammelten Fragen Ablauf: 1. Suche dir mit deinem Sitznachbarn ein Teilthema heraus. 2. Bearbeitet ein Teilthema und kontrolliert es danach. 3. Es gibt folgende Stationen: Station 1: Bücher sind spannend! Erdbeben, Tsunami und Erdkrustenverschiebung Station 2: Zeitstrahl! Wann war der große Tsunami? Station 3: Erinnern und Bauen! Was passiert nach einer Naturkatastrophe? 4. Stelle die Ergebnisse in der Abschlussrunde anhand der Anfangssätze deinen Mitschülern vor. Während dieser Phase stehe ich den Schülern beratend zur Seite und gebe ggf. Hilfestellung. Ein akustisches Signal beendet diese Phase. Stundenschluss/ Feedback 10 Durch die Kurzvorstellung der Arbeitsergebnisse einzelner Schüler und anhand der Impuls Satzanfänge: Ich weiß jetzt, Mich hat überrascht, Ich frage mich noch, versprachlichen die Schüler zum einen ihren Lernzuwachs, und zum anderen erweitern die Mitschüler ihr Wissen durch das Expertenwissen der anderen. 11 4. Verlaufsplan Thema der Phase Unterrichtsgeschehen Sozialform Medien/ Material Ankommen („Lernlaune) Begrüßung L./S. Frage der Woche Plenum OHP, Folie Fahrplan der Einheit Stundenthema L. stellt Einheitsplan vor S. ordnen ihre Frage einem Überthema zu L. stellt Stundenthema vor Plenum Fragekärtchen, VierKategorienübersicht Vorwissen S. notieren ihr Vorwissen S. sammeln und diskutieren Konsens Einzelarbeit Gruppenarbeit (Placemat) Post-Its, Packpapier A4 Papier Info zum Thema Filmsequenz „Das Sumatra-Beben am 26.12.2004 Plenum Film Selbstständige Arbeit L. stellt Arbeitsauftrag vor Partnerarbeit S. arbeiten an 3 Stationen: Station 1: Bücher sind spannend! Erdbeben, Tsunami und Erdkrustenverschiebung Station 2: Zeitstrahl! Wann war der große Tsunami? Station 3: Erinnern und Bauen! Was passiert nach einer Naturkatastrophe? L. steht als Beraterin zur Seite und gibt ggf. Hilfestellung 12 Arbeitsmaterial: Arbeitsblätter, Info-Blätter, Bücher, Trinkhalm, Papier Dreiklang L. beendet Arbeitsphase durch ein akustisches Signal Stundenschluss/ Feedback Fragestellungen: „Ich frage mich noch, „Ich weiß jetzt, „Mich hat heute überrascht L./S. verabschieden sich 13 Plenum Feedback-Karten 5. Literaturverzeichnis 1. Magazin-Verl., Meyers Lexikonredaktion in Zusammenarbeit mit FOCUS. Naturkatastrophen. Das Lexikon zu ihren Ursachen und Folgen. Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich: Meyers Lexikonverlag,, 1999. 2. Watts, Claire (Autor) und Bergfeld, Christiane (Übersetzer):. Nturkatastrophen. Tsunamis, Hurrikane, Erdbeben, Vulkanausbrüche. Hildesheim Gerstenberg Verlag, 2007. 3. [Online] 25. Januar 2012. [Zitat vom: 29. Januar 2012.] 4. www.nachrichten.t-online.de. www.nachrichten.t-online.de. [Online] 26. Dezember 2011. [Zitat vom: 29. Januar 2012.] 5. Dehne, Brigitte: Fragen. [Buchverf.] Ulrich Mayer, et al. Wörterbuch Geschichtsdidaktik. Schwalbach WOCHENSCHAU Verlag, 2006. 6. Unruh, Thomas und Petersen, Susanne: Guter Unterricht. Handwerkszeug für Unterrichtsprofis. Buxtehude AOL- Verlag, 2011. 6. Abbildungsverzeichnis 7. Anhang Arbeitsblätter an Stationen 1-3 14